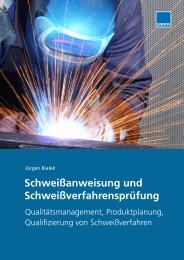Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
mehrere Mikrorisse aus, die wiederum zu Makrorissen führten. Der dominierende Makroriss, der zum Versagen<br />
der Fügestelle führt, konnte im Vorhinein des Dauerschwingversuchs nicht identifiziert werden. Aus<br />
diesem Grund war eine Rissfortschrittsanalyse nicht anwendbar [18].<br />
4 Ziele<br />
Die Verbindungsfestigkeit einer mittels Laserstrahlschweißen hergestellten Batteriezellkontaktierung wurde<br />
oftmals auf eine Überlappverbindung aus zwei Blechen abstrahiert und ihr Versagen bei einer statischen Belastung<br />
ermittelt. In realen Anwendungen liegen meist dynamische Belastungszustände vor. Aus diesem<br />
Grund wurde eine Untersuchung der Kontaktierung im Dauerschwingversuch durchgeführt. Der elektrische<br />
Widerstand wurde mit der Vier-Leiter-Messung bestimmt. Dieser eignet sich als Schädigungsparameter, da er<br />
innerhalb der Kontaktierung einer realen Batteriezelle eine direkte Auswirkung auf die Effizienz des Batteriespeichers<br />
besitzt. Das Ziel war es, den Einfluss der Laserleistung, der Schweißgeschwindigkeit sowie der -<br />
nahttrajektorie auf das Ermüdungsverhalten zu untersuchen. Es wird nur der Zeitfestigkeitsbereich analysiert,<br />
da die Kontaktierung bei niedrigen Lasten eine lange Lebensdauer aufweist und bei hohen Lasten in guter<br />
Näherung die statische Festigkeit angenommen werden kann.<br />
5 Prüfstand<br />
Für die Versuche wurde die Schwingprüfanlage TV 51140 der Firma TIRA GmbH, Deutschland, verwendet.<br />
Diese beinhaltete einen Schwingerreger S 51140, der auch als Shaker bezeichnet wird, und einen Verstärker<br />
BAA 1000. Im Shaker befand sich ein Beschleunigungsaufnehmer des Unternehmens PCB Piezotronics,<br />
USA, mit der Modellnummer 355M102. Basierend auf den Messungen wurde die Anregungskraft geregelt.<br />
Das 18650-Rundzellgehäuse wurde von dem Shaker mit einer sinusförmigen Kraftanregung FFFF(tttt) im Wechselbereich<br />
und einer Frequenz von 50 Hz belastet (Bild 2 a). Die Prüftemperatur lag bei 23 °C. Der Abstand<br />
von der Einspannung des Zellverbinders bis zum Rand des Zellgehäuses betrug 1 mm. Diese Distanz wurde<br />
an die realen Bedingungen in einem Batteriespeicher angelehnt.<br />
Bild 2. (a) Schematischer Versuchsaufbau mit Vier-Leiter-Messung sowie (b) Schweißnahttrajektorien mit den zugehörigen<br />
Abmessungen sowie möglicher Positionierungsfehler bei den Schweißnähten Δyyyy RRRRRRRRRRRRRRRR,1 und Δyyyy RRRRRRRRRRRRRRRR,2<br />
Zum Laserstrahlschweißen der Kontaktierung zwischen dem Zellverbinder und -gehäuse wurde ein Scheibenlaser<br />
des Typs TruDisk 1020 der TRUMPF Laser GmbH, Deutschland, genutzt, der Strahlung im grünen<br />
Wellenlängenbereich emittiert, um somit dem hohen Reflexionsgrad des Kupfers entgegenzuwirken. Im Rahmen<br />
dieser Studie wurden Kontaktierungen mit fünf unterschiedlichen Schweißnahttrajektorien untersucht, die<br />
4<br />
DVS 389