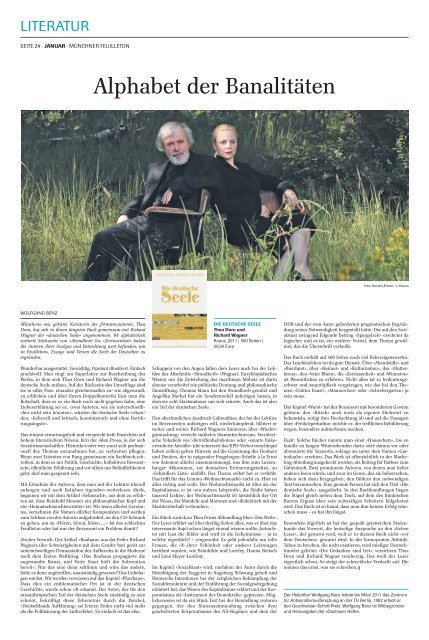Brot und Spiele - Münchner Feuilleton
Brot und Spiele - Münchner Feuilleton
Brot und Spiele - Münchner Feuilleton
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
LITERATUR<br />
SEITE 24 · JANUAR · MÜNCHNER FEUILLETON<br />
WOLFGANG BENZ<br />
Münchens neu gekürte Kuratorin des formum:autoren, Thea<br />
Dorn, hat sich in ihrem jüngsten Buch gemeinsam mit Richard<br />
Wagner der »deutschen Seele« angenommen. 64 alphabetisch<br />
sortierte Stichworte von »Abendbrot« bis »Zerrissenheit« haben<br />
die Autoren ihrer Analyse <strong>und</strong> Betrachtung wert bef<strong>und</strong>en, um<br />
in <strong>Feuilleton</strong>s, Essays <strong>und</strong> Versen die Seele der Deutschen zu<br />
ergründen.<br />
W<strong>und</strong>erbar ausgestattet. Gewichtig. Opulent illustriert. Einfach<br />
prachtvoll. Man ringt um Superlative zur Beschreibung des<br />
Werks, in dem sich Thea Dorn <strong>und</strong> Richard Wagner um die<br />
deutsche Seele mühen. Auf der Rückseite des Umschlags sind<br />
sie in edler Pose, einander gleichermaßen zu- wie abgewandt,<br />
zu erblicken <strong>und</strong> über ihrem Doppelkonterfei liest man die<br />
Botschaft, dass es so ein Buch noch nicht gegeben habe, eine<br />
Liebeserklärung sei es, »zwei Autoren, wie sie unterschiedlicher<br />
nicht sein könnten«, würden die deutsche Seele erk<strong>und</strong>en,<br />
»liebevoll <strong>und</strong> kritisch, kenntnisreich <strong>und</strong> ohne Berührungsängste«.<br />
Das stimmt erwartungsfroh <strong>und</strong> verspricht tiefe Einsichten auf<br />
hohem literarischem Niveau, fern der öden Prosa, in der sich<br />
Sozialwissenschaftler, Historiker oder wer sonst sich professionell<br />
des Themas anzunehmen hat, zu verbreiten pfl egen.<br />
Wenn zwei Literaten von Rang gemeinsam ein Sachbuch schreiben,<br />
in dem es um Politik, Geschichte, kollektives Bewusstsein,<br />
öffentliche Erfahrung <strong>und</strong> vor allem um Befi ndlichkeiten<br />
geht, darf man gespannt sein.<br />
Mit Erlaubnis der Autoren, dass man mit der Lektüre überall<br />
anfangen <strong>und</strong> nach Belieben irgendwo weiterlesen dürfe,<br />
beginnen wir mit dem Artikel »Sehnsucht«, aus dem zu erfahren<br />
ist, dass Reinhold Messner ein philosophischer Kopf <strong>und</strong><br />
ein »Heimatsehnsuchtsverräter« ist. Wir lesen allerlei Gereimtes,<br />
vernehmen die Namen etlicher Komponisten <strong>und</strong> werden<br />
zum Schluss von der Autorin aufgefordert, an den CD-Schrank<br />
zu gehen, um zu »Hören, hören, hören ... « Ist das schlechtes<br />
<strong>Feuilleton</strong> oder hat nur der Rezensent ein Problem damit?<br />
Zweiter Versuch. Der Artikel »Bauhaus« aus der Feder Richard<br />
Wagners (der Schwierigkeiten mit dem Genitiv hat) gerät zur<br />
unterschwelligen Denunziation des Aufbruchs in die Moderne<br />
nach dem Ersten Weltkrieg. »Das Bauhaus propagierte die<br />
angewandte Kunst, <strong>und</strong> Vater Staat hielt die Subvention<br />
bereit«: War das eine denn schlimm <strong>und</strong> wäre das andere,<br />
hätte es denn zugetroffen, unanständig gewesen? Das Unbehagen<br />
wächst. Wir werden verwiesen auf das Kapitel »Pfarrhaus«.<br />
Dass dies ein emblematischer Ort ist in der deutschen<br />
Geschichte, wurde schon oft erkannt. Der Autor, der für den<br />
misanthropischen Teil der deutschen Seele zuständig zu sein<br />
scheint, bekräftigt diese Erkenntnis durch die Parabel,<br />
»Deutschlands Aufklärung« sei letzten Endes nicht viel mehr<br />
als die Politisierung der Lutherbibel. So einfach ist das also.<br />
Alphabet der Banalitäten<br />
DIE DEUTSCHE SEELE<br />
Thea Dorn <strong>und</strong><br />
Richard Wagner<br />
Knaus, 2011 | 560 Seiten |<br />
26,99 Euro<br />
Schuppen von den Augen fallen dem Leser auch bei der Lektüre<br />
des Abschnitts »Strandkorb« (Wagner). Enzyklopädisches<br />
Wissen um die Entstehung des maritimen Möbels ist darin<br />
ebenso verarbeitet wie politische Deutung <strong>und</strong> philosophische<br />
Sinnstiftung. Thomas Mann hat den Strandkorb genutzt <strong>und</strong><br />
Angelika Merkel hat ein Sondermodell anfertigen lassen, in<br />
dem sie acht Staatsmänner um sich scharte. Auch das ist also<br />
ein Teil der deutschen Seele.<br />
Den altertümlichen Ausdruck Galimathias, der bei der Lektüre<br />
im Rezensenten aufsteigen will, niederkämpfend, blättert er<br />
weiter <strong>und</strong> weiter. Richard Wagners Sinnieren über »Wiedergutmachung«<br />
erreicht mühelos Stammtischniveau. Verräterische<br />
Vokabeln wie »Betroffenheitsboten« oder »smarte linksorientierte<br />
Anwälte« (die seinerzeit das KPD-Verbot verschleppt<br />
haben sollen) geben Hinweis auf die Gesinnung des Denkers<br />
<strong>und</strong> Deuters, der in epigonaler Fragebogen-Schelte à la Ernst<br />
von Salomon allerlei zusammenmengt, was ihm zum Luxemburger<br />
Abkommen, zur deutschen Erinnerungskultur, zu<br />
»Schindlers Liste« einfällt. Das Thema selbst hat er verfehlt.<br />
Das trifft für das Lemma »Weihnachtsmarkt« nicht zu. Hier ist<br />
alles richtig <strong>und</strong> wahr. Der Weihnachtsmarkt ist älter als der<br />
Kapitalismus, er ist »ein wahres Labyrinth«, die Städte haben<br />
tausend Lichter, der Weihnachtsmarkt ist tatsächlich der Ort<br />
der Nüsse, der Mandeln <strong>und</strong> Maronen <strong>und</strong> »dialektisch mit der<br />
Marktwirtschaft verb<strong>und</strong>en«.<br />
Ein Stück zurück zu Thea Dorns Abhandlung über »Das Weib«.<br />
Der Leser erfährt auf über dreißig Seiten alles, was er über das<br />
interessante Sujet schon längst einmal wissen wollte, betrachtet<br />
mit Lust die Bilder <strong>und</strong> wird in die Geheimnisse – ja in<br />
welche eigentlich? – eingeweiht. Es geht jedenfalls um tolle<br />
Frauen, die ob ihrer Schönheit oder anderer Leistungen<br />
berühmt wurden, wie Brünhilde <strong>und</strong> Loreley, Hanna Reitsch<br />
<strong>und</strong> Lena Meyer-Landrut.<br />
Im Kapitel »Sozialstaat« wird, nachdem der Autor durch die<br />
Besichtigung der Fuggerei in Augsburg Schwung geholt <strong>und</strong><br />
Bismarcks Intentionen bei der zeitgleichen Bekämpfung der<br />
Sozialdemokratie <strong>und</strong> der Einführung der Sozialgesetzgebung<br />
erläutert hat, das Wesen des Kapitalismus erklärt <strong>und</strong> der Korporatismus<br />
als »Instrument der Demokratie« gepriesen. Möglicherweise<br />
ist da ein Stück Text bei der Herstellung verloren<br />
gegangen, der den Sinnzusammenhang zwischen dem<br />
gescheiterten Korporatismus des NS-Regimes <strong>und</strong> dem der<br />
Foto: Kerstin Ehmer, © Knaus<br />
DDR <strong>und</strong> der vom Autor geforderten pragmatischen Begründung<br />
seiner Notwendigkeit hergestellt hätte. Der auf den Sozialstaat<br />
zwingend folgende Beitrag »Spargelzeit« erscheint da<br />
logischer <strong>und</strong> er ist, ein weiterer Vorteil, dem Thema gewidmet,<br />
das die Überschrift verheißt.<br />
Das Buch enthält auf 560 Seiten noch viel Beherzigenswertes.<br />
Das Lesebändchen tut da gute Dienste. Über »Abendstille« <strong>und</strong><br />
»Bierdurst«, über »Heimat« <strong>und</strong> »Kulturnation«, das »Mutterkreuz«,<br />
den »Vater Rhein«, die »Zerrissenheit« <strong>und</strong> »Winnetou«<br />
ist Wesentliches zu erfahren. Nicht alles ist so bedeutungsschwer<br />
<strong>und</strong> sauertöpfi sch vorgetragen, wie das bei den Themen<br />
»Doktor Faust«, »Männerchor« oder »Schrebergarten« ja<br />
sein muss.<br />
Das Kapitel »Wurst« hat der Rezensent mit besonderem Gewinn<br />
gelesen, den »Kitsch« auch noch als eigenes Stichwort zu<br />
behandeln, nötigt ihm Hochachtung ab <strong>und</strong> auf die Passagen<br />
über »Freikörperkultur« möchte er, der treffl ichen Bebilderung<br />
wegen, besonders aufmerksam machen.<br />
Fazit: Solche Bücher nannte man einst »Hausschatz«, las en<br />
famille an langen Winterabenden darin oder daraus vor oder<br />
abonnierte die Textsorte, solange sie unter dem Namen »Gartenlaube«<br />
erschien. Das Werk ist offensichtlich in der Marketing-Abteilung<br />
ausgeheckt worden, als Beitrag für Ratlose zum<br />
Gabentisch. Zwei prominente Autoren, von denen man lieber<br />
anderes lesen würde, <strong>und</strong> zwar im Genre, das sie beherrschen,<br />
haben sich dazu hergegeben, den Bildern den notwendigen<br />
Text beizumischen. Eine geniale Person hat sich den Titel »Die<br />
deutsche Seele« ausgedacht. In den Buchhandlungen liegen<br />
die Stapel gleich neben dem Tisch, auf dem des fränkischen<br />
Barons Erguss über sein zeitweiliges Scheitern feilgeboten<br />
wird. Das Buch ist so banal, dass man ihm keinen Erfolg wünschen<br />
muss – es hat ihn längst.<br />
Besonders ärgerlich ist bei der gequält geistreichen Seelenk<strong>und</strong>e<br />
das Vorwort, die leutselige Ansprache an den »lieben<br />
Leser«, der gewarnt wird, weil er in diesem Buch nicht »vor<br />
dem Deutschen« gewarnt wird. In der larmoyanten Attitüde,<br />
Tabus zu brechen, die nicht existieren, wird miefi ger Deutschtümelei<br />
gefrönt. »Die Gedanken sind frei«, versichern Thea<br />
Dorn <strong>und</strong> Richard Wagner treuherzig. Das weiß der Leser<br />
eigentlich schon. So steigt der schreckliche Verdacht auf: Die<br />
meinen das ernst, was sie schreiben. ||<br />
Der Historiker Wolfgang Benz leitete bis März 2011 das Zentrum<br />
für Antisemitismusforschung an der TU Berlin. 1992 erhielt er<br />
den Geschwister-Scholl-Preis. Wolfgang Benz ist Mitbegründer<br />
<strong>und</strong> Herausgeber der »Dachauer Hefte«.