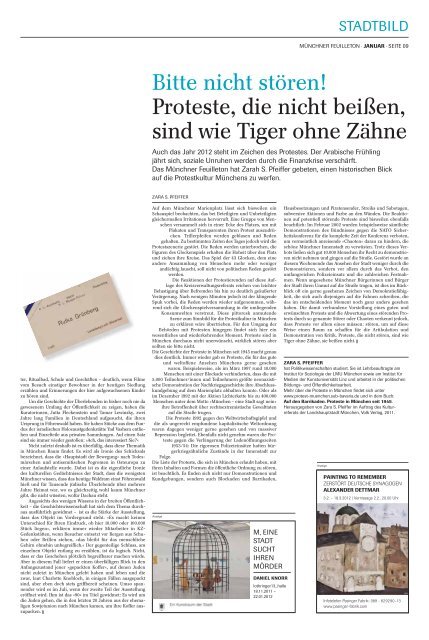Brot und Spiele - Münchner Feuilleton
Brot und Spiele - Münchner Feuilleton
Brot und Spiele - Münchner Feuilleton
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
ter, Ritualbad, Schule <strong>und</strong> Geschäften – deutlich, wenn Filme<br />
vom Besuch einstiger Bewohner in der heutigen Siedlung<br />
erzählen <strong>und</strong> Erinnerungen der hier aufgewachsenen Kinder<br />
zu hören sind.<br />
Um die Geschichte der Überlebenden in bisher noch nie da<br />
gewesenem Umfang der Öffentlichkeit zu zeigen, haben die<br />
Kuratorinnen, Jutta Fleckenstein <strong>und</strong> Tamar Lewinsky, zwei<br />
Jahre lang Familien in Deutschland aufgesucht, die ihren<br />
Ursprung in Föhrenwald haben. Sie haben Stücke aus dem F<strong>und</strong>us<br />
der israelischen Holocaustgedenkstätte Yad Vashem entliehen<br />
<strong>und</strong> Einzelteile aus privaten Sammlungen. Auf einen Satz<br />
sind sie immer wieder gestoßen: »Ach, das interessiert Sie?«<br />
Nicht zuletzt deshalb ist es überfällig, dass diese Thematik<br />
in München Raum fi ndet. Es wird als Ironie des Schicksals<br />
bezeichnet, dass die »Hauptstadt der Bewegung« nach Todesmärschen<br />
<strong>und</strong> antisemitischen Pogromen in Osteuropa zu<br />
einer Anlaufstelle wurde. Dabei ist es die eigentliche Ironie<br />
des kulturellen Gedächtnisses der Stadt, dass die wenigsten<br />
<strong>Münchner</strong> wissen, dass das heutige Waldram einst Föhrenwald<br />
hieß <strong>und</strong> für Tausende jüdische Überlebende über mehrere<br />
Jahre Heimat war, wo es gleichzeitig wohl kaum <strong>Münchner</strong><br />
gibt, die nicht wüssten, wofür Dachau steht.<br />
Angesichts des wenigen Wissens in der breiten Öffentlichkeit<br />
– die Geschichtswissenschaft hat sich dem Thema durchaus<br />
ausführlich gewidmet – ist es die Stärke der Ausstellung,<br />
dass das Objekt im Vordergr<strong>und</strong> steht. »Es macht keinen<br />
Unterschied für Ihren Eindruck, ob hier 10.000 oder 100.000<br />
Stück liegen«, erklären immer wieder Mitarbeiter in KZ-<br />
Gedenkstätten, wenn Besucher entsetzt vor Bergen aus Schuhen<br />
oder Brillen stehen, »das bleibt für das menschliche<br />
Gehirn ohnehin unbegreifl ich.« Der gegenteilige Schluss, am<br />
einzelnen Objekt entlang zu erzählen, ist da logisch. Nicht,<br />
dass er das Geschehen plötzlich begreifbarer machen würde.<br />
Aber in diesem Fall liefert er einen überfälligen Blick in den<br />
Anfangszustand jener »gepackten Koffer«, auf denen Juden<br />
nicht zuletzt in München gelebt haben <strong>und</strong> leben <strong>und</strong> die<br />
zwar, laut Charlotte Knobloch, in einigen Fällen ausgepackt<br />
sind, aber eben doch stets griffbereit scheinen. Umso spannender<br />
wird es im Juli, wenn der zweite Teil der Ausstellung<br />
eröffnet wird. Ihm ist das »90« im Titel gewidmet: Es wird um<br />
die Juden gehen, die in den letzten 20 Jahren aus der ehemaligen<br />
Sowjetunion nach München kamen, um ihre Koffer auszupacken.<br />
||<br />
ZARA S. PFEIFFER<br />
Auf dem <strong>Münchner</strong> Marienplatz lässt sich bisweilen ein<br />
Schauspiel beobachten, das bei Beteiligten <strong>und</strong> Unbeteiligten<br />
gleichermaßen Irritationen hervorruft. Eine Gruppe von Menschen<br />
versammelt sich in einer Ecke des Platzes, um mit<br />
Plakaten <strong>und</strong> Transparenten ihren Protest auszudrücken.<br />
Trillerpfeifen werden geblasen <strong>und</strong> Reden<br />
gehalten. Zu bestimmten Zeiten des Tages jedoch wird die<br />
Protestszenerie gestört. Die Reden werden unterbrochen, die<br />
Figuren des Glockenspiels erhalten die Hoheit über den Platz<br />
<strong>und</strong> ziehen ihre Kreise. Das Spiel der 43 Glocken, dem eine<br />
andere Ansammlung von Menschen mehr oder weniger<br />
andächtig lauscht, soll nicht von politischen Reden gestört<br />
werden.<br />
Die Reaktionen der Protestierenden auf diese Auflage<br />
des Kreisverwaltungsreferats reichen von leichter<br />
Belustigung über Befremden bis hin zu deutlich geäußerter<br />
Verärgerung. Nach wenigen Minuten jedoch ist der klingende<br />
Spuk vorbei, die Reden werden wieder aufgenommen, während<br />
sich die Glockenspielversammlung in die umliegenden<br />
Konsumwelten verstreut. Diese pittoresk anmutende<br />
Szene zum Sinnbild für die Protestkultur in München<br />
zu erklären wäre übertrieben. Für den Umgang der<br />
Behörden mit Protesten hingegen fi ndet sich hier ein<br />
wesentliches <strong>und</strong> wiederkehrendes Moment. Proteste sind in<br />
München durchaus nicht unerwünscht, wirklich stören aber<br />
sollten sie bitte nicht.<br />
Die Geschichte der Proteste in München seit 1945 macht genau<br />
dies deutlich. Immer wieder gab es Proteste, die für das gute<br />
<strong>und</strong> weltoffene Ansehen Münchens gerne gesehen<br />
waren. Beispielsweise, als im März 1997 r<strong>und</strong> 10.000<br />
Menschen mit einer Blockade verhinderten, dass die mit<br />
5.000 Teilnehmer/innen <strong>und</strong> Teilnehmern größte neonazistische<br />
Demonstration der Nachkriegsgeschichte ihre Abschlussk<strong>und</strong>gebung<br />
auf dem Marienplatz abhalten konnte. Oder als<br />
im Dezember 1992 mit der Aktion Lichterkette bis zu 400.000<br />
Menschen unter dem Motto »München – eine Stadt sagt nein«<br />
ihre Betroffenheit über rechtsextremistische Gewalttaten<br />
auf die Straße trugen.<br />
Die Proteste 1992 gegen den Weltwirtschaftsgipfel <strong>und</strong><br />
die als ungerecht empf<strong>und</strong>ene kapitalistische Weltordnung<br />
waren dagegen weniger gerne gesehen <strong>und</strong> von massiver<br />
Repression begleitet. Ebenfalls nicht genehm waren die Proteste<br />
gegen die Verlängerung der Ladenöffnungszeiten<br />
1953/54: Die rigorosen Polizeieinsätze hatten bürgerkriegsähnliche<br />
Zustände in der Innenstadt zur<br />
Folge.<br />
Die Liste der Proteste, die sich in München erlaubt haben, mit<br />
ihren Inhalten <strong>und</strong> Formen die öffentliche Ordnung zu stören,<br />
ist beachtlich. Es fi nden sich nicht nur Demonstrationen <strong>und</strong><br />
K<strong>und</strong>gebungen, sondern auch Blockaden <strong>und</strong> Barrikaden,<br />
STADTBILD<br />
MÜNCHNER FEUILLETON · JANUAR · SEITE 09<br />
Bitte nicht stören!<br />
Proteste, die nicht beißen,<br />
sind wie Tiger ohne Zähne<br />
Auch das Jahr 2012 steht im Zeichen des Protestes. Der Arabische Frühling<br />
jährt sich, soziale Unruhen werden durch die Finanzkrise verschärft.<br />
Das <strong>Münchner</strong> <strong>Feuilleton</strong> hat Zarah S. Pfeiffer gebeten, einen historischen Blick<br />
auf die Protestkultur Münchens zu werfen.<br />
Anzeige<br />
M, EINE<br />
STADT<br />
SUCHT<br />
IHREN<br />
MÖRDER<br />
DANIEL KNORR<br />
lothringer13_halle<br />
18.11.2011 –<br />
22.01.2012<br />
Hausbesetzungen <strong>und</strong> Piratensender, Streiks <strong>und</strong> Sabotagen,<br />
subversive Aktionen <strong>und</strong> Farbe an den Wänden. Die Reaktionen<br />
auf potentiell störende Proteste sind bisweilen ebenfalls<br />
beachtlich: Im Februar 2002 wurden beispielsweise sämtliche<br />
Demonstrationen des Bündnisses gegen die NATO Sicherheitskonferenz<br />
für die komplette Zeit der Konferenz verboten,<br />
um vermeintlich anreisende »Chaoten« daran zu hindern, die<br />
schöne <strong>Münchner</strong> Innenstadt zu verwüsten. Trotz dieses Verbots<br />
ließen sich gut 10.000 Menschen ihr Recht zu demonstrieren<br />
nicht nehmen <strong>und</strong> gingen auf die Straße. Gestört wurde an<br />
diesem Wochenende das Ansehen der Stadt weniger durch die<br />
Demonstrieren, sondern vor allem durch das Verbot, den<br />
umfangreichen Polizeieinsatz <strong>und</strong> die zahlreichen Festnahmen.<br />
Wenn angesehene <strong>Münchner</strong> Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürger<br />
der Stadt ihren Unmut auf die Straße tragen, ist dies im Rückblick<br />
oft ein gerne gesehenes Zeichen von Demokratiefähigkeit,<br />
die sich auch diejenigen auf die Fahnen schreiben, die<br />
das im entscheidenden Moment noch ganz anders gesehen<br />
haben. Die damit verb<strong>und</strong>ene Vorstellung eines guten <strong>und</strong><br />
erwünschten Protests <strong>und</strong> die Abwertung eines störenden Protests<br />
durch so genannte Störer oder Chaoten verkennt jedoch,<br />
dass Proteste vor allem eines müssen: stören, um auf diese<br />
Weise einen Raum zu schaffen für die Artikulation <strong>und</strong><br />
Demonstration von Kritik. Proteste, die nicht stören, sind wie<br />
Tiger ohne Zähne, sie beißen nicht. ||<br />
ZARA S. PFEIFFER<br />
hat Politikwissenschaften studiert. Sie ist Lehrbeauftragte am<br />
Institut für Soziologie der LMU München sowie am Institut für<br />
Medien der Kunstuniversität Linz <strong>und</strong> arbeitet in der politischen<br />
Bildungs- <strong>und</strong> Öffentlichkeitsarbeit.<br />
Mehr über die Proteste in München findet sich unter<br />
www.protest-muenchen.sub-bavaria.de <strong>und</strong> in dem Buch:<br />
Auf den Barrikaden. Proteste in München seit 1945.<br />
Herausgegeben von Zara S. Pfeiffer im Auftrag des Kulturreferats<br />
der Landshauptstadt München, Volk Verlag, 2011.<br />
Anzeige<br />
PAINTING TO REMEMBER<br />
ZERSTÖRT DEUTSCHE SYNAGOGEN<br />
ALEXANDER DETTMAR<br />
3.2. – 18.3.2012 | Vernissage 2.2., 20.00 Uhr<br />
Infotelefon Pasinger Fabrik: 089 - 829290-13<br />
www.pasinger-fabrik.com