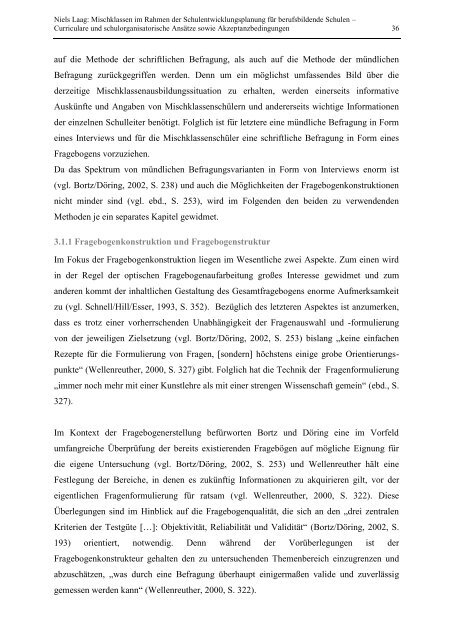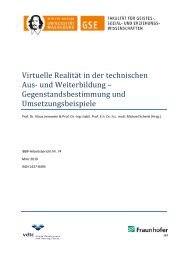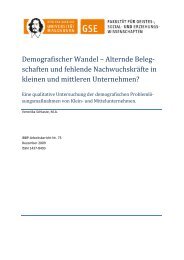Niels Laag - IBBP - Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
Niels Laag - IBBP - Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
Niels Laag - IBBP - Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Niels</strong> <strong>Laag</strong>: Mischklassen im Rahmen der Schulentwicklungsplanung für berufsbildende Schulen –<br />
Curriculare und schulorganisatorische Ansätze sowie Akzeptanzbedingungen 36<br />
auf die Methode der schriftlichen Befragung, als auch auf die Methode der mündlichen<br />
Befragung zurückgegriffen werden. Denn um ein möglichst umfassendes Bild über die<br />
derzeitige Mischklassenausbildungssituation zu erhalten, werden einerseits informative<br />
Auskünfte und Angaben <strong>von</strong> Mischklassenschülern und andererseits wichtige Informationen<br />
der einzelnen Schulleiter benötigt. Folglich ist für letztere eine mündliche Befragung in Form<br />
eines Interviews und für die Mischklassenschüler eine schriftliche Befragung in Form eines<br />
Fragebogens vorzuziehen.<br />
Da das Spektrum <strong>von</strong> mündlichen Befragungsvarianten in Form <strong>von</strong> Interviews enorm ist<br />
(vgl. Bortz/Döring, 2002, S. 238) und auch die Möglichkeiten der Fragebogenkonstruktionen<br />
nicht minder sind (vgl. ebd., S. 253), wird im Folgenden den beiden zu verwendenden<br />
Methoden je ein separates Kapitel gewidmet.<br />
3.1.1 Fragebogenkonstruktion und Fragebogenstruktur<br />
Im Fokus der Fragebogenkonstruktion liegen im Wesentliche zwei Aspekte. Zum einen wird<br />
in der Regel der optischen Fragebogenaufarbeitung großes Interesse gewidmet und zum<br />
anderen kommt der inhaltlichen Gestaltung des Gesamtfragebogens enorme Aufmerksamkeit<br />
zu (vgl. Schnell/Hill/Esser, 1993, S. 352). Bezüglich des letzteren Aspektes ist anzumerken,<br />
dass es trotz einer vorherrschenden Unabhängigkeit der Fragenauswahl und -formulierung<br />
<strong>von</strong> der jeweiligen Zielsetzung (vgl. Bortz/Döring, 2002, S. 253) bislang „keine einfachen<br />
Rezepte für die Formulierung <strong>von</strong> Fragen, [sondern] höchstens einige grobe Orientierungs-<br />
punkte“ (Wellenreuther, 2000, S. 327) gibt. Folglich hat die Technik der Fragenformulierung<br />
„immer noch mehr mit einer Kunstlehre als mit einer strengen Wissenschaft gemein“ (ebd., S.<br />
327).<br />
Im Kontext der Fragebogenerstellung befürworten Bortz und Döring eine im Vorfeld<br />
umfangreiche Überprüfung der bereits existierenden Fragebögen auf mögliche Eignung für<br />
die eigene Untersuchung (vgl. Bortz/Döring, 2002, S. 253) und Wellenreuther hält eine<br />
Festlegung der Bereiche, in denen es zukünftig Informationen zu akquirieren gilt, vor der<br />
eigentlichen Fragenformulierung für ratsam (vgl. Wellenreuther, 2000, S. 322). Diese<br />
Überlegungen sind im Hinblick auf die Fragebogenqualität, die sich an den „drei zentralen<br />
Kriterien der Testgüte […]: Objektivität, Reliabilität und Validität“ (Bortz/Döring, 2002, S.<br />
193) orientiert, notwendig. Denn während der Vorüberlegungen ist der<br />
Fragebogenkonstrukteur gehalten den zu untersuchenden Themenbereich einzugrenzen und<br />
abzuschätzen, „was durch eine Befragung überhaupt einigermaßen valide und zuverlässig<br />
gemessen werden kann“ (Wellenreuther, 2000, S. 322).