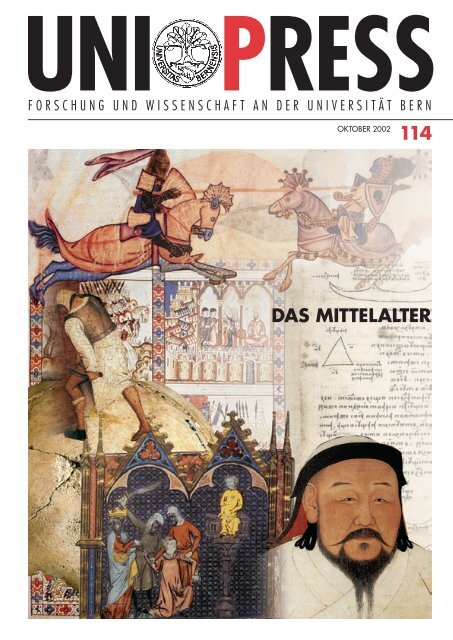114 DAS MITTELALTER - Universität Bern
114 DAS MITTELALTER - Universität Bern
114 DAS MITTELALTER - Universität Bern
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
UNI PRESS<br />
F O R S C H U N G U N D W I S S E N S C H A F T A N D E R U N I V E R S I T Ä T B E R N<br />
OKTOBER 2002<br />
<strong>114</strong><br />
<strong>DAS</strong> <strong>MITTELALTER</strong>
UNI<br />
UNIPRESS<strong>114</strong><br />
PRESS<br />
O K T O B E R 2 0 0 2<br />
Philosophen und Kleriker Seite 5<br />
Das Verhältnis zwischen Philosophie und<br />
Theologie ist schwierig. Andreas Graeser<br />
legt dar, dass der Streit zwischen Philosophen<br />
und Theologen indessen mehrere<br />
Facetten hat.<br />
Wacht auf, wacht auf, es taget! Seite 8<br />
Der Nürnberger Meistersinger Hans Sachs war ab 1523 ein Anhänger<br />
der Reformation. André Schnyder schildert, wie Sachs versuchte,<br />
die Anliegen Martin Luthers dem Volke näher zu bringen.<br />
Slavisches Geistesleben im Mittelalter Seite 12<br />
Zwei Brüder aus Thessaloniki, Kyrill und Method, haben als erste<br />
christliche Schriften aus dem Griechischen ins Slavische übersetzt.<br />
Noch heute verdanken das Russische und das Bulgarische<br />
einen ansehnlichen Teil ihres Wortschatzes dem Wirken solcher<br />
mittelalterlicher Übersetzer, wie Yannis Kakridis aufzeigt.<br />
Was alte Gebeine verraten Seite 14<br />
Skelettfunde verraten, an welchen Krankheiten die Menschen im<br />
Mittelalter litten, in welchem Alter sie starben und wie ihre Nahrung<br />
mehrheitlich beschaffen war. Susi Ulrich-Bochsler zeigt den<br />
Stand der Forschung auf.<br />
Räuber, Gauner und Betrüger im<br />
Spätmittelalter Seite 18<br />
Verbrechen und Gesetzesbrecher üben auf<br />
die meisten Menschen eine hohe Faszination<br />
aus. Oliver Landolt schildert, wie<br />
sich diese Faszination auch in früheren<br />
Zeiten feststellen lässt.<br />
Mit den Stadtläufern<br />
des Spätmittelalters unterwegs Seite 22<br />
Die Anfänge des bernischen Botenwesens reichen bis ins 13. Jahrhundert.<br />
Karin Hübner berichtet, über die wachsende politische<br />
Bedeutung des Stadtstaates und seiner Boten.<br />
Haben Andersgläubige<br />
keine Geschichte? Seite 26<br />
In vielen Kreuzzügen haben christliche Heere versucht, den „Ungläubigen“<br />
das Heilige Land oder Teile Spaniens wieder zu ent-<br />
reissen. Obwohl die Muslime eine hohe Kultur besassen, gibt es<br />
aus jener Zeit kaum christliche Darstellungen ihrer Geschichte.<br />
Rainer Schwinges stellt zwei Ausnahmen vor .<br />
Pax Mongolica Seite 32<br />
Karénina Kollmar-Paulenz beschreibt,<br />
wie das mongolische Weltreich im 13.<br />
und 14. Jahrhundert Europa und Asien<br />
miteinander verband. Die mongolischen<br />
Herrscher ermöglichten kulturellen Austausch<br />
und Handelsbeziehungen.<br />
The principal navigations ... Seite 35<br />
Unter Elisabeth I. stieg England zur grössten Seemacht auf. Eine<br />
erfolgreiche Kolonialpolitik begann, das nationale Selbstbewusstsein<br />
wuchs. Margaret Bridges schildert, wie Gelehrte versuchten,<br />
die Überlegenheit britischen Denkens und Handelns zu begründen.<br />
Thesaurus proverbiorum medii aevi Seite 37<br />
Der Thesaurus Singer, ein Lexikon der Sprichwörter des Mittelalters,<br />
ist ein Unikum, meint Ricarda Liver.<br />
Höfische Liebeskunst als<br />
Gesellschaftsspiel Seite 40<br />
Das waren Kenner, – so meint Hubert Herkommer – die den Vorträgen<br />
der Minnesänger lauschten. Wenn der Kreuzzug den Abschied<br />
von der verehrten Dame forderte, litt der Minneritter Qualen.<br />
Der König als Priester Seite 44<br />
Nicht ganz selbstlos wollte Karl der Grosse<br />
dem Papst eine Prachthandschrift der<br />
Psalmen aus dem Alten Testament schenken.<br />
Adrian Mettauer erklärt die Absicht<br />
dahinter.<br />
Die Basler Galluspforte Seite 47<br />
Die Galluspforte des Basler Münsters ist eines der berühmtesten<br />
romanischen Skulpturwerke der Schweiz. Norberto Grammacini,<br />
Sibylle Walther und Hans-Rudolf Meyer untersuchen, ob<br />
die Pforte ein aus älteren Portalen zusammengestückeltes Flickwerk<br />
ist oder ob sie ein streng theologisch begründetes Kunstwerk<br />
ist.
Finsteres Mittelalter?<br />
4 UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />
Barbarisch und finster nannten<br />
die Geschichtsschreiber<br />
der Renaissance die tausend<br />
Jahre zwischen dem Niedergang<br />
des klassischen Altertums<br />
und ihrer Zeit, die<br />
eine Wiedergeburt der antiken<br />
Kultur mit sich bringen<br />
sollte.<br />
Das 19. Jahrhundert sah diese Epoche mit anderen Augen. Romantische<br />
Vorstellungen von tapferen Rittern und ihren Tournieren,<br />
von höfischem Leben und Minnesang wurden mit dem Mittelalter<br />
verbunden.<br />
Bis in unsere Zeit wirken solche Klischees nach. Bei Mittelalter<br />
denken wir an Pest und den Hundertjährigen Krieg, an<br />
Hungerkatastrophen, welche die Bevölkerung ganzer Landstriche<br />
ausrotteten. Wir bringen das Mittelalter in Zusammenhang<br />
mit rückständiger Frömmigkeit, welche den Blick der Menschen<br />
einschränkte, sind aber beeindruckt von allem, was sich<br />
mit dem mittelalterlichen Rittertum verbindet.<br />
War das Mittelalter barbarisch und rückständig, war es heldenhaft<br />
und romantisch – oder war es vielleicht all dies und noch<br />
manches dazu?<br />
Das Bild, das wir noch oft vermittelt erhalten, stimmt mit den<br />
Erkenntnissen der heutigen Mittelalterforschung kaum überein.<br />
Die moderne Mediävistik bemüht sich um ein differenzierteres<br />
und wissenschaftlich fundiertes Bild der Epoche. In diese Arbeit<br />
einbezogen sind nicht allein die Historiker. Sie betrifft ebenso<br />
Sprach- und Literaturwissenschafter, Theologen, Musikologen,<br />
Kunsthistoriker, Theaterwissenschafter und Philosophen.<br />
Um dieser Vielfalt der Forschung Rechnung zu tragen, sie transdisziplinär<br />
zu verbinden und aus den sich daraus ergebenden Synergien<br />
Nutzen zu ziehen für Lehre, Forschung und Öffentlichkeit,<br />
wurde 1996 das <strong>Bern</strong>er Mittelalterzentrum gegründet. Rund<br />
20 Dozierende aus 13 Instituten gehören dem Forum an, das sich<br />
zum Ziel gesetzt hat, Forschung und Lehre auf dem Gesamtgebiet<br />
der mittelalterlichen Geschichte und Kultur zu fördern und zu koordinieren.<br />
Gemeinsame Lehrveranstaltungen, Forschungsprojekte,<br />
Publikationen, Sprachkurse, Tagungen und Exkursionen<br />
sind Bestandteile der Tätigkeiten des Zentrums. Gastvorträge<br />
von in- und ausländischen Gelehrten ergänzen das Programm.<br />
Einer breiteren Öffentlichkeit ist das <strong>Bern</strong>er Mittelalterzentrum<br />
vor allem durch seine Ringvorlesungen bekannt, die in den vergangenen<br />
Jahren so faszinierende Bereiche wie «Fest und Spiel<br />
im Mittelalter», «Männer, Frauen und die Liebe», «Der Schwarze<br />
Tod» oder «Engel, Teufel und Dämonen» aufgriff und die im Wintersemester<br />
2002/2003 dem Thema «Europa und der Orient» gewidmet<br />
ist (Vgl. Seite 52)<br />
Der Geschäftsführer des Zentrums, Prof. Rainer Schwinges, war<br />
es denn auch, der uns bei der Suche nach Autoren zum vorliegenden<br />
Heft zur Seite stand, so dass wir unseren Lesern und Leserinnen<br />
ein recht buntes Bild des Mittelalters aus verschiedenen<br />
Perspektiven vor Augen führen können.<br />
Bunt sind für einmal auch die Illustrationen. Leider lassen es<br />
unsere finanziellen Möglichkeiten nicht zu, UNI PRESS generell<br />
als vierfarbige Publikation herauszugeben. Mit diesem Heft machen<br />
wir indessen eine Ausnahme, denn eine ganze Anzahl von<br />
Abbildungen war farblich so schön, dass wir es nicht übers Herz<br />
brachten, sie in Graustufen umzuwandeln.<br />
Unsere Leser erwartet damit nicht nur Wissenswertes zu vergangenen<br />
Zeiten, sondern auch manche Augenweide.<br />
Annemarie Etter<br />
UNIPRESS <strong>114</strong>/Oktober 2002<br />
Verantwortliche<br />
Herausgeberin<br />
Stelle für Öffentlichkeitsarbeit<br />
der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong><br />
Prof. Dr. Annemarie Etter<br />
Dr. Beatrice Michel<br />
Fred Geiselmann<br />
Redaktionsadresse<br />
Schlösslistrasse 5, 3008 <strong>Bern</strong><br />
Tel. 031 631 80 44<br />
Fax 031 631 45 62<br />
E-mail: press@press.unibe.ch<br />
http://publicrelations.<br />
unibe.ch/<br />
Layout<br />
Patricia Maragno<br />
Titelbild<br />
Christine Blaser<br />
Erscheinungsweise<br />
4mal jährlich; nächste Nummer<br />
Dezember 2002<br />
Druck und Inserate<br />
Stämpfli AG<br />
Hallerstrasse 7<br />
3012 <strong>Bern</strong><br />
Tel. 031 300 66 66<br />
Tel. 031 300 63 82 (Inserate)<br />
Adressänderungen<br />
Bitte direkt unserer<br />
Vertriebsstelle melden:<br />
«DER BUND»<br />
Vertrieb UNIPRESS<br />
Bubenbergplatz 8<br />
3001 <strong>Bern</strong><br />
Auflage<br />
15 000 Exemplare
Philosophie und Theologie: Ein schwieriges Verhältnis<br />
Philosophen und Kleriker<br />
Attacken auf die Philosophie gehören zum Lateinischen<br />
Mittelalter wie das Salz in der Suppe. Sie gelten gemeinhin<br />
als Symptom einer wissenschaftsfeindlichen Haltung auf<br />
Seiten des Klerus. In der Tat scheinen Exponenten der<br />
Theologie den Einbruch heidnischen Wissens mit<br />
Argusaugen beobachtet zu haben. Doch ist das wohl<br />
nur ein Aspekt. Denn der sprichwörtliche Streit zwischen<br />
Philosophen und Theologen hat mehrere Facetten.<br />
Dabei scheint der Versuch der Philosophen<br />
– hier handelt es sich um die Sachwalter<br />
der aus dem spätantiken Schulsystem<br />
übernommenen ‹Sieben freien Künste›<br />
(artes liberales) – sich aus den Klauen der<br />
Bevormundung durch die theologische Fakultät<br />
zu befreien, nur die Oberfläche anzugehen.<br />
Tiefer und mehr zum Kern der<br />
Sache weist nämlich ein anderes Phänomen;<br />
und dieses zeichnet sich interessanterweise<br />
innerhalb der Theologie ab. Es<br />
betrifft den Umstand, dass die Theologen<br />
(viele von ihnen waren zugleich auch die<br />
führenden Leute in der Philosophie) als<br />
Theologen auf die Sprache der Philosophie<br />
zurückgriffen und hier bald auf gewisse<br />
Grenzen stiessen.<br />
Lange vor den <strong>Universität</strong>sgründungen<br />
im frühen 13. Jahrhundert entbrannten<br />
unter den Theologen Kontroversen über<br />
die Möglichkeiten und Grenzen eines<br />
begrifflichen Verständnisses von Glaubensinhalten.<br />
Diese Kontroversen waren<br />
unausweichlich. Denn in dem Masse, in<br />
dem Glaubensinhalte in der traditionellen<br />
(letztlich von Aristoteles her geprägten)<br />
Begrifflichkeit von Substanz/Attribut bzw.<br />
Akzidens (etwa Ding/Eigenschaft) artikuliert<br />
und kommentiert wurden, machten<br />
sich Spannungen zwischen den verwendeten<br />
Begriffen einerseits und den gemeinten<br />
Sachverhalten andererseits bemerkbar.<br />
Am Anfang<br />
war die Sprachlogik<br />
Diese Spannungen scheinen schon früh auf<br />
und begleiten die mittelalterliche Philosophie<br />
von Anfang an. So hat um 800 Fredegisius<br />
von Tours in seinem Brief Über<br />
das Nichts und die Finsternis an Karl den<br />
Grossen zu bedenken gegeben, dass die<br />
Rede von der Schöpfung aus dem Nichts<br />
korrekterweise dahingehend verstanden<br />
werden müsse, dass sich die Schöpfung<br />
aus etwas vollzogen habe. Als Grund für<br />
dieses Verständnis macht Fredegisius geltend,<br />
dass der Ausdruck ‹Nichts› (nihil)<br />
ein Name sei und mithin für etwas stehe.<br />
Diese Auffassung ist für heutige Begriffe<br />
falsch. Denn ‹nihil› ist sicher keine Name.<br />
Logisch betrachtet dient der Ausdruck<br />
zur Negierung bestimmter Sätze wie ‹Etwas<br />
ist vor der Tür›. Offensichtlich hat<br />
sich Fredegisius wie viele Denker nach<br />
ihm von der Überzeugung täuschen lassen,<br />
dass bedeutungshafte Zeichen ipso<br />
facto für etwas stehen, von dem sie ihre<br />
Bedeutung her beziehen. Dieses vielleicht<br />
früheste Dokument aufkeimenden Denkens<br />
in Karolingischer Zeit zeigt zugleich,<br />
Abb. 1: Die sieben Artes Liberales<br />
(durch Frauen dargestellt)<br />
ziehen bzw. schieben einen Wagen,<br />
auf dem die Sacra Theologia<br />
sitzt (in den Händen das<br />
Haupt Christi); die Frauen werden<br />
von einem geisselschwingenden<br />
Mann angetrieben, der<br />
als Magister Sentenciarum Magister<br />
Petrus Lombardus ausgewiesen<br />
ist. (Kolorierte<br />
Federzeichnung aus dem 15. Jahrhundert,<br />
Unibibliothek Salzburg, M III 36)<br />
dass die Philosophie als Reflexion auf die<br />
sprachlichen Bedingungen unserer Aussagen<br />
Gestalt gewinnt. Sieht man von dem<br />
Iren Scotus Eriugena ab, dem ein wirklich<br />
spekulatives Werk zu verdanken ist,<br />
so scheinen sich die philosophischen Bestrebungen<br />
auf den Versuch begrifflicher<br />
Klärungen beschränkt zu haben.<br />
Ein anderes Beispiel für diesen sozusagen<br />
sprachlogischen Ursprung der mittelalterlichen<br />
Philosophie führt uns in die Zeit<br />
um 1090. Damals hat Roscelin, der Lehrer<br />
des brillanten Dialektikers Abaelard,<br />
in die Diskussion um die Trinität eingegriffen<br />
und geltend gemacht, Vater, Sohn<br />
und Heiliger Geist seien drei von einander<br />
unabhängige (ab invicem separatas)<br />
Personen bzw. Gebilde (Substanzen). Zu<br />
dieser Auffassung gelangte er wohl auf<br />
Grund der Überlegung, dass die gegenteilige<br />
Position problematisch sei: Hätten<br />
wir es mit einer Sache (una res) und mithin<br />
einer Substanz zu tun, so wäre Jesus<br />
Christus als Eigenschaft eben dieser Sache<br />
zu begreifen. Diese Annahme würde aber<br />
die Menschwerdung Gottes unbegreiflich<br />
machen. Denn in diesem Fall müsste<br />
die Eigenschaft einer Sache getrennt von<br />
UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />
5
der Sache vorkommen, deren Eigenschaft<br />
sie ist. Und dies scheint unmöglich. Also<br />
kann dies auch nicht der Sinn der Trinität<br />
sein. – Natürlich machte man auf Seiten<br />
argwöhnischer Theologen geltend, dass<br />
das Wort ‹Substanz› im Falle seiner Anwendung<br />
auf Gott anders verstanden werden<br />
müsse. Aber genau das wäre für philosophisch<br />
inspirierte Theologen natürlich<br />
keine Antwort auf die Frage. Aber warum<br />
rekurrierte man hier auf den Begriff der<br />
Substanz? Vielleicht aus keinem anderen<br />
Grunde als dass man ihn in der Tradition<br />
vorfand und Boethius den Person-Begriff<br />
u. a. durch solche Merkmale wie ‹rationale<br />
Substanz› expliziert hatte.<br />
Das Aristoteles-Verbot<br />
von 1277<br />
Nun ist es wichtig zu sehen, dass die Anwendung<br />
logischer Betrachtungen auf<br />
Glaubensinhalte keineswegs, wie namentlich<br />
spätere Autoren behaupteten, als<br />
Ausdruck unfrommer Gesinnung anzusehen<br />
ist. Ein solcher Vorwurf wurde namentlich<br />
auch Berengar von Tours gegenüber<br />
erhoben. Dieser hatte irgendwann vor<br />
1088 in einer übrigens erst 1770 von Les-<br />
6 UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />
sing aufgefundenen und von Vischer 1834<br />
edierten Schrift Über das Mal des Herrn<br />
die Auffassung vertreten, dass die Umwandlung<br />
«nur» in den Seelen der Gläubigen<br />
vor sich gehe. Zur Begründung dieser<br />
These stellt er auf den Gedanken ab,<br />
dass die sichtbaren Eigenschaften des Brotes<br />
auch nach der Umwandlung erhalten<br />
bleiben. Da aber Eigenschaften nicht unabhängig<br />
vom ihrem Träger existieren können,<br />
habe die Umwandlung nicht wirklich<br />
stattgefunden!<br />
Halten wir diesen Gedanken im Auge, so<br />
verstehen wir auch den Unmut jener Theologen,<br />
die ihre Sache bedroht glaubten. Besonders<br />
massiv wirkte sich dieser Unmut<br />
wieder 1277 aus, als der Pariser Bischof<br />
Tempier 219 Thesen verurteilte. Unter den<br />
in Rede stehenden Thesen finden sich einige<br />
Harmlosigkeiten wie die Behauptung<br />
«Es gibt keine Frage, die vernunftgemäss<br />
zu erörtern ist, die der Philosoph nicht erörtern<br />
und entscheiden dürfte [...]».<br />
Bei dieser These handelt es sich offenbar<br />
um eine kalkulierte Frechheit aus Kreisen<br />
von Phil.-hist. Dozenten, die vom auf-<br />
keimenden Selbstbewusstsein der «Hilfswissenschafter»<br />
zeugt. Doch finden wir<br />
mehrheitlich Thesen, die reichlich abstrakt<br />
anmuten und deren Relevanz vor der Hand<br />
kaum erkennbar sein dürfte. Dazu gehört<br />
eben auch «Zu bewirken, dass eine Eigenschaft<br />
[accidens] ohne Träger [subjectum]<br />
existiert, ist unmöglich, weil es einen Widerspruch<br />
einschliesst», – eine These also,<br />
die als Voraussetzung in den Argumenten<br />
Roscelins, Berengars und anderer philosophische<br />
Arbeit leistete und in der Sache die<br />
theologisch gemeinte Sache unterminierte.<br />
Die These selbst geht zwar auf Aristoteles<br />
zurück, der seinerzeit seinen Lehrer Platon<br />
konfrontierte. Doch ist hier wie übrigens<br />
auch an anderen Stellen Thomas von<br />
Aquin gemeint, der zu seiner Zeit durchaus<br />
als «Progressiver» in Erscheinung trat.<br />
Individualität als<br />
metaphysisches Problem<br />
Man möchte meinen, dass diese und andere<br />
Probleme vermeidbar seien. Sie konstituieren<br />
sich nämlich in und mit einem<br />
bestimmten Rahmen begrifflicher Art.<br />
Tatsächlich ist es nun einmal so, dass wir<br />
in unserer Sprache auf Unterscheidungen<br />
Abb. 2: Das Gemälde zeigt eine Diskussionsrunde über das Mysterium der Dreifaltigkeit, das sich in der Eucharistie manifestiert.<br />
(Raffael: Disputà del Sacramento (1509), päpstliche Gemächer des Vatikans)
wie die zwischen Dingen und ihren Eigenschaften<br />
festgelegt sind. So lässt sich geltend<br />
machen, dass Einzeldinge in unserem<br />
Begriffssystem fundamental sind. Einige<br />
Autoren vertreten näherhin die Auffassung,<br />
dass auch Vorfälle (events) usw. nur<br />
mit Bezug auf jene Einzeldinge identifizierbar<br />
und reidentifizierbar seien, an denen<br />
sie sich vollziehen. Doch besagt das<br />
vielleicht nichts für die ‹wahre› Natur der<br />
Wirklichkeit. Nur war diese skeptische Erwägung<br />
für das Tun der Theologen nicht<br />
attraktiv.<br />
Eine andere Unterscheidung, die innerhalb<br />
des theologischen Diskurses eine grosse<br />
Rolle spielt und buchstäblich massive Arbeit<br />
schultert, ist die zwischen ‹Form› und<br />
‹Materie›. Dieses Begriffspaar wurde seinerzeit<br />
von Aristoteles geprägt und hatte<br />
in seinem Schrifftum (so namentlich in der<br />
Metaphysik-Schrift) die Funktion, Dinge<br />
von der Art geschaffener Substanzen als<br />
komplexe Gebilde begreiflich zu machen.<br />
Zwar blieb unklar, wie das Verhältnis von<br />
Form und Stoff genauer zu denken sei.<br />
Doch handelt es sich bei dieser Orientierung<br />
um eine Betrachtungsweise, die den<br />
mittelalterlichen Denkern grosse Dienste<br />
zu leisten schien. Dies geht vor allem aus<br />
den Texten hervor, in denen immanente<br />
Formen sich als Ausdruck transzendenter<br />
Muster der Schöpfung im göttlichen<br />
Intellekt manifestieren und so die christlich<br />
interpretierte raum-zeitliche Welt ein<br />
Stück weit rational durchschaubar machen.<br />
Insofern schien die Begrifflichkeit<br />
von Form und Materie für die Theologen<br />
unverzichtbar. Nur sie machte es offenbar<br />
möglich, das Wesen der Welt von Grunde<br />
auf zu verstehen.<br />
Näherhin lässt sich mithin auch an jene<br />
Diskussion denken, die sich um die Frage<br />
rankt, was individuelle Dinge eigentlich<br />
zu Individuen macht. Auch diese Frage hat<br />
zwar eine gewisse Tradition. Doch gewinnt<br />
sie im Horizont christlichen Denkens besondere<br />
Relevanz. Denn hier geht es ja um<br />
einen persönlichen Schöpfer-Gott.<br />
Eine Lösungsstrategie – es ist die des Thomas<br />
von Aquin – besagt, dass das, was ein<br />
Individuum ausmacht (principium individuationis),<br />
im stofflichen Bereich anzusiedeln<br />
sei. Hier geht es also um die Vorstellung,<br />
dass etwas von der Art einer<br />
allgemeinen Form von bzw. durch eine<br />
Abb. 3: Gelehrtendisputation.<br />
(Holzschnitt Augsburg, um 1480)<br />
besondere Materie individuiert werde. Die<br />
gegenteilige Strategie verfocht Duns Scotus.<br />
Dieser sprach von einer besonderen,<br />
individuellen Form (‹Diesheit›, haeccitas).<br />
Für heutige Betrachter ist diese Situation<br />
recht aufschlussreich. Denn sie wirft<br />
Licht auf die jeweils leitenden Gottesvorstellungen.<br />
Im einen Fall scheint die Individualität<br />
kreatürlichen Seins mit recht<br />
weltlichen Faktoren verwoben zu sein,<br />
im anderen hingegen scheint es um ideelle<br />
Faktoren zu gehen; und dieser Unterschied<br />
scheint theologisch relevant.<br />
Befund<br />
Doch mag man sich fragen, ob wir hier<br />
nicht mit einer unakzeptablen Alternative<br />
konfrontiert werden. Aus heutiger Sicht<br />
mag das so aussehen. Doch waren die Optionen<br />
der mittelalterlichen Denker hier<br />
vorerst ebenso beschränkt wie die eines<br />
Descartes, der im Spektrum seiner Zwei-<br />
Substanzen-Lehre mit der Alternative von<br />
Denkung (res cogitans) und Ausdehnung<br />
(res extensa) befangen war und vor diesem<br />
Hintergrund z. B. Tiere kaum anders denn<br />
als Automaten verstehen konnte. In dem<br />
Moment, da diese Alternative hinfällig<br />
wurde, eröffneten sich auch neue Möglichkeiten<br />
der Betrachtung. Ähnlich verhalten<br />
sich die Dinge im Falle einer Orientierung,<br />
die an die Begriffe von Form und Materie<br />
gebunden ist. Nur ist letztlich nicht das<br />
Faktum der Bindung interessant, sondern<br />
die Art ihrer Fundierung. Liessen sich die<br />
Autoren der sog. Scholastischen Synthese<br />
im 13. Jahrhundert noch von der Vorstellung<br />
leiten, dass der göttliche Intellekt ein<br />
gutes Stück weit rational verständlich sei,<br />
so haben William von Ockham (1285 bis<br />
1349) und seine Nachfolger diesen Punkt<br />
massiv bestritten. Mit der These von der<br />
Priorität des Willens vor dem Intellekt entfällt<br />
auch die Annahme der Existenz von<br />
Ideen bzw. Universalien als ewigen Mustern<br />
der Schöpfung; und damit schwindet<br />
die Notwendigkeit einer Rückbindung unserer<br />
Begriffe an bestimmte Unterscheidungen<br />
metaphysischer Art, die die Belange<br />
des Glaubens eigentlich nur gefährden<br />
können. Dass heute, im Kontext analytischer<br />
Diskussionen des ontologischen<br />
Status von Kunstwerken einerseits und<br />
Personen andererseits, der Begriff der<br />
Form zumindest verstecktermassen wieder<br />
Interesse gewinnt – so besonders in<br />
Konstititutions- bzw. Verkörperungstheorien<br />
– sei hier nur am Rande erwähnt<br />
Prof. Dr. Andreas Graeser<br />
Institut für Philosophie<br />
Literatur:<br />
• G. R. Evans: Philosophy and Theology in the<br />
Middle Ages, London: Routledge 1993.<br />
• K. Flasch (Hrsg.): Geschichte der Philosophie in<br />
Text und Darstellung: Mittelalter, Stuttgart: Re-<br />
clam 1982.<br />
• Das philosophische Denken im Mittelalter, Stutt-<br />
gart: Reclam 2000.<br />
• Graeser, A.: Interpretationen. Hauptwerke der Phi-<br />
losophie. Antike, Stuttgart: Reclam 1992.<br />
• Positionen der Gegenwartsphilosophie. Vom Prag-<br />
matismus bis zur Postmoderne, München: C. H.<br />
Beck 2002.<br />
• Strawson, P. F. : Individuals. An Essay in Descrip-<br />
tive Metaphysics, London: Methuen 1959.<br />
UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />
7
Glaubenskampf mit einem lyrischen Evergreen<br />
Wacht auf, wacht auf, es taget!<br />
Der Nürnberger Schuhmacher und Schriftsteller Hans Sachs<br />
verfolgt die ab 1517 in Gang kommende Reformation<br />
mit wacher Aufmerksamkeit. Etwa ab 1523 hat er sich entschieden;<br />
von da an steht er auf der Seite des neuen<br />
Glaubens, und er verficht dessen Anliegen in einer Reihe<br />
von Texten. Instinktsicher verwendet er für seine Botschaft<br />
gängige, damit wirkungsvolle literarische Muster; dazu<br />
gehört auch das Tagelied.<br />
Was ist ein Tagelied? Man kennt den Moment<br />
aus Shakespeares Romeo und Julia:<br />
das Paar steht am Ende seiner ersten und<br />
letzten Liebesnacht. Julia setzt mit einer<br />
Frage ein, die auf eine vorangegangene,<br />
aber nicht dargestellte Äusserung, vielleicht<br />
auch nur eine Geste Romeos antwortet:<br />
Willst du schon gehn? Der Tag ist ja noch<br />
fern.<br />
Es war die Nachtigall und nicht die Lerche,<br />
Die eben jetzt dein banges Ohr durchdrang<br />
...<br />
Er widerspricht entschieden, nein es war<br />
die Lerche... Dann tragen die Liebenden<br />
den Meinungsunterschied mit verteilten<br />
Rollen erneut aus. Er erklärt, auf jede Gefahr<br />
hin bleiben zu wollen, denn so habe<br />
Julia es beschlossen. Und sie sieht nunmehr<br />
den Tag heraufdämmern, hört die<br />
Lerche statt der Nachtigall. Da kommt<br />
die ins Vertrauen gezogene Dienerin Julias<br />
herein.<br />
Die Tradition des Tageliedes<br />
Shakespeare hat sich hier eines damals bereits<br />
Jahrhunderte alten lyrischen Grundmusters,<br />
des Tageliedes, bedient. Beschränken<br />
wir uns nicht auf Europa, so<br />
finden wir fast überall auf dem Globus<br />
Beispiele für diese Art der lyrischen Inszenierung.<br />
Im mittelalterlichen Europa<br />
waren es freilich die provenzalischen<br />
Troubadours, die das Paar in erotischer<br />
Lust und in Angst vor dem Entdecktwerden<br />
sein nächtliches Liebesglück und den<br />
Trennungsschmerz bei Tageslicht als erste<br />
besangen; sehr oft gab es übrigens da noch<br />
einen Dritten, den Wächter. Er verkündete<br />
8 UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />
den Morgen, war damit Störenfried, aber<br />
oft auch hilfreicher Komplize (aus ihm ist<br />
bei Shakespeare die warnende Amme geworden).<br />
Die Provenzalen gaben dieser<br />
Liedart mit der Bezeichnung für die Morgenröte,<br />
Alba, einen eingängigen Namen.<br />
Um 1200 kommen die deutschen Minnesänger<br />
auf den Geschmack, und es entstehen<br />
die ersten tageliet. Diese erfreuen sich<br />
im Deutschen einer enormen Beliebtheit;<br />
allein aus dem 13. Jahrhundert sind uns<br />
mehr als 50 Lieder überliefert. Diese Erfolgsgeschichte<br />
geht auch im 14. und 15.<br />
Jahrhundert nach dem Ende des klassischen<br />
Minnesanges weiter, und sie findet<br />
Abb. 1: PostmoderneTageliedsituation<br />
...<br />
(©Gerd Bauer, Nürnberg)<br />
im populären Liedschaffen des 16. Jahrhunderts<br />
eine Fortsetzung. Dabei verstehen<br />
es die Liedermacher, aus dem simplen<br />
Grundmuster mit seiner Dreizahl von<br />
Personen, der klaren Lokalisierung (auf<br />
dem Turm des Wächters und im Schlafzimmer<br />
der Dame) und der beziehungsreichen<br />
Handlungszeit zwischen «Tag<br />
und Traum» das Äusserste herauszuholen.<br />
So konnte man eine Person – etwa<br />
die Dame in ihrem Liebesschmerz – in<br />
den Mittelpunkt rücken; man konnte im<br />
Dialog das Drängen des Wächters angesichts<br />
des rasch heraufkommenden Tages<br />
und das verzweifelte Nichtwahrhabenwollen<br />
der Frau gegeneinander prallen lassen;<br />
man konnte diskutieren, ob es nicht besser<br />
sei, sich einer Zofe statt dem Wächter<br />
anzuvertrauen – immerhin ging es ja<br />
um Tod und Leben; man konnte den Liebhaber<br />
auch tagsüber im Schlafzimmer der<br />
Dame belassen – in der erfreulichen Aussicht<br />
auf die kommende (zweite) Nacht<br />
und zugleich von Angst gepeinigt, ob<br />
er wohl unentdeckt bleiben würde; man<br />
konnte – erotisch vielleicht besonders pikant<br />
– den nächtlichen Liebestaumel nur
als Film im Kopf des einsam und unglücklich<br />
daliegenden Mannes ablaufen lassen;<br />
man konnte auch das Pathos des Liebesschmerzes<br />
parodistisch verkehren, so etwa,<br />
wenn der Mann ohne Dame, dafür in Gegenwart<br />
eines Schwarms von blutgierigen<br />
Flöhen, ungeduldig den Tag erwartet.<br />
Das geistliche Tagelied<br />
Auch hatten schon im späten 13. Jahrhundert<br />
fromm gestimmte Autoren entdeckt,<br />
welche Möglichkeiten diese gerade dank<br />
ihrer Beliebtheit zugkräftige Form für<br />
die Vermittlung religiöser Anliegen haben<br />
konnte. Damit war das geistliche Tagelied<br />
entstanden. Es wendete die verfängliche<br />
erotische Situation mittels der<br />
Allegorie in eine heilsame Lehre; die bekannten<br />
Figuren und Situationen standen<br />
so nicht mehr für sich, sondern bedeuteten<br />
religiöse Sachverhalte: Nicht mehr der<br />
zärtliche Ritter liebkoste seine attraktive<br />
Dame, sondern der heilsvergessene Sünder<br />
lag im Lotterbett der «Frau Welt», das<br />
Dämmern des Tages meinte den Anbruch<br />
des Jüngsten Tages; hinter dem warnenden<br />
Wächter erschien der geistliche Lehrer mit<br />
seinen Mahnungen, oder es war gar Christus<br />
selber, der die Seele zur rechtzeitigen<br />
Umkehr mahnte. In manchen Liedern wird<br />
auch das Paar weggelassen und die Liedsituation<br />
auf Tagesanbruch und Weckruf<br />
des Wächters reduziert: ein Wächterlied.<br />
Durch diese geistliche Umnutzung hatte<br />
sich – dies nebenbei gesagt – die religiöse<br />
Dichtung eigentlich nur das zurückgeholt,<br />
was ihr von vornherein am Tagelied<br />
schon gehörte. Es gibt nämlich gute<br />
Gründe anzunehmen, dass die frühesten<br />
Beispiele der provenzalischen Alba nicht<br />
ohne den Einfluss religiöser Hymnen und<br />
der Bibel denkbar sind.<br />
Hans Sachs hat 1518, als eben etablierter<br />
Meistersänger, noch ganz im alten Glauben<br />
sein erstes geistliches Tagelied gesungen;<br />
darin wollte er mit dieser altbewährten<br />
Formel dem frommen Christen eine<br />
Vermanung zur buß und einprägsame<br />
Warnung vor der Hölle erteilen.<br />
Die Wittenbergisch Nachtigall<br />
Es folgte 1523 das Meisterlied von der<br />
Nachtigall, die das Evangelium des neuen<br />
Glaubens verkündet. Die ganze erste Strophe<br />
entwickelt ein Bild; dieses wird dann<br />
vom Beginn der zweiten an, quasi mit dem<br />
didaktischen Zeigestock – «das Morgenrot<br />
Abb. 2: Die Illustration<br />
setzt den<br />
Text von Sachs in<br />
ein klares, vielleicht<br />
werten -<br />
des Links-Rechts-<br />
Schema um; ortet<br />
man dieses nämlich<br />
– wie etwa<br />
auch bei den<br />
Weltgerichtsdarstellungen<br />
üblich<br />
– nicht vom Betrachter<br />
her, sondern<br />
aus dem Bild<br />
heraus, dann liegt<br />
der neue Tag des<br />
Evangeliums in der<br />
«besseren», d. h.<br />
rechten Hälfte.<br />
(Titelholzschnitt zur Erst-<br />
ausgabe des Spruchge-<br />
dichts ‹Die Wittenbergisch<br />
Nachtigall› 1523)<br />
bedeutet ...» – Zug um Zug erklärt und ausgelegt:<br />
Die tagverkündende Nachtigall ist<br />
doctor Martinus von Wittenwerg, der Tag<br />
verweist auf das Evangelium, die Sonne<br />
ist Christus, der Mond steht dagegen für<br />
den Papst mit seinen selber gemachten<br />
Gesetzen und seinen Ablässen – ein Herrschaftsanspruch,<br />
der nun am Licht des Tages<br />
verblasst. Auf den Papst, namentlich<br />
auf den kurz zuvor verstorbenen Leo X.,<br />
weist auch der gegen die Nachtigall brüllende<br />
Löwe. Daneben erscheinen weitere<br />
Zeitgenossen aus dem katholischen Lager:<br />
Hieronymus Emser als Bock, Johannes<br />
Eck als Wildschwein, Thomas Murner<br />
als Katze und in Hundsgestalt schliesslich<br />
Jakob Lemp. Gleich am Anfang weckt<br />
Sachs mit der Nachtigall und mit dem Tagesanbruch<br />
den Gedanken an ein Tagelied,<br />
stört dann aber nach wenigen Versen diese<br />
Hörererwartung nachhaltig und lässt den<br />
Löwen und all das andere Viehzeug, das<br />
im Tagelied nichts verloren hat, aufmarschieren.<br />
Mehr als das: diese Tiere entfesseln<br />
nun einen Brüllkampf gegen die<br />
Nachtigall; so kommt das Lied als akustisches<br />
Ereignis zu seinem eigentlichen<br />
Recht. Anderseits ist es keine Frage, wem<br />
die Sympathien des Publikums gehören:<br />
der wohlklingenden Nachtigall, nicht ihren<br />
brüllenden, grunzenden, iahenden, bellenden,<br />
blökenden, zischenden Gegnern.<br />
Und der kleine Vogel setzt sich durch! Sie<br />
singet fröleich – ein Wunder, fast so gross<br />
wie jenes, dass dem Mönch aus Wittenberg<br />
mit Bann und Acht nicht beizukommen<br />
war. Nicht zur Fauna des Tagelieds<br />
gehören schliesslich die irrenden Schafe,<br />
die erwacht sint von dem schlaffe. Wer damit<br />
gemeint war, wusste aber jeder, der das<br />
Gleichnis vom guten Hirten kannte.<br />
Mit einem Meisterlied, das nach den Regeln<br />
der Meister nicht gedruckt und publiziert<br />
werden durfte, kann Sachs aber seine<br />
Sache nicht wirkungsvoll vertreten. So<br />
verfasst er einen Text in einfachen Sprechversen<br />
ohne Melodie; er erscheint mit vorangestellter<br />
Prosavorrede 1523. Durch die<br />
Änderung der Form umgeht Sachs nicht<br />
nur das Publikationsverbot, sondern er gewinnt<br />
auch mehr «Sendezeit» für seine Sache,<br />
war doch das Spruchgedicht im Umfang<br />
nicht begrenzt. Schliesslich sind die<br />
Knittelverse, anders als das Lied mit seiner<br />
anspruchsvollen Melodie, auch gut vor-<br />
UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />
9
lesbar – in einer Zeit, da viele, weil sie selber<br />
nicht lesen können, sich vorlesen lassen<br />
müssen, ein weiterer Vorteil. Schliesslich<br />
bot der Druck die zusätzliche Möglichkeit,<br />
die sprachlichen, gleichsam «virtuellen»<br />
Bilder, mit denen das Lied arbeitete,<br />
in ein reales Bild umzusetzen: ein<br />
Holzschnitt eröffnet denn auch die Flugschrift,<br />
die für die «wittenbergisch Nachtigall»<br />
wirbt.<br />
Mit seiner zündenden Idee, das vertraute<br />
Muster des Wächterliedes für die religiöse<br />
Propaganda einzusetzen, hat Sachs Nachahmer<br />
gefunden. So erscheinen vor allem<br />
aus dem protestantischen Lager zahlreiche<br />
Lieder, die Martin Luther als warnenden<br />
Wächter auf dem Turm das Anbrechen des<br />
10 UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />
neuen Glaubenstages verkünden lassen;<br />
keines dieser Gebilde erreicht allerdings<br />
die Prägnanz und Originalität des Vorbildes.<br />
Ganz am Jahrhundertende greift<br />
dann der Pastor Philipp Nicolai neben<br />
Sachs vorbei auf das alte Muster des<br />
geistlichen Tageliedes mit seiner Vorstellung<br />
erotisch gefärbter Gottesnähe<br />
zurück und schafft fern jeder konfessionellen<br />
Kampfstimmung ein Zeugnis<br />
tiefster Glaubenszuversicht und Jenseitssehnsucht:<br />
«Wachet auf, ruft uns die<br />
Stimme» – ein Prachtsstück des evangelischen<br />
Kirchenliedes.<br />
Prof. Dr. André Schnyder<br />
Institut für Germanistik<br />
Das Walt got<br />
Jn der morgenweis Hans Sachsen<br />
Die nachtigal 3 lieder<br />
Wacht auf, wacht auf, es taget!<br />
Ein nachtigal, die waget<br />
ir stim mit suessem hal.<br />
ir thon durchclinget perg vnd thal.<br />
Die morgenrot her zicket.<br />
Der leo sich peclaget;<br />
Wie geren er verjaget<br />
die lieplich nachtigal.<br />
Der liechte man ist worden fal,<br />
Die helle sun her plicket.<br />
Das wilde schwein schreit «waffe»,<br />
Die Nachtigal zw straffe.<br />
Der poch hunt kacz mit im<br />
marren stet dar wider mit grim,<br />
Vnd das schlangen geczichte<br />
Wisplet vnd wider fichte,<br />
Die wolff hewlen al gleich,<br />
Wollen das die nachtigal weich,<br />
Furchten des tages lichte.<br />
Jdoch sie schweiget nichte<br />
Sunder singet fröleich!<br />
Der tag get auf gar frewdenreich.<br />
Secht: die irenden schaffe<br />
Erwacht sint von dem schlaffe<br />
Von der Nachtigal stim.<br />
Des manes schein sie achten nim<br />
Die besprochenen Texte von Sachs liegen käuflich<br />
vor in: Die wittenbergisch Nachtigall. Reforma-<br />
tionsdichtung. von G. H. Seufert, Stuttgart Reclam<br />
1984 u. ö. (RUB 9737); danach der unten orthogra-<br />
pisch vereinfachte Liedtext. Im Verlauf des nächsten<br />
Jahres erscheint vom Verfasser eine mit kommentier-<br />
ten Texten versehene Geschichte des geistlichen Ta-<br />
gelieds in Mittelalter und Neuzeit.<br />
Erwacht, erwacht, es tagt!<br />
Eine Nachtigall lässt<br />
mit süssem Klang ihre Stimme tönen.<br />
Ihr Laut klingt über Berg und Tal.<br />
Die Morgenröte zieht herauf.<br />
Der Löwe knurrt missmutig;<br />
wie gern möchte er<br />
die liebliche Nachtigall verscheuchen.<br />
Der helle Mond ist fahl geworden,<br />
die strahlende Sonne leuchtet herab.<br />
Die Wildsau grunzt: «Vorsicht»,<br />
um die Nachtigall zu massregeln.<br />
Bock, Hund, Katze brüllen mit ihr<br />
andauernd und grimmig,<br />
und das Schlangengezücht<br />
zischt und droht,<br />
die Wölfe heulen im Chor,<br />
sie wollen, dass die Nachtigall weicht,<br />
sie scheuen das Tageslicht.<br />
Aber sie schweigt nicht,<br />
sondern schmettert fröhlich!<br />
Glückverheissend geht der Tag auf.<br />
Schaut: die irrenden Schafe<br />
sind erwacht aus dem Schlaf<br />
durch die Stimme der Nachtigall.<br />
Nicht mehr beachten sie den Mondschein,
Der sie lang hat gedricket.<br />
Die morgenrot deut freye<br />
gesecz vnd propheczeye.<br />
Die sune ist Cristus,<br />
Der tag das Ewangeli sus,<br />
Die nach pedewt die sunde.<br />
Wer die nachtigal seye?<br />
Der vns den tag ausschreye<br />
Jst doctor Martinus<br />
Von wittenwerg Her lutherus!<br />
nun hört was er verkunde:<br />
Jn sunt sey wir geporen,<br />
Von natur kint des zoren<br />
nach inhalt des gesecz,<br />
pis das wort gottes vns zw letz<br />
Das Evangelisch liechte<br />
genad vnd frid versprichte.<br />
Cristus hab vns erlost<br />
Von sunt / dot / deuffel / hele rost.<br />
Solch verheyssung aufrichte<br />
Drawen vnd zwfersichte<br />
Auf Cristum vnsren drost.<br />
Dan wirt vns gottes geist genost,<br />
Dan sey wir awserkoren.<br />
Der man ist finster woren<br />
(Pedewt das pebstlich netz<br />
Seine gepot vnd applas schetz<br />
Jn der schrift vngegrunde).<br />
Von den vns luther seitte,<br />
Das sie zur selikkeitte<br />
Sint weder nutz noch not.<br />
nur der vertraw in Cristi dot<br />
Seliget vns alsamen.<br />
Der leb den Babst pedeitte,<br />
Der cristlich ler verpeitte<br />
pey verdamung: doch hot<br />
Kein mensch gewalt sunder nur got<br />
Den menschen zw ferdamen.<br />
Swein / pock / hunt / kacz: die thire<br />
pedewtten vns die vire:<br />
Eck, emser, lemp, murner.<br />
Kempfen wider die warheit ser.<br />
Das schlangen Zicht ser prande:<br />
pfaffen / munich im lande,<br />
Etlich hochschuel vnd stift,<br />
Das wolff hewllen die pischoff drift.<br />
Disses folck alles sande<br />
Den luther keczer nande,<br />
Wie wol sie in mit schrift<br />
Nie vberwunden han. hie prift<br />
Kein stuck, darin er irre.<br />
Des sint erwachet wire<br />
Durch Ewangelisch ler<br />
Von den menschen gepotten schwer.<br />
got sey mit vns. sprecht amen!<br />
gedicht zw Nurmberg im .1523. jar<br />
der sie lange bedrückt hat.<br />
Die Morgenröte bedeutet<br />
Gesetz und Prophetenverheissung.<br />
Die Sonne ist Christus,<br />
der Tag das Evangelium,<br />
die Nacht bedeutet die Sünde.<br />
Wer aber die Nachtigall sei?<br />
Wer uns den Tag verkündet,<br />
das ist Doktor Martinus<br />
aus Wittenberg, Herr Luther!<br />
Hört jetzt seine Botschaft:<br />
In Sünden sind wir geboren,<br />
von Natur Kinder des Zorns<br />
gemäss dem Gesetz,<br />
bis das Wort Gottes uns zuletzt,<br />
das Licht des Evangeliums,<br />
Gnade und Friede versprechen.<br />
Christus habe uns erlöst<br />
von Sünde, Tod, Teufel, Höllenrost.<br />
Eine solche Verheissung macht<br />
Vertrauen und Zuversicht<br />
auf Christus unseren Tröster.<br />
Dann kommt der Geist Gottes zu uns,<br />
dann sind wir auserwählt.<br />
Der Mond hat sich verdunkelt<br />
(er bedeutet das päpstliche Netz<br />
der Gebote und der Ablässe,<br />
die in der Schrift keinen Grund haben).<br />
Von denen lehrte uns Luther<br />
dass sie zur Seligkeit<br />
weder nützen noch nötig sind.<br />
Nur der Glauben an Christi Tod<br />
macht uns alle selig.<br />
Der Löwe bedeutet den Papst,<br />
der die Glaubenslehre<br />
mit Banndrohung verbreitete: doch hat<br />
kein Mensch, nur Gott Macht,<br />
den Menschen zu verdammen.<br />
Schwein, Bock, Hund, Katze: diese Tiere<br />
stehen uns für diese vier:<br />
Eck, Emser, Lemp und Murner.<br />
Sie bekämpfen heftig die Wahrheit.<br />
Das Schlangengezücht war entbrannt:<br />
die Pfaffen und Mönche im Land,<br />
auch etliche Hochschulen und Stifte,<br />
das Heulen der Wölfe meint die Bischöfe.<br />
Alle diese Leute insgesamt<br />
nannten den Luther einen Ketzer,<br />
obwohl sie ihn mit dem Bibelwort nie<br />
widerlegt hatten. Überzeugt euch hier!<br />
Nichts, worin er irrt.<br />
Darum sind wir erwacht<br />
durch die evangelische Lehre<br />
von den drückenden Geboten der Menschen.<br />
Gott sei mit uns. Sprecht: Amen!<br />
1523 in Nürnberg geschrieben<br />
UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />
11
Zwischen Rom und Byzanz<br />
Slavisches Geistesleben<br />
im Mittelalter<br />
Im Jahr 862 kam eine fremde Gesandtschaft an den<br />
Kaiserhof von Konstantinopel: der mährische Fürst Rastislav<br />
bat, ihn bei der Verbreitung des christlichen Glaubens unter<br />
seinem neugetauften Volk zu unterstützen. Seine<br />
Gesandten sprachen mit demselben näselnden Akzent<br />
wie jene rotblonden Eindringlinge, die noch immer hie und<br />
da die byzantinischen Provinzen unsicher machten. Die<br />
Hofgelehrten wälzten umsonst ihre Bücher: ein solches<br />
Kauderwelsch hatte noch niemand zu schreiben versucht.<br />
Der kaiserliche Rat beschloss, Rastislavs Begehren stattzugeben.<br />
Eine neue Schrift entsteht<br />
Die schwierige Aufgabe, die byzantinische<br />
Mission nach Mähren zu leiten, fiel<br />
zwei Brüdern zu: Konstantin (der später<br />
als Mönch den Namen Kyrill annahm) und<br />
Method. «Denn – so sprach der Kaiser –<br />
ihr kommt beide aus Thessaloniki, und<br />
alle Einwohner dieser Stadt sprechen rein<br />
slavisch». Neben seinen Sprachkenntnissen<br />
brachte Kyrill diplomatische Erfahrungen<br />
und eine solide philologische Bildung<br />
mit. Sie ermöglichte ihm, binnen kürzester<br />
Zeit ein neues Alphabet zu entwerfen<br />
und die Bücher, die man für den christlichen<br />
Gottesdienst brauchte, aus dem Griechischen<br />
ins Slavische zu übersetzen. Den<br />
Zeitgenossen erschien dies als Wunder.<br />
Tatsächlich: bis zur Reformation hat kein<br />
anderes Ereignis das konfessionelle und<br />
kulturelle Antlitz Europas so tief geprägt<br />
wie die Mährenmission. Daran ändert<br />
auch die Tatsache nichts, dass Kyrill und<br />
Methods Wirken in Mähren nur eine kurze<br />
Zeitspanne beschieden war. Ihre Schüler<br />
fanden Zuflucht in Bulgarien, wo das slavische<br />
(oder, wie es meist auf Grund seines<br />
kirchlichen Charakters genannt wird:<br />
kirchenslavische) Schrifttum im 10. Jahrhundert<br />
heimisch wurde. Im kroatischen<br />
Küstenland, im Kiewer Reich, im serbischen<br />
Staat der Nemanjiden und sogar in<br />
den Donaufürstentümern entstanden in der<br />
Folgezeit zahlreiche Zentren, in denen das<br />
Erbe der beiden Brüder aus Thessaloniki<br />
in Tausenden und Abertausenden von<br />
Handschriften weiterlebte. Noch heute ist<br />
12 UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />
jeder Alphabetschütze zwischen Belgrad<br />
und Wladiwostok Schüler eines Schülers<br />
eines Schülers ... von Kyrill und Method.<br />
Arbeit an der Sprache<br />
Einen grossen Teil der kirchenslavischen<br />
Literatur machen Übersetzungen aus dem<br />
Griechischen aus. Dabei hat man sich von<br />
Anfang an nicht nur an die vergleichsweise<br />
einfache Sprache des Neuen Testaments,<br />
sondern auch an die Schriften der<br />
Kirchenväter herangewagt – Texte, die auf<br />
Grund ihrer abstrakten theologischen Begrifflichkeit<br />
und komplexen Syntax sehr<br />
hohe Anforderungen an den Übersetzer<br />
stellen. Übersetzen bedeutet in solchen<br />
Fällen immer zugleich: die Sprache, in<br />
die man übersetzt, schöpferisch weiterentwickeln.<br />
Oft merkt man den kirchenslavischen<br />
Übersetzungen des Mittelalters<br />
nur allzu sehr die Anstrengung an, die sie<br />
gekostet haben. Diese Mühe ist jedoch keineswegs<br />
umsonst gewesen. Viele Wörter,<br />
die damals zum ersten Mal geprägt wurden,<br />
leben in den slavischen Sprachen bis<br />
heute fort. So verdanken das Russische<br />
oder das Bulgarische einen nicht geringen<br />
Teil ihres abstrakten Wortschatzes<br />
der stillen Arbeit anonymer mittelalterlicher<br />
Übersetzer.<br />
Einen Höhepunkt dieser Übersetzungstätigkeit<br />
stellt das 14. Jahrhundert dar. Zu<br />
einer Zeit, in der die osmanische Eroberung<br />
bereits ihre Schatten vorauswirft,<br />
sammeln die südslavischen Völker noch<br />
einmal alle Kräfte, um ihre mittelalterliche<br />
Kultur zu einer letzten, verzweifel-<br />
ten Blüte hochzutreiben. Einige Monate<br />
nach der Schlacht an der Maritza, in<br />
der die Osmanen das serbische Heer vernichtend<br />
geschlagen hatten (1371), vollendete<br />
der Starze Isaija die Übersetzung<br />
Abb. 1: Kyrill und Method – Darstellung aus der Radziwill-Chronik (15. Jahrhundert).
Abb. 2: Eine Seite aus der<br />
Arbeitshandschrift der serbischen<br />
Übersetzer des<br />
14. Jahrhunderts. Man beachte<br />
die Rasur in der vorletzten<br />
Zeile.<br />
der Schriften jenes bedeutenden frühmittelalterlichen<br />
Mystikers, der sich hinter<br />
dem Namen des Apostelschülers Dionysius<br />
Areopagita verbirgt. «Dieses Buch<br />
des Heiligen Dionysius», schreibt Isaija in<br />
seinem Nachwort, «habe ich in guten Zeiten<br />
begonnen ... und in den schlechtesten<br />
aller schlechten Zeiten beendet».<br />
Von Italien nach Byzanz,<br />
von Byzanz nach Serbien<br />
In den Jahren vor der osmanischen Eroberung<br />
des Balkans entstand auch die Übersetzung,<br />
die von <strong>Bern</strong> aus in Zusammenarbeit<br />
mit der Serbischen Nationalbibliothek<br />
in Belgrad ediert wird. Das Original<br />
dieser Übersetzung stammt von<br />
Barlaam von Kalabrien, jenem griechischen<br />
Mönch, der in den 30er-Jahren des<br />
14. Jahrhunderts mit seinem undiplomatischen<br />
Auftreten in den Kreisen der byzantinischen<br />
Kirche für Aufruhr sorgte und<br />
schliesslich – als Ketzer verdammt – zurück<br />
in seine süditalienische Heimat fliehen<br />
musste. Ein Teil von Barlaams Werken<br />
wurde vernichtet, ein anderer ist in<br />
der griechischen Überlieferung nur in<br />
Bruchstücken erhalten. Ihre kirchenslavische<br />
Übersetzung besitzt deshalb nicht<br />
nur für die slavische, sondern auch für die<br />
griechische Geistesgeschichte des 14. Jahr-<br />
hunderts eine hohe dokumentarische Bedeutung.<br />
Hinzu kommt, dass die Arbeitshandschrift<br />
der Übersetzer durch einen<br />
schon fast ans Wunderbare grenzenden<br />
Zufall auf uns gekommen ist: Streichungen<br />
und Zusätze verraten die Schwierigkeiten,<br />
mit denen sie bei ihrer Aufgabe<br />
zu kämpfen hatten, Randbemerkungen<br />
zeugen von ihrem Bemühen, in die anspruchsvollen<br />
Gedankengänge Barlaams<br />
einzudringen. Gewisse Eigentümlichkeiten<br />
der Sprache zeigen schliesslich, dass<br />
die Übersetzung im serbischen Milieu entstanden<br />
sein muss.<br />
Dank seiner Herkunft aus Süditalien beherrschte<br />
Barlaam das Lateinische und<br />
war deshalb in der Lage, die Werke der<br />
scholastischen Theologie im Original zu<br />
studieren; in seinen Schriften polemisiert<br />
er oft mit Thomas von Aquin, den er<br />
auch mehrmals beim Namen nennt. Damit<br />
stiess er freilich in eine für seine serbischen<br />
Übersetzer vollkommen fremde<br />
Geisteswelt vor: «Thomas war zu dieser<br />
Zeit Papst oder irgendein grosser Philosoph»,<br />
kommentierte einer von ihnen die<br />
erste Stelle, an der der Name des grossen<br />
Scholastikers fällt. In manch anderer Hinsicht<br />
zeigen sich die Kommentatoren alledings<br />
sehr belesen – so waren ihnen nicht<br />
nur die logischen Schriften des Aristoteles,<br />
sondern auch die Sage von der lernäischen<br />
Schlange, die Herakles erlegte, und<br />
sogar Pindars Lyrik vertraut.<br />
Ein vergessenes Stück<br />
Mittelalter<br />
Die Übersetzung der Werke Barlaams von<br />
Kalabrien gehört sowohl der Thematik als<br />
auch der Sprache nach in einen Kreis theologischer<br />
Denkmäler, die alle im 14. Jahrhundert<br />
in die serbische Redaktion des<br />
Kirchenslavischen übertragen wurden.<br />
Manche dieser Übersetzungen sind bereits<br />
von der slavistischen Forschung<br />
ediert worden, von anderen ist die Edition<br />
in Vorbereitung, andere wiederum harren<br />
noch immer ihrer Entdeckung und Bearbeitung.<br />
Stück um Stück wird so ein Teil<br />
mittelalterlichen Geisteslebens, das durch<br />
die Wechselfälle der Geschichte Ost- und<br />
Südosteuropas lange Zeit verschüttet blieb,<br />
wieder ans Tageslicht gehoben.<br />
Prof. Dr. Yannis Kakridis<br />
Institut für Slavistik<br />
UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />
13
Die Menschen des Mittelalters im Spiegel der Skelettfunde<br />
Was alte Gebeine verraten<br />
Im Kanton <strong>Bern</strong> wurden in den letzten 25 Jahren an über<br />
80 Fundorten mehrere tausend Gräber geborgen, von<br />
denen die Mehrheit aus dem Mittelalter stammt. Fachleute<br />
können aus dem Zustand der gefundenen Knochen schliessen,<br />
an welchen Krankheiten die Menschen damals litten,<br />
in welchem Alter sie starben und wie ihre Nahrung<br />
mehrheitlich beschaffen war. So nimmt man an, dass die<br />
Verringerung der Körperhöhe, die nach dem Frühmittelalter<br />
bei den damals Verstorbenen festzustellen ist, unter anderem<br />
auf Ernährungsänderungen zurückzuführen ist.<br />
Ein möglicher, aber allgemein weniger bekannter<br />
Weg, den Zugang zum Mittelalter<br />
zu öffnen, führt über die Untersuchung der<br />
knöchernen Überreste der Menschen. Die<br />
anthropologische Bearbeitung dieser biohistorischen<br />
Urkunden erlaubt manche<br />
Aussage, die von keiner anderen Disziplin<br />
erschlossen werden kann. Zu Beginn einer<br />
solchen Analyse gilt es, die Kennzeichen<br />
des einzelnen Menschen in seiner körperlichen<br />
Erscheinungsform, seinen Krankheiten<br />
und Gebresten zu erfassen und<br />
damit ein Guckloch in seine damalige Lebensrealität<br />
zu öffnen. Jede Einzelvita ist<br />
aber auch ein Baustein zur Geschichte der<br />
Bevölkerung, deren Rekonstruktion als<br />
zweiter Untersuchungsschritt folgt.<br />
Woher stammt das Fundgut?<br />
Im Kanton <strong>Bern</strong> besteht eine langjährige<br />
enge Zusammenarbeit zwischen dem<br />
Medizinhistorischen Institut der <strong>Universität</strong><br />
und dem Archäologischen Dienst.<br />
Gemeinsames Ziel ist es, den Menschen<br />
des Mittelalters (und natürlich auch anderer<br />
Zeitepochen) den ihnen zustehenden<br />
Platz zuzuweisen und dabei sowohl<br />
die hellen wie auch die finsteren Seiten<br />
dieser Jahrhunderte zu beleuchten. Bei<br />
den Ausgrabungen in den letzten 25 Jahren<br />
wurden an über 80 Fundorten mehrere<br />
tausend Gräber geborgen, von denen<br />
die Mehrheit aus dem Mittelalter stammt.<br />
Die Arbeit der Anthropologen und Anthropologinnen<br />
beginnt jeweils schon vor<br />
Ort, denn Beobachtungen zur Lage des<br />
Skeletts sind nur auf der Fundstelle möglich.<br />
Zudem bleiben nicht alle Skelette<br />
während ihrer jahrhundertelangen Liegezeit<br />
im Boden gut konserviert. Die Erhal-<br />
14 UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />
tung der Knochen hängt stark von der Bestattungsform<br />
und der Beschaffenheit des<br />
Bodens ab. Will man keine Informationen<br />
verlieren, müssen schlecht erhaltene Knochen<br />
möglichst schon auf der Ausgrabung<br />
untersucht werden.<br />
Ein Blick auf mittelalterliche<br />
Bestattungssitten<br />
Blickt ein Laie auf einen freigelegten mittelalterlichen<br />
Friedhofsteil, mag er die<br />
oft in mehreren Schichten übereinanderliegenden<br />
und sich auch gegenseitig störenden<br />
Skelette als verwirrend empfinden.<br />
Für den mittelalterlichen Menschen war<br />
eine geometrische Ordnung durch das Aneinanderreihen<br />
der Gräber in immer gleichen<br />
Abständen weniger wichtig als das<br />
Umsetzen von Glaubensvorstellungen. Da<br />
nicht jeder Grabplatz als gleich heilsfördernd<br />
galt, hing der Ort des Begräbnisses<br />
oft von Stand und Herkunft des Verstorbenen<br />
ab. Weit verbreitet – für Arme wie<br />
Reiche – war die Orientierung des Körpers<br />
nach Osten. Der verstorbene Christ ruht<br />
im Grab, den Kopf im Westen, den Blick<br />
nach Osten, wo am Jüngsten Tag der Herr<br />
erscheinen soll. Da sich Chor oder Altarhaus<br />
der Kirchen üblicherweise ebenfalls<br />
im Osten befinden, blicken die im Innenraum<br />
der Gotteshäuser begrabenen Gäubigen<br />
gleichzeitig auch zum Altar hin. Was<br />
aber, wenn die Kirche aus städtebaulichen<br />
Gründen nicht nach Osten ausgerichtet<br />
werden konnte wie im Beispiel der Pfarrkirche<br />
des Städtchens Unterseen? War es<br />
in diesem Fall wichtiger, die Gräber nach<br />
Osten oder aber zum Altar hin auszurichten?<br />
Offensichtlich bevorzugte man in einem<br />
früheren Belegungszeitraum die Ostung,<br />
machte aber später eine Wende um<br />
90 o in Richtung Altar. Dadurch entstand<br />
eine Schicht längsgerichteter über einer<br />
Schicht quergerichteter Gräber (Abb. 1).<br />
Kartiert man die Gräber geschlechterspezifisch,<br />
kommt man zu einem Befund, der<br />
einen Aspekt der kleinstädtischen Gesellschaftsstruktur<br />
widerspiegelt: Männer<br />
wurden nicht nur häufiger im privilegier-<br />
Abb. 1: Unterseen – Reformierte Kirche 1985. Gräberplan, auf dem nur die Erwachsenen<br />
eingezeichnet sind. Bei den Quergräbern in der «östlichen» Schiffshälfte wurden bevorzugt<br />
Männer begraben. Da der Herr einst im Osten erscheinen würde, glaubte man, dies<br />
sei die bessere Grablage. Auch bei den Längsgräbern hatten die Männer häufiger die<br />
besseren Grablagen im Nahbereich des Hochaltars. Zeichenerklärung: Schwarz: Mann,<br />
weiss: Frau, schwarz/weiss: geschlechtsunbestimmt. (Zeichnung: Archäologischer Dienst Kanton <strong>Bern</strong>)
ten Innenraum der Kirche begraben, sie<br />
erhielten auch häufiger die guten Grabplätze<br />
in Nähe des Altars (resp. in der östlichsten<br />
Reihe), eine Selektion, die indirekt<br />
die vorrangige Stellung des Mannes<br />
veranschaulicht.<br />
Neben solchen exemplarischen Beispielen<br />
bestehen in der Position der Skelette<br />
in mittelalterlichen Gräberfeldern immer<br />
wieder Abweichungen einzelner Gräber<br />
von der Norm. Manchmal sind sie auf<br />
die Sonderbehandlung bestimmter Menschen<br />
zurückzuführen, manchmal aber<br />
auch auf Unsorgfalt oder – gegenteilig –<br />
auf besondere Sorgfalt beim Bestatten.<br />
Zu den absonderlichen Funden gehören<br />
die hie und da vorkommenden Skelette in<br />
Bauchlage (Abb. 2). Betrifft dies Tote, die<br />
in rechteckigen Sargkisten bestattet wurden,<br />
so könnte man vermuten, der Totengräber<br />
habe oben und unten verwechselt.<br />
Von besonderer Zuwendung erzählt eine<br />
Steinkiste in Biel-Mett. Darin lagen die<br />
Skelette von drei alten Männern, zwei<br />
waren aufgrund ihrer morphologischen<br />
Übereinstimmungen im Skelettbau höchstwahrscheinlich<br />
Zwillinge. Der eine starb<br />
mehrere Jahre später als der andere, wurde<br />
aber trotzdem zu seinem Zwillingsbruder<br />
ins Grab gelegt. Mittelalterliche Friedhöfe<br />
sind äusserst individuell – wohl wie es die<br />
darin begrabenen Menschen auch waren.<br />
Individualschicksale<br />
In der Zeit zwischen dem ausgehenden<br />
Früh- und Hochmittelalter wurde im Gräberfeld<br />
von Oberbüren eine Frau begraben.<br />
Sie hatte ein Alter von 20 bis 25 Jahren<br />
erreicht und war invalidisiert: Wegen ihrer<br />
angeborenen beidseitigen Hüftgelenkverrenkung<br />
(Luxation, Abb. 3) konnte sie<br />
sich nur mit gebeugten Knien und unter<br />
seitlichem Hin- und Herverschieben des<br />
Körperschwerpunktes – sozusagen in seitlichem<br />
Watschelgang – fortbewegen. Ihr<br />
Leiden reflektiert sich sogar noch in der<br />
Skelettlage, denn sie musste mit angezogenen<br />
Knien in die Erde gelegt werden (Abbildung<br />
4). Ein paar Jahrhunderte später,<br />
zwischen der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts<br />
und der Reformation von 1528,<br />
trug man zwei totgeborene Kinder auf<br />
demselben Areal zu Grabe. Ihre Leichname<br />
wurde halb zur Seite gedreht und<br />
mit angezogenen Knien in sogenannter<br />
Embryonallage gleichzeitig der Erde übergeben<br />
(Abb. 5). Betrachtet man die beiden<br />
Abb. 2: Im Gräberfeld von Oberbüren liegt ein Mann atypisch auf dem Bauch. (Foto: HA)<br />
so unterschiedlichen Funde im Kontext der<br />
gesamten mittelalterlichen Bevölkerung,<br />
kommt man zum Schluss, dass sie beide<br />
charakteristische Kennzeichen der damaligen<br />
Sterbestrukturen und Lebensbedingungen<br />
aufweisen.<br />
Vom Individuum<br />
zur Bevölkerung<br />
Der Tod im jungen Erwachsenenalter<br />
traf zwar manchmal auch Männer, häufiger<br />
aber Frauen wie im obigen Beispiel.<br />
Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett<br />
waren kritische Lebensphasen, die<br />
bei bestehenden körperlichen Gebresten<br />
noch verstärkt einen unheilvollen Ausgang<br />
nehmen konnten. Geburt und die<br />
nachfolgenden Tage bargen für die Kinder<br />
ebenfalls ein hohes Sterberisiko. Das<br />
ganze Mittelalter und auch noch die Neuzeit<br />
waren überschattet von einer hohen<br />
Säuglings- und Kleinkindersterblichkeit,<br />
die schätzungsweise nur jedem zweiten<br />
Lebendgeborenen die Chance liessen, das<br />
Erwachsenenalter zu erreichen. Starb ein<br />
Kind vor der Geburt ungetauft oder kam<br />
es schon tot zur Welt, war es als «Heide»<br />
nicht nur des Diesseits-, sondern zusätzlich<br />
auch eines seligen Jenseitsdaseins beraubt.<br />
Es sei denn, die Eltern pilgerten mit<br />
solchen Unglücklichen wie im Beispiel der<br />
beiden Oberbürener Kinder an einen Wallfahrtsort,<br />
wo sie nach angeblicher Wiederbelebung<br />
getauft werden konnten.<br />
Bei Kindern, die das erste kritische Lebensjahr<br />
überstanden hatten, blieb die<br />
Sterbewahrscheinlichkeit ebenfalls hoch.<br />
Viele starben zwischen dem dritten und<br />
sechsten Lebensjahr, häufig wohl an akut<br />
verlaufenden Infektionskrankheiten. Deren<br />
Spuren lassen sich am Knochen leider<br />
nicht ablesen. Bestimmte Mangelerkrankungen<br />
oder länger andauernde Krank-<br />
Abb. 3: Hüftgelenksluxation. Die ursprüngliche<br />
Hüftgelenkspfanne ist in seiner Form verändert<br />
(Hundeohrform), der Oberschenkelkopf<br />
ist nach oben gewandert (Markierung<br />
mit Pfeil). Unten im Bild ist der zugehörige<br />
Oberschenkel (links) im Vergleich mit einem<br />
normal ausgebildeten dargestellt. (Fotos: HA)<br />
UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />
15
heitsprozesse können wir jedoch erfassen.<br />
Nach unseren Befunden – etwa zu Unterseen<br />
– hatte ein grosser Teil der Kinder,<br />
nicht selten mehrmals hintereinander, solche<br />
Stressphasen erfahren. Erst bei den<br />
über siebenjährigen Kindern sank die<br />
Sterblichkeit. Das Jugendalter war ebenfalls<br />
risikoärmer.<br />
Unterschiede im Lebensumfeld<br />
Zwischen den einzelnen Dorfbevölkerungen<br />
innerhalb des Kantons wie auch zwischen<br />
verschiedenen Sozialgruppen gibt<br />
es demographische Unterschiede, die das<br />
unterschiedliche Lebensumfeld beleuchten.<br />
Eine besondere Sterbestruktur wiesen<br />
beispielsweise die Cluniazensermönche<br />
auf, die im Mittelalter im Kloster<br />
auf der St. Petersinsel gelebt hatten. Einige<br />
starben zwar ebenfalls im jungen Erwachsenenalter;<br />
überdurchschnittlich viele<br />
Sterbefälle ereigneten sich jedoch bei den<br />
über Sechzigjährigen. Ein 20-jähriger<br />
Mönch durfte mit einer Lebenserwartung<br />
von noch 34 Jahren rechnen, die Lebenserwartung<br />
dieser Ordensleute lag mehrere<br />
Jahre über derjenigen der Normalbevölkerung.<br />
In welchem Umfang wirkten sich mangelhafte<br />
Ernährung und Krankheiten nicht<br />
nur auf die Lebensdauer, sondern auch auf<br />
die Lebensqualität einschränkend aus? Für<br />
Einzelschicksale meint man diese Frage<br />
aus heutiger Sicht abschätzen zu können;<br />
aber war dies auch die Sicht des Mittelaltermenschen?<br />
Die junge Frau von Oberbüren<br />
war schwer gehbehindert und hatte im<br />
ländlichen Alltag mit diversen Einschränkungen<br />
bei Arbeit und Mobilität zu leben.<br />
Wie sie dies selber empfand, können wir<br />
nicht beantworten. Ebenso schwierig ist<br />
es, das individuelle Schmerzempfinden<br />
abzuschätzen, selbst in Fällen, wo ausgedehnte<br />
pathologische Knochenveränderungen<br />
vorliegen.<br />
Zahlreiche Gebresten<br />
Neben einzelnen schweren Krankheitsbildern<br />
war der mittelalterliche Mensch von<br />
mancherlei alltäglichen Gebresten betroffen.<br />
Knochenbrüche konnten bei der<br />
normalen Haus-, Feld- oder Waldarbeit<br />
passieren. Besonders häufig kommen Unterarmfrakturen<br />
durch Sturz vor. Rippen,<br />
Schlüsselbein- und Unterschenkelbrüche<br />
sind ebenfalls nicht selten. Die im höheren<br />
Lebensalter eintretende Knochensub-<br />
16 UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />
stanzverminderung führten auch damals<br />
öfters zu Frakturen des Oberschenkels.<br />
Gelegentlich findet man ein Verletzungsmuster<br />
mit Brüchen an verschiedenen<br />
Skeletteilen, die auf schwerere Unfälle<br />
schliessen lassen.<br />
Zu den verbreitetsten Leiden des mittelalterlichen<br />
Menschen zählten die Zahnerkrankungen.<br />
Zahnfäulnis, in moderner<br />
Zeit und bis vor kurzem ein Volksleiden,<br />
trat zwar hauptsächlich infolge der weniger<br />
kariogenen Nahrung in geringeren<br />
Prozentsätzen auf. Da aber kaum Zahnpflege<br />
betrieben wurde, entstanden andere<br />
Probleme. Aus den Zahnsteinbelägen und<br />
der öfters starken Abkauung der Zahnkronen<br />
resultierten Zahnbettschwund, Cysten<br />
und Granulome oder «Eiterzähne». Erkrankungen<br />
im Mundbereich konnten bis<br />
zum Tode führen.<br />
Bei älteren Menschen litt fast jeder unter<br />
Schäden an der Wirbelsäule oder an den<br />
Gelenken, verursacht durch starke körperliche<br />
Belastung im Kindes- und Jugendalter<br />
und/oder durch Über- und Fehlbelastung<br />
im Erwachsenenalter. Im Mittelalter<br />
dürfte ein Grossteil der über 40-jährigen<br />
Männer und Frauen durch ihre chronisch<br />
gewordenen Gebresten zu beschränkter<br />
Tauglichkeit, oft zu Untauglichkeit für die<br />
angestammte Arbeit geführt haben, deren<br />
Konsequenz in einer Abhängigkeit von<br />
fremder Hilfe lag.<br />
Pest, Lepra und Syphilis<br />
Ein anderes Kapitel der Kranken im Mittelalter<br />
betrifft die «grossen» Seuchen.<br />
Laut Geschichtsquellen waren Pest, Lepra<br />
und im ausgehenden Mittelalter auch<br />
die Syphilis kennzeichnend für diese Zeitepoche.<br />
Anhand der Knochenfunde lässt<br />
sich aus verschiedenen Gründen noch<br />
keine historische Epidemiologie erstellen:<br />
Die Pest manifestiert sich makroskopisch<br />
nicht, kann aber seit kurzem molekularbiologisch<br />
erfasst werden. Lepra ist am<br />
Skelett im späteren Stadium gut erkennbar.<br />
Da die Leprösen jedoch aus der Gesellschaft<br />
ausgeschlossen und in den Siechenhäusern<br />
untergebracht und auch auf eigenen<br />
Bestattungsplätzen begraben wurden,<br />
finden wir sie – von ganz wenigen Ausnahmen<br />
abgesehen – auf den Dorffriedhöfen<br />
nicht. Syphilis äussert sich im tertiären<br />
Stadium ebenfalls mit ossären Folgen<br />
(Abb. 6). Für das Mittelalter und den Kan-<br />
Abb. 4: Wegen des angeborenen beidseitigen<br />
Hüftgelenksleidens konnte die junge<br />
Frau nur mit angezogenen Knien ins Grab<br />
gelegt werden. (Foto: HA)<br />
Abb. 5: Oberbüren Gräber Nr. 290 und<br />
297. Zwei neugeborene Kinder, die tot zur<br />
Welt gekommen waren und die man am<br />
Wallfahrtsort von Oberbüren wieder zum<br />
Leben zu erwecken versuchte, um sie taufen<br />
zu können. (Zeichnung: D. Rüttimann, HA)
ton <strong>Bern</strong> liegen erst wenige Funde von Syphiliskranken<br />
vor. Sie sind kleine Puzzlesteine<br />
zur Geschichte dieser Krankheit,<br />
über die nach wie vor eine Kontroverse<br />
herrscht zur Frage nach ihrer Verschleppung<br />
aus der Neuen Welt nach Europa<br />
durch die Seefahrer um Kolumbus.<br />
Unterschiede<br />
in der Körpergrösse<br />
Neben Krankheiten und demographischen<br />
Strukturen kann aus alten Knochen auch<br />
auf den Körperbau des mittelalterlichen<br />
Menschen geschlossen werden. Turnier-<br />
und Kriegsrüstungen, wie wir sie heute in<br />
Sammlungen und Museen bestaunen (und<br />
vermessen) können, lassen das Bild von<br />
schmächtigen Männern entstehen. Waren<br />
die mittelalterlichen Menschen tatsächlich<br />
klein und grazil?<br />
Unsere Daten weisen auf regionale wie<br />
auch soziale Unterschiede hin. Gegenüber<br />
den frühmittelalterlichen germanischen<br />
Bewohnern unseres Gebietes, die<br />
eine beachtliche Körperhöhe von 170<br />
bis 175 cm (Durchschnitt für die Männer<br />
verschiedener Orte) aufwiesen, waren<br />
die Menschen der späteren Jahrhunderte<br />
mit Durchschnittswerten zwischen<br />
168 und 170 cm tatsächlich etwas kleiner,<br />
aber nicht selten kräftig gebaut.<br />
Was die Grösse der Rüstungen anbetrifft,<br />
so steckten darin wohl nicht nur Erwachsene,<br />
sondern auch Halbwüchsige. Die<br />
nach dem Frühmittelalter eingetretene Reduktion<br />
der Körperhöhe wird neben anderen<br />
Faktoren auf Umwelteinflüsse, vor<br />
allem auf Ernährungsänderungen zurückgeführt.<br />
Die Verlagerung von der frühmittelalterlichen<br />
Milch- und Viehwirtschaft<br />
zu vermehrtem Ackerbau führte zu einem<br />
höheren Getreideanteil der Kost respektive<br />
zum Rückgang an hochwertigen tierischen<br />
Eiweissen. Setzt sich der Speisezettel nicht<br />
nur aus Mus und Brei zusammen, sondern<br />
ist darin viel Fleisch enthalten, wirkt sich<br />
dies positiv auf die Körperhöhe aus. Ein<br />
weiterer die Körperhöhe senkender Faktor<br />
ist eine starke körperliche Belastung<br />
im Kindesalter.<br />
Mit der Verminderung der Körperhöhe<br />
ging ein weiteres Phänomen einher, das<br />
der Schädelverrundung. Es führte zum typischen<br />
Rundschädel des Mittelalters. Die<br />
Ursachen dieser Formveränderung sind<br />
noch immer nicht völlig geklärt. Diskutiert<br />
werden genetische und gesellschaftliche<br />
Vermischungsvorgänge, Siebung,<br />
Klimaveränderungen und wiederum Änderungen<br />
in den Ernährungs- und Arbeitsbedingungen.<br />
Mit diesen Puzzlesteinchen<br />
lässt sich noch kein vollständiges Bild des<br />
Abb. 6: Mittelalterlicher Schädel aus Nidau. Im Stirnbein sind löchrige Veränderungen<br />
(Caries sicca) ausgebildet, die zusammen mit den Veränderungen an anderen Skelettteilen<br />
auf Syphilis hinweisen. (Foto: HA)<br />
mittelalterlichen Menschen zeichnen, aber<br />
jeder neue Skelettfund ist für uns eine Herausforderung,<br />
eine weitere kleine Lücke<br />
zu schliessen.<br />
Dr. phil.-nat. Susi Ulrich-Bochsler<br />
Historische Anthropologie<br />
Medizinhistorisches Institut<br />
Literatur:<br />
• Eggenberger Peter, Ulrich-Bochsler Susi: Unter-<br />
seen. Die reformierte Pfarrkirche, 2001.<br />
• Gutscher Daniel, Ueltschi Alexander, Ulrich-<br />
Bochsler Susi: Die St. Petersinsel im Bielersee –<br />
ehemaliges Cluniazenser-Priorat, 1997.<br />
• Lanz Christian: Ein möglicher Fall von tertiärer<br />
Syphilis aus dem Spätmittelalter, Diss. 1997.<br />
• Ulrich-Bochsler Susi: Vom «enfant sans âme» zum<br />
«enfant du ciel», Unipress Nr. 92, 1997.<br />
• Ulrich-Bochsler Susi: Anthropologische Befunde<br />
zur Stellung von Frau und Kind in Mittelalter und<br />
Neuzeit. Soziobiologische und soziokulturelle As-<br />
pekte im Lichte von Archäologie, Geschichte, Volks-<br />
kunde und Medizingeschichte, 1997.<br />
• Wurm Helmut: Die Körperhöhe deutscher Har-<br />
nischträger, Z. Morph. Anthrop. 75, 1985.<br />
UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />
17
Zwischen Abenteuerlust und Henkershand<br />
Räuber, Gauner und Betrüger<br />
im Spätmittelalter<br />
Ein Blick in den täglichen Boulevardjournalismus genügt,<br />
um uns zu zeigen, welche Faszination von Verbrechen und<br />
Gesetzesbrechern für die heutigen Zeitgenossen ausgeht.<br />
Bestätigt wird dieser Eindruck durch die grosse Popularität<br />
von Kriminalromanen wie auch von Kriminalfilmen.<br />
Diese Faszination am Verbrechen lässt sich aber auch in<br />
früheren Zeiten feststellen.<br />
Schon spätmittelalterliche und frühneuzeitliche<br />
Chronisten berichten von Straftaten<br />
und Straftätern, wobei besonders<br />
spektakuläre Verbrechen wiederholt das<br />
Interesse der zeitgenössischen Geschichtsschreiber<br />
weckte: Beispielsweise erzählt<br />
der bekannte Luzerner Diebold Schilling<br />
in seiner Bilderchronik den verabscheuungswürdigen<br />
Mord eines gewissen Hans<br />
Spiess an seiner Ehefrau, die er in ihrem<br />
Ehebett erwürgt hatte. Unter der Folter<br />
blieb der des Mordes verdächtigte Spiess<br />
standhaft, so dass das Gericht als einzige<br />
Möglichkeit zur Überführung des Täters<br />
das mittelalterliche Rechtsinstrument der<br />
sogenannten Bahrprobe sah.<br />
Dabei wurde die des Mordes beschuldigte<br />
Person an die Leiche der ermordeten Person<br />
geführt: Wenn die Leiche wieder zu<br />
bluten anfing, war der Täter überführt. Genau<br />
dies geschah bei der Gegenüberstellung<br />
des Hans Spiess mit seiner durch ihn<br />
ermordeten Ehefrau, welche nach zwanzig<br />
Tagen wieder aus ihrem Grab exhumiert<br />
worden war. Für seine Tat wurde Hans<br />
Spiess schliesslich zum Tod auf dem Rad<br />
verurteilt.<br />
Besonders spektakuläre Betrugsfälle fanden<br />
ebenfalls immer wieder Eingang in<br />
die spätmittelalterliche Chronistik: Sowohl<br />
Zürcher wie Konstanzer Chroniken<br />
berichten für die 1420er-Jahre von der Tätigkeit<br />
eines Franzosen namens Tschan (=<br />
Jean) in dieser Region, welcher sich verschiedener<br />
alchemistischer Künste rühmte<br />
und vorgab, aus Blei Silber und aus Kupfer<br />
Gold herstellen zu können. Einquartiert im<br />
Hause des vermögenden und einflussrei-<br />
18 UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />
chen Zürcher Ratsherren Peter Oeri führte<br />
Tschan aller Welt seine Künste vor. Bald<br />
darauf verliess Tschan Zürich und ging<br />
nach Schaffhausen, um dort seine Karriere<br />
fortzusetzen. Auch in dieser Stadt<br />
fand er in der Person des Schaffhausers<br />
Stadtadeligen Götz Schultheiss von Randenburg<br />
das Vertrauen eines mächtigen<br />
Fürsprechers. Dieser betrieb selber «sollich<br />
aventür», war also ebenfalls in alchemistischen<br />
Künsten bewandert. Tschan<br />
und Götz Schultheiss versuchten sich gemeinsam<br />
in der Goldmacherkunst und gewannen<br />
das Vertrauen zahlreicher Leute.<br />
Selbst der Schaffhauser Rat liess sich von<br />
den Künsten des Tschan überzeugen und<br />
Abb. 1: Mit dem<br />
Aufkommen des<br />
Buchdrucks wurde<br />
auch der Steckbrief<br />
im Laufe des<br />
16. Jahrhunderts<br />
zu einem wichtigenFahndungsinstrument.<br />
«tet ... im große zucht und ere und gab im<br />
groß frighait, wan er verhieß, die statt in<br />
groß richtum ze bringend». Der Ruf von<br />
Tschans Goldmacherkünsten drang bis<br />
nach Konstanz vor, wo er ebenfalls seine<br />
angeblichen Fähigkeiten vor versammelter<br />
Menge vorführte. Auch der hegauische<br />
Ritteradel gewann zum Alchemisten ein<br />
besonderes Vertrauen; gemäss einem Konstanzer<br />
Chronisten gab einer dieser Adligen,<br />
Ritter Heinrich von Randegg, Tschan<br />
sogar seine Tochter zur Frau.<br />
Nachdem Tschan seine alchemistischen<br />
Künste eine Weile lang getrieben und<br />
grosse Vermögenswerte geliehen hatte,<br />
«do wolt er gewichen sin»; die Flucht<br />
misslang indessen und er wurde auf einer<br />
Ritterburg im Hegau gefangengehalten.<br />
Von dort gelang ihm neuerdings die<br />
Flucht, worauf die Ritter ihm nacheilten<br />
und ihn vor den Toren Schaffhausens erschlugen.<br />
Erst jetzt wurden die Betrügereien<br />
des französischen Alchemisten vollständig<br />
aufgedeckt «und kament die lüt in<br />
großen kumer und schaden, die das ir uff<br />
in gelait hatten».
London<br />
Meddelburg<br />
Brügge<br />
Paris<br />
Utrecht<br />
Venlo<br />
Juden unter Verdacht<br />
Noch ein viel grösseres Interesse fanden<br />
die Fabelgeschichten um die angeblich<br />
durch Juden begangenen Verbrechen wie<br />
Brunnenvergiftungen, Hostienfreveleien<br />
oder Ritualmorde; häufig führten solche<br />
absurden Verdächtigungen zu mehr oder<br />
weniger umfangreichen Judenverfolgungen.<br />
Auch das im Laufe des 15. Jahrhunderts<br />
durch den Einfluss von Theologen<br />
sich ausbildende Hexereidelikt fand verschiedentlich<br />
Eingang in die spätmittelalterliche<br />
Chronistik.<br />
Mit dem seit der Mitte des 16. Jahrhunderts<br />
aufkommenden Buchdruck gewannen Geschichten<br />
von Mördern und Räubern, Gaunern<br />
und Betrügern eine besondere Popularität:<br />
Vor allem seit dem 16. Jahrhundert<br />
fand ein solcher «Sensationsjournalismus»<br />
in der Form des Flugblattes einen reissenden<br />
Absatz unter einem Publikum, welches<br />
sich schaudernd-fasziniert an solchen<br />
Nachrichten ergötzte.<br />
Im Gegensatz zu der durch Dichter und<br />
andere Kunstschaffende vermittelten Räuberromantik<br />
des 18. und 19. Jahrhunderts,<br />
welche das freie und angeblich abenteuerreiche<br />
Leben von Räubern und anderen<br />
Kriminellen glorifizierten, lässt sich eine<br />
Idealisierung solcher Existenzen im Spätmittelalter<br />
nicht feststellen, obwohl immerhin<br />
gewisse Ansätze dazu vorhanden<br />
waren. Erwähnt werden können hier die<br />
Nijmwegen<br />
Bergen op Zoom<br />
Köln<br />
Schaffhausen<br />
Strassburg<br />
Abb. 2: Tatorte und Itinerar des 1483 in Schaffhausen hingerichteten Hans Ru o st.<br />
im englischen Sprachraum im Laufe des<br />
Spätmittelalters entstehenden Geschichten<br />
über den in den Wäldern lebenden «good<br />
outlaw» Robin Hood, der sich für Unterdrückte<br />
und Arme einsetzte. Im deutschsprachigen<br />
Raum kann die Figur des Till<br />
Eulenspiegel genannt werden, der mittels<br />
mehr oder weniger krimineller Taten<br />
seinen Lebensunterhalt verdiente. Während<br />
diese Geschichten mehr oder weniger<br />
reine Phantasieprodukte dichterischen<br />
Ursprungs waren, verarbeitete der<br />
dem französischen Sprachraum angehörende<br />
François Villon in der Mitte des<br />
15. Jahrhunderts sein eigenes, kriminelle<br />
Bahnen einschlagendes Leben in literarischer<br />
Weise.<br />
Das «reale Leben»<br />
spätmittelalterlicher Krimineller<br />
Das Alltagsleben von spätmittelalter-<br />
lichen Delinquenten wird vor allem in<br />
den aus verschiedenen Städten überlieferten<br />
Verhör- und Geständnisprotokolle dokumentiert.<br />
Allerdings stellt sich bei dieser<br />
Quellengattung die Frage, inwiefern<br />
diese Gerichtsprotokolle angesicht der<br />
Tatsache, dass die Aussagen der Angeschuldigten<br />
häufig unter der Anwendung<br />
von Folter zustandegekommen waren, der<br />
Realität entsprechen und die gestandenen<br />
Taten tatsächlich durch die beschuldigten<br />
Personen begangen worden waren. Selbst<br />
die Zeitgenossen waren gegenüber den unter<br />
der Folter erzwungenen Geständnissen<br />
kritisch eingestellt, wie dies im speziellen<br />
auch ein durch den Luzerner Chronisten<br />
Diebold Schilling berichteten Fall zeigt:<br />
Ein gewisser Jakob Kessler wurde in Luzern<br />
aufgegriffen und war dem Rat «verzöugt<br />
und an was geben für ein mörder»;<br />
im badischen Lenzkirch (Schwarzwald)<br />
soll er einen Mord begangen haben. Unter<br />
der Folter gestand Kessler die Tat und<br />
wurde deshalb zum Tod auf dem Rad verurteilt.<br />
Vor seiner Hinrichtung wurde ihm<br />
nochmals die Beichte vor einem Priester<br />
zugestanden; gegenüber diesem beteuerte<br />
er seine Unschuld und gab der Folter die<br />
Schuld für das falsche Geständnis. Dies<br />
hörte einer der Ratsknechte und trug alles<br />
dem Chronisten Diebold Schilling zu,<br />
worauf dieser im letzten Moment intervenierte.<br />
Hierauf machte der Luzerner Rat<br />
Nachforschungen in Lenzkirch, wobei<br />
auskam, dass dort gar niemand ermordet<br />
und der aufgegriffene Jakob Kessler unschuldig<br />
war.<br />
Die Geständnisprotokolle spätmittelalterlicher<br />
Delinquenten offenbaren nicht selten<br />
ein äusserst entbehrungsreiches Leben,<br />
welches einerseits durch Langeweile<br />
und andererseits durch hohe Risiken geprägt<br />
war. Deutlich geht dies etwa aus<br />
einem <strong>Bern</strong>er Verhörprotokoll von 1510<br />
hervor, worin ein gewisser Jakob Trutman,<br />
Pfeifer aus Rottweil, sein Räuberleben<br />
schildert: Das Alltagsleben dieses<br />
Delinquenten bestand vor allem aus dem<br />
langem Warten auf potentielle Opfer und<br />
gelegentlichen Einbrüchen in Häuser; die<br />
Beute blieb häufig gering und setzte sich<br />
zumeist aus Nahrungsmitteln und Kleidungsstücken<br />
zusammen. In nicht wenigen<br />
Fällen gehörten die Delinquenten<br />
der im Laufe des Spätmittelalters immer<br />
grösser werdenden Gruppe der heimatlosen<br />
Vaganten an, welche mehr oder weniger<br />
mittellos von einem Ort zum anderen<br />
ziehend mittels Gelegenheitsarbeiten, Bettelei<br />
und gelegentlicher krimineller Handlungen<br />
ihr Leben auf der Landstrasse zu<br />
fristen suchten.<br />
Zur Mobilität<br />
spätmittelalterlicher Krimineller<br />
Besonders interessant sind die geographischen<br />
Angaben in den Geständnissen,<br />
welche von der bisweilen grossen Mobilität<br />
dieser Delinquenten zeugen; aus vielen<br />
Geständnissen lassen sich aufgrund der<br />
Herkunftsorte der einzelnen Delinquenten<br />
UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />
19
sowie den von ihnen genannten Tatorten<br />
gross- oder kleinräumigere Itinerare (Aufenthaltsortsverzeichnisse)<br />
rekonstruieren<br />
und diese kartographisch abbilden.<br />
Eine besonders grossräumige Mobilität<br />
lässt sich etwa aus dem Geständnisprotokoll<br />
des Anfang Mai 1483 in<br />
Schaffhausen hingerichteten Hans<br />
Ru o st rekonstruieren, dessen Geständnis<br />
uns ein Gaunerleben vorstellt, welches<br />
durch halb Europa führt: Hans Ru o st<br />
stammte aus der niederländischen Stadt<br />
Nijmegen (Abb. 2).<br />
Seine Lehrjahre verbrachte er als Goldschmiedelehrling<br />
in Paris. Bereits hier geriet<br />
er auf die schiefe Bahn; denn er stahl<br />
seinem Meister eine kleinere Geldsumme<br />
und lief dann davon. Er setzte nach England<br />
über, wo er seinen Lebensunterhalt<br />
mit weiteren Diebstählen und Betrügereien<br />
verdiente.<br />
Im Auftrage eines Londoner Kaufmannes<br />
reiste er schliesslich nach Brügge<br />
in Flandern; für diesen sollte er verschiedene<br />
Geldgeschäfte tätigen. Die<br />
dabei eingenommenen Gelder steckte<br />
Ru o st allerdings in seine eigene Tasche. In<br />
Brügge versuchte er sich im betrügerischen<br />
Warenhandel; an dem dabei gewonnenen<br />
Geld konnte er sich allerdings nicht<br />
lange erfreuen, verspielte er es doch schon<br />
bald wieder im seeländischen Middelburg.<br />
Hier versuchte Ru o st sich wenig erfolgreich<br />
im Heringshandel mit England.<br />
Weitere Stationen seiner kriminellen Laufbahn<br />
führten nach Bergen-op-Zoom und<br />
nach Utrecht. Nach kurzem Aufenthalt<br />
in seiner Heimatstadt Nijmegen reiste er<br />
nach Venlo weiter, wo er betrügerische<br />
Devisengeschäfte tätigte. Über Köln gelangte<br />
er nach Strassburg, wo er sich mit<br />
einem Kölner Studenten zu einer Falschspielerbande<br />
zusammenschloss. Nach einem<br />
Streit erstach Ru o st den Studenten ausserhalb<br />
Strassburgs und raubte ihn aus.<br />
Daraufhin gelangte er nach Schaffhausen,<br />
wo er sich im November 1482 als Goldschmied<br />
vereidigen liess und eine dort ansässige<br />
Frau ehelichte. Nicht lange danach<br />
wurde er allerdings als Bigamist entlarvt;<br />
denn wie aus seinem Geständnis hervorgeht,<br />
hatte er auch noch eine Ehefrau in<br />
seiner Heimatstadt Nijmegen. Auch in sei-<br />
20 UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />
nem Goldschmiedehandwerk liess er sich<br />
zu einigen Betrügereien hinreissen, indem<br />
er minderwertiges Edelmetall verarbeitete.<br />
Schliesslich wurde er im Mai 1483 durch<br />
Ertränken im Rhein hingerichtet.<br />
Im grossen und ganzen stellt dieses Itinerar<br />
des Hans Ru o st eine Ausnahme dar: Nur<br />
in den seltensten Fällen bewegten sich Delinquenten<br />
in einem so weiten Gebiet; zumeist<br />
war der durchwanderte Raum dieser<br />
Personen sehr viel kleinräumiger und<br />
enger, wobei sich je nach Delinquententypus<br />
aber unterschiedliche Migrationsmuster<br />
ermitteln lassen: So wanderten<br />
etwa Betrüger, welche vorgaben, besondere<br />
Künste bzw. spezielle berufliche Fähigkeiten<br />
beherrschen zu können, in der<br />
Regel über weitere Distanzen. Ihr Wirkungsbereich<br />
konzentrierte sich häufig auf<br />
grössere und mittelgrosse Städte. Ähnliche,<br />
vor allem auf Städte bezogene Migrationsmuster<br />
weisen die Geständnisse von<br />
auf kriminelle Bahnen geratene Handwerksgesellen<br />
auf.<br />
Neben dieser eher grossräumigen Migration<br />
lassen sich in den Quellen aber auch<br />
viele Beispiele kleinräumiger Mobilität<br />
feststellen, bei denen Delinquenten sich<br />
in einem engen Revier nur über wenige<br />
Kilometer von einer Ortschaft zur an-<br />
Abb. 3: Bettlerfamilie<br />
auf dem Weg<br />
zur Stadt. Titelblatt<br />
der «Liber vagatorum»<br />
(1510).<br />
deren bewegten. Daneben gab es natürlich<br />
auch Delinquenten, zumeist Einheimische,<br />
die im engen städtischen Gebiet<br />
ihr Revier hatten; nicht selten handelte es<br />
sich dabei um Handwerker, welche bei Berufskollegen<br />
Rohmaterialien stahlen, um<br />
diese dann im eigenen Betrieb weiterzuverarbeiten.<br />
Allgemein kann festgestellt<br />
werden, dass selbst Delinquenten, welche<br />
sich über weitere Distanzen fortbewegten,<br />
nur selten die Sprachgrenzen überschritten;<br />
weitaus lieber verblieben sie in Gebieten,<br />
in welchen ihnen Sprache, Sitten und<br />
Gebräuche vertraut waren.<br />
Bandenbildung<br />
im Spätmittelalter<br />
Bereits im Mittelalter kam es zur Bildung<br />
von Verbrecherbanden. Besonders bekannt<br />
ist die aus dem französischen Sprachraum<br />
überregional operierende Bande der Coquillards,<br />
welche mittels Raub und Mord,<br />
Diebstahl und Falschspiel ihren Lebensunterhalt<br />
zu verdienen suchte. Der Zusammenschluss<br />
von Verbrecherbanden gewann<br />
auch im deutschsprachigen Raum eine immer<br />
weitere Verbreitung, wobei dies rein<br />
fiktiv aufgebauscht werden konnte, wie<br />
dies etwa der «Liber Vagotorum» mit der<br />
Vorstellung eines kriminellen «Vagantenordens»<br />
oder «Bettlerordens» (lat. ordo<br />
vagatorum) belegt (Abb. 3).
Abb. 4: Urteil des Hans Müller 1508: « ... das<br />
man denselben Hans Mueller dem nachrichter<br />
bevelchen, der im sine hend zuo rugk<br />
all einem dieb binden und in niden us uff<br />
die gwenliche richtsstatt fueren unnd in mitt<br />
dem strick vom leben zum tod richten und<br />
dem lufft bevelchen sol».<br />
In einem aus dem Ende des 15. oder Anfang<br />
des 16. Jahrhunderts stammenden<br />
<strong>Bern</strong>er Verhörprotokoll werden zwölf<br />
aus dem süddeutschen Raum stammende<br />
Männer erwähnt, welche sich in Zürich im<br />
sogenannten «Kratz», einem berühmt-berüchtigten<br />
Aussenseiterquartier der Limmatstadt,<br />
versammelten und sich zu einer<br />
«rott» zusammenschlossen, um «alle boßheit<br />
und boeße stueck anzefangen, morden,<br />
stelen, roben, und was gelt bringen<br />
moeg». Im Jahre 1527 fahndete der <strong>Bern</strong>er<br />
Rat nach einer Verbrecherbande, welche<br />
sowohl in ihrem bernischen wie auch<br />
im zürcherischen Herrschaftsterrritorium<br />
ihr Unwesen trieb; sie gaben sich als Leprakranke<br />
aus, waren aber laut Geständnis<br />
eines «jungen starcken pettler(s)», der dieser<br />
Bande angehörte, tatsächlich «grosse<br />
Diebe, Ketzer und Mörder».<br />
Nicht wenige dieser Delinquenten, seien<br />
es Bandenmitglieder oder als Einzelgänger<br />
operierende Kriminelle, kamen in die<br />
Mühlen der Justiz. Am Ende einer Krimi-<br />
nellenkarriere stand nicht selten der Galgen,<br />
wie dies auch im Gerichtsurteil des<br />
1508 in <strong>Bern</strong> hingerichteten Dieb Hans<br />
Müller belegt ist (Abb. 4): « ... das man<br />
denselben Hans Mueller dem nachrichter<br />
bevelchen, der im sine hend zuo rugk all<br />
einem dieb binden und in niden us uff die<br />
gwenliche richtstatt fueren unnd in mitt<br />
dem strick vom leben zum tod richten<br />
und dem lufft bevelchen sol».<br />
Dr. Oliver Landolt<br />
Historisches Institut<br />
UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />
21
Mit den <strong>Bern</strong>er Stadtläufern des Spätmittelalters unterwegs<br />
«Uber hoch Berg /<br />
durch finstre Wäld»<br />
Bis ins 13. Jahrhundert zurück reichen die Anfänge des<br />
bernischen Botenwesens. Nachdem <strong>Bern</strong> 1353 der<br />
Eidgenossenschaft beigetreten war und diplomatisch<br />
eine wichtigere Rolle spielte, wuchs die Bedeutung der<br />
louffenden botten. Spätestens ab 1426 trugen die<br />
Läufer eine Amtskleidung in den Stadtfarben rot und<br />
schwarz. Die territoriale Ausdehnung des Stadtstaates sowie<br />
die zahlreichen Konflikte des 15. und frühen 16. Jahrhunderts<br />
führten nochmals zu einer Expansion des <strong>Bern</strong>er<br />
Botenwesens.<br />
In Zeiten der elektronischen Datenübertragung<br />
sind Schlagworte wie Revolution<br />
der Kommunikationskultur heute in aller<br />
Munde. Ob der Faszination der jeweils<br />
neuesten Entwicklung geraten die jeweils<br />
letzten Modelle schnell in Vergessenheit.<br />
Und kaum jemand ist sich bewusst, dass<br />
sich bereits mit dem Entstehen des Botenwesens<br />
im 14. Jahrhundert eine Neuerung<br />
gegeben hat, die für die Zeitgenossen mindestens<br />
so einschneidend gewesen dürfte.<br />
Ich Bin ein berayter pot zu fuess<br />
deshalb ich mich vil leyden muess<br />
Es sey gleych Schnee / Wint oder Regen<br />
So mus ich doch hinaus allwegen<br />
Zu wasser unnd landt überal<br />
Uber hoch Berg und tieffe thal<br />
Durch finstere Wäld / stauden und<br />
hecken<br />
Da mich offt die schnaphannen<br />
schrecken<br />
Und mir als nehmen was ich thu tragen<br />
Und mir die hawt darzu vol schlagen<br />
Im Winter leyd ich grosse kelt<br />
Im herbst mich das ungwitter quelt<br />
Im Summer leyd ich grosse hytz<br />
Da ich mich offt Beym Wirt versitz<br />
Und Leich gar verdien mein lon<br />
So ist er offt vorhyn verthon [...]<br />
Mit diesen schlichten Versen beschreibt<br />
ein laufender Bote im Jahr 1530 auf einem<br />
Nürnberger Flugblatt des Kupferstechers<br />
Hans Guldenmund die dunklen Seiten<br />
seines abenteuerreichen Berufs (Abbildung<br />
1). Schlechte Strassenverhältnisse,<br />
22 UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />
schwierige Witterungsbedingungen, Gefahren<br />
durch Raubüberfälle und Kriege<br />
und nicht zuletzt auch betrügerische Wirte,<br />
die sich an seinem kargen Lohn bereichern<br />
wollen, gehörten zum Alltag. Auch wenn<br />
dieses Flugblatt als Schmähschrift gegen<br />
freischaffende Läufer gedacht war, die<br />
auf dem hart umkämpften, von der Thurn<br />
und Taxi’schen Post beherrschten Informationsmarkt<br />
eine unliebsame Konkurrenz<br />
darstellten, schildert es doch in überhöhter<br />
Form Alltagsprobleme, die jeder spätmittelalterliche<br />
Laufende oder berittene Bote<br />
aus eigener Anschauung kannte. Dies gilt<br />
auch für die <strong>Bern</strong>er Stadtläufer, auf deren<br />
Wirken sich die folgenden Ausführungen<br />
konzentrieren. Seit dem 14. Jahrhundert<br />
beförderten sie den grössten Teil<br />
der mündlichen und schriftlichen Korrespondenz<br />
des obersten Führungsgremiums,<br />
des <strong>Bern</strong>er Rates. Wie jede halbwegs autonome<br />
Stadt war auch das reichsfreie <strong>Bern</strong><br />
um einen regen Nachrichtenaustausch bemüht,<br />
der einerseits der Verwaltung eines<br />
beachtlichen Stadtgebietes galt, andererseits<br />
auch der Kontaktpflege mit anderen<br />
Städten und Ländern der Alten Eidgenossenschaft<br />
sowie ausserhalb dieser Gebiete<br />
gelegenen Mächten des Alten Reiches.<br />
Louffende botten<br />
Die Wurzeln des bernischen Botenwesen<br />
reichen bis ins 13. Jahrhundert zurück.<br />
Bereits im ältesten <strong>Bern</strong>er Stadtrecht, der<br />
Abb. 1: Läufer mit voller<br />
Ausrüstung unter -<br />
wegs: Die Illustration entstammt<br />
einem Flugblatt<br />
des Nürnberger Kupferstechers<br />
Hans Guldenmund<br />
(1530).<br />
(Hans-Dieter Heimann, Zur Visualisie-<br />
rung städtischer Dienstleistungskultur,<br />
S. 28, in «Anzeiger des Germanischen<br />
Nationalmuseums 1993».<br />
©Preussischer Kulturbesitz, Berlin)
Abb. 2 : Eine silberne Basler Botenbüchse<br />
aus dem Jahr 1553. (© Basel, Hist. Museum)<br />
Goldenen Handfeste aus den 1270er-Jahren,<br />
wird ein Amtmann genannt, der mit<br />
der Nachrichtenübermittlung beauftragt<br />
wurde: der städtische Weibel. Auch wenn<br />
er hauptsächlich ordnungsrechtliche Aufgaben<br />
wahrzunehmen hatte, musste er auch<br />
die Entscheidungen des Rates in Stadt und<br />
Landschaft veröffentlichen. Diese Doppelbelastung<br />
der Weibel, Verwalten und Reisen,<br />
führte im 14. Jahrhundert dazu, dass<br />
der Rat das Amt eines städtischen Läufers<br />
schaffen musste. Dies war umso notwendiger,<br />
als <strong>Bern</strong> 1353 der Eidgenossenschaft<br />
beitrat und diplomatisch eine wichtigere<br />
Rolle spielte. Diese neuen Amtleute, die<br />
in der ältesten erhaltenen Stadtrechnung<br />
von 1375 als louffende botten bezeichnet<br />
werden, hatten nun die alleinige Aufgabe,<br />
Nachrichten zu übermitteln. Genaueres<br />
über Tätigkeit berichten jedoch erst<br />
die zahlreicheren Quellen des 15. Jahrhunderts:<br />
Spätestens ab 1426 trugen die Läufer<br />
eine Amtskleidung in den Stadtfarben<br />
rot und schwarz. Die Stadtrechnungen der<br />
1430er-Jahre enthalten erstmals auch Angaben<br />
zu ihrer Ausrüstung. Der Rat hat für<br />
die Boten unter anderem ein Abzeichen<br />
mit dem Stadtwappen anfertigen lassen,<br />
welches die Läufer auf ihren Wegen unter<br />
den Schutz der Stadt stellte: eine rund<br />
handtellergrosse, silberne «Botenbüchse»,<br />
die die Boten gut sichtbar auf ihrem Wams<br />
trugen (Abb. 2). Sie gehörten somit definitiv<br />
zum niederen Amtspersonal der Stadtverwaltung<br />
und waren damit verpflichtet,<br />
an Ostern vor einem Ausschuss des Rates<br />
einen Amtseid zu schwören. Als fest angestellte<br />
Amtspersonen erhielten sie auch<br />
vierteljährlich einen kleinen Lohn ausbezahlt.<br />
Expansionsbewegungen<br />
Die territoriale Ausdehnung des Stadtstaates<br />
<strong>Bern</strong>, die um 1415 nach der Annexion<br />
des Aargaus vorläufig abgeschlossen<br />
war, sowie die zahlreichen Konflikte<br />
des 15. und frühen 16. Jahrhunderts, Alter<br />
Zürichkrieg, Burgunderkriege, Mailänder<br />
Kriege, führten auch zu einer Expansion<br />
des <strong>Bern</strong>er Botenwesens. Aus<br />
den fünf Läufern, die im Jahre 1435 verzeichnet<br />
wurden, waren zu Beginn des<br />
16. Jahrhunderts zehn ständig beanspruchte<br />
Boten geworden. Doch auch zehn Boten<br />
vermochten die Nachrichtenflut, die in<br />
Kriegszeiten beträchtlich anstieg, nicht alleine<br />
zu bewältigen. Deshalb wurden den<br />
Läufern im Jahr 1481 Zupotten genannte<br />
Aushilfsläufer zur Seite gestellt, die sie<br />
in Krisensituationen entlasten sollten. In<br />
Ausnahmefällen wurden zusätzlich vertrauenswürdige,<br />
dem Rat nahestehende<br />
Personen zu Botendiensten herangezogen.<br />
Ihre Zahl konnte bei grossem Bedarf jene<br />
der Boten um ein Vielfaches übersteigen.<br />
So wurden etwa 1516, als die Niederlage<br />
von Marignano der Tagsatzung Grundsatzentscheidungen<br />
erforderte, 60 weitere Bedarfsläufer<br />
engagiert. Viele von ihnen erledigten<br />
nur einen einzigen Botengang. Fast<br />
Abb. 3: Die Botenfigur des <strong>Bern</strong>er Läuferbrunnens.<br />
(Bild: pm)<br />
80 % aller Nachrichten des Rats wurden<br />
nämlich von vereidigten Läufern und Zuboten<br />
übermittelt.<br />
Etablierter Status und<br />
flexibler Einsatz<br />
Die meisten Nachrichten gingen von den<br />
Sitzungen des Kleinen Rates aus, der das<br />
eigentliche Führungsgremium der Stadt<br />
war und sich im Normalfall alle zwei bis<br />
drei Tage versammelte. Anwesend war<br />
auch der Stadtschreiber, der den Schriftverkehr<br />
des Gremiums organisierte. Besonders<br />
in Krisenzeiten, wenn der Rat<br />
jeden Tag zusammensass und Mobilmachungsbefehle<br />
erlassen wurden, musste<br />
die Korrespondenz sehr schnell funktionieren.<br />
Beispielsweise mussten der Höhepunkt<br />
der Burgunder-Krise im Jahre 1473<br />
innert kürzester Zeit 56 Kriegsaufgebote<br />
ausgestellt werden, wofür der damalige<br />
Stadtschreiber Diebold Schilling nach eigenen<br />
Angaben bis tief in die Nacht hinein<br />
arbeiten musste.<br />
Zusammen mit dem jeweils dienstältesten<br />
Läufer war der Stadtschreiber verantwortlich,<br />
dass dringende Aufträge umgehend an<br />
die Läufer verteilt wurden und sich diese<br />
unverzüglich auf den Weg machten. Ausgerüstet<br />
mit Immunität und freies Geleit<br />
garantierender Botenbüchse, mit schwarzroter<br />
Amtstracht und einem Spiess, den sie<br />
auch als Waffe gegen Hunde und Halunken<br />
einsetzen konnten, waren die Läufer<br />
auf Strassen und Wegen unterwegs (Abbildung<br />
3). Die schriftlichen Nachrichten<br />
trugen sie in ein Wachstuch eingewickelt<br />
in einer Ledertasche am Gürtel. Bevor<br />
sie jedoch <strong>Bern</strong> verliessen, mussten sie<br />
sich noch vom städtischen Seckelmeister<br />
(Finanzminister) ihr Weggeld ausbezahlen<br />
lassen. Dieses wurde nach Meilen,<br />
Dringlichkeit und Tageszeit der Reise<br />
berechnet. Ein Läufer, der 1513 tagsüber<br />
nach z. B. Thun reiste, erhielt sechs <strong>Bern</strong>er<br />
Schilling, während er bei einem Nachtlauf<br />
Anspruch auf die doppelte Summe<br />
hatte. Die Verdoppelung der Geldsumme<br />
muss vor allem als Gefahrenzulage verstanden<br />
werden. Solches galt auch für entfernte<br />
Zielorte, wie etwa Basel, Lyon oder<br />
Mailand. Die meisten Boten werden schon<br />
vor ihrer Wahl zum städtischen Amtmann<br />
mit den wichtigsten Wegen rund um <strong>Bern</strong><br />
vertraut gewesen sein. Kenntnisse über die<br />
schnellsten Strassenverbindungen zu entfernteren<br />
Orten wie Luzern, Zürich oder<br />
UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />
23
Genf erwarben sie sich wahrscheinlich erst<br />
dadurch, dass sie ihre dienstälteren Kollegen<br />
zuweilen begleiteten.<br />
250 verschiedene Zielorte<br />
Die Raumkenntnisse der <strong>Bern</strong>er Läufer<br />
waren beeindruckend, wenn man bedenkt,<br />
dass die 64 zwischen 1375 und 1527 erhaltenen<br />
Stadtrechnungen rund 250 verschiedene<br />
Ortsnamen enthalten. Darunter nicht<br />
nur Dörfer oder Weiler der eigenen Landschaft,<br />
sondern auch weit entfernte Städte<br />
wie Innsbruck, Frankfurt am Main oder<br />
Rom. Allerdings lag das Schwergewicht<br />
der Botengänge auf dem eigenen Territorium,<br />
woraus sich schliessen lässt, dass<br />
die Läufer vor allem bei der Durchsetzung<br />
des <strong>Bern</strong>ischen Staatswillens eine<br />
wichtige Rolle gespielt haben. Das zweitwichtigste<br />
Zielgebiet der Nachrichten des<br />
<strong>Bern</strong>er Rates war der Einflussbereich der<br />
Alten Eidgenossenschaft, allen voran die<br />
Städte Fribourg und Solothurn, deren<br />
wechselhafte nachbarliche Beziehung zur<br />
Aarestadt die Kommunikation seit dem<br />
14. Jahrhundert mit geprägt hat. Aber auch<br />
die Städte Luzern, Baden oder Zürich, wo<br />
sich die Tagsatzung besonders häufig versammelte,<br />
war überdurchschnittlich häufig<br />
Zielort von <strong>Bern</strong>er Boten.<br />
Eine besondere Rolle spielte Basel, das<br />
nicht nur Finanzplatz und wichtiger Warenabsatzmarkt<br />
für <strong>Bern</strong>er Lederfabrikate<br />
war, sondern auch eines der bedeutendsten<br />
spätmittelalterlichen Nachrichtenzentren<br />
des oberdeutschen Raumes war. Da sie<br />
an solchen Orten ihre Nachrichten an die<br />
Boten anderer Mächte weitergeben konnten,<br />
wurden die <strong>Bern</strong>er Boten auch selten<br />
ausserhalb des eidgenössischen Raumes<br />
geschickt. Somit sparte der <strong>Bern</strong>er Rat<br />
Zeit und Geld.<br />
Zuverlässigkeit trotz<br />
vieler Gefahren<br />
Auch wenn die Zuverlässigkeit der Nachrichtenübermittlung<br />
durch Boten sehr<br />
gross war und Läufer obrigkeitlichen<br />
Schutz genossen, konnte es dennoch zu<br />
Zwischenfällen kommen. Was einem widerfahren<br />
konnte, wenn man sich an einem<br />
Läufer verging, verdeutlicht etwa eine<br />
Basler Läufergestalt aus dem 16. Jahrhundert,<br />
die der örtlichen Schützengesellschaft<br />
als Schiessscheibe gedient hat. Auf<br />
einem Schild, dass die Figur in der Hand<br />
trägt, steht nämlich: Ich louff nit schnell /<br />
24 UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />
Abb. 4: Karnevalesk überzeichnetes Negativbeispiel des pflichtvergessenen Boten.<br />
vnd bin lang ouff der fartt / gutter xel gutter<br />
/ hast woll denn schuttz (Schuss) gespartt<br />
/ ich warrn dich drifftts mich / es<br />
gerütt dich.<br />
Trotz der Immunität der Boten, die den<br />
Basler Schützen hier recht deutlich vor Augen<br />
geführt wurde, kam es immer wieder<br />
vor, dass Läufer an ihren Zielorten gefangengesetzt<br />
oder unterwegs getötet wurden.<br />
Gelegentlich wurden auch Briefe entwendet,<br />
um damit ein politisches Zeichen zu<br />
setzen, den Gegner auszuspionieren und<br />
dadurch zu schwächen. So wurde in der<br />
Schlacht bei St. Jakob an der Birs 1444<br />
(Sebastian Brand: Das Narrenschiff, 1494)<br />
ein Hensli Schmid von Stans getötet, der<br />
als landlüten löüfer unterwegs war und eigentlich<br />
eine Kriegserklärung nach Ensisheim<br />
überbringen sollte. Solche Überfälle<br />
waren bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts<br />
ein gängiges Mittel politischer Rache:<br />
ein Überfall französischer Truppen<br />
auf zwei eidgenössische Boten im Jahr<br />
1511 löste etwa den sogenannten Kaltwinterfeldzug<br />
aus.<br />
Wie ihre Kollegen gerieten auch die <strong>Bern</strong>er<br />
Ratsboten gelegentlich zwischen die<br />
politischen Fronten. Während des Alten<br />
Zürichkrieges wurde 1444 der geschwo-
ene Läufer Wernlin Furer in Zürich gefangen<br />
genommen. Der <strong>Bern</strong>er Rat reagierte<br />
umgehend auf die Inhaftierung, wie<br />
eine Ausgabe in den <strong>Bern</strong>er Stadtrechnungen<br />
belegt: Denne Furer, als der ze Zurich<br />
gevangen lag, hiessen ime min herren ze<br />
stur geben IIII lb. Ob es sich dabei um<br />
Geld für einen Loskauf handelte, ist unsicher.<br />
Auch während der Kriege in Norditalien<br />
zwischen 1490 und 1525 scheinen<br />
die <strong>Bern</strong>er Läufer gelegentlich am Ausführen<br />
ihrer Aufträge gehindert worden<br />
zu sein. So erfuhr <strong>Bern</strong> die Nachricht von<br />
der Eroberung Pavias am 15. Juni 1512 erst<br />
mit Verspätung, da der Bote, welchen der<br />
<strong>Bern</strong>er Hauptmann vom Kriegsschauplatz<br />
ausgesandt hatte, abgefangen wurde. Auch<br />
dem Läufer Rudolf Siber, der 1516 nach<br />
Norditalien unterwegs war, wurde auf der<br />
Südseite des Gotthards von französischen<br />
Truppen aufgehalten und musste unverrichteter<br />
Dinge nach <strong>Bern</strong> zurückkehren.<br />
Immer wieder Raubüberfälle<br />
Immer wieder wurden auch einfache<br />
Raubüberfälle auf Boten verübt. Dies geschah<br />
vor allem deshalb, weil Läufer nicht<br />
selten auch Geld transportierten und nur<br />
leicht bewaffnet waren. Neben dem Geld<br />
wurde ihnen meistens auch die silberne<br />
Botenbüchse abgenommen. So wurden<br />
1469 ein <strong>Bern</strong>er und ein Solothurner Bote<br />
von der Stadt Basel entschädigt, denen auf<br />
Basler Gebiet beides – Geld und Büchsen<br />
– geraubt worden war. Weniger glimpflich<br />
verlief der Raubüberfall auf einen Colmarer<br />
Stadtläufer, dessen Überreste 1556 in<br />
einem Wald bei <strong>Bern</strong> gefunden wurden.<br />
Die <strong>Bern</strong>er Obrigkeit hat sie samt der silbernen<br />
leuffers buchsen und eyn lederner<br />
sack darinnen vielerley brieff und zedell<br />
zusammen mit einem schryb täffely und<br />
dem Botenspiess des Getöteten nach Colmar<br />
zurückgeschickt.<br />
Doch auch seitens der Läufer scheint es gelegentlich<br />
zu Nachlässigkeiten und Gaunereien<br />
gekommen zu sein: So wurde<br />
1484 in Strassburg eine neue Botenordnung<br />
verfasst, weil angeblich viele leichtfertige<br />
Knechte zugelaufen sind, um der<br />
Stadt Büchse zu tragen (Abb. 4). Auch<br />
der Basler Bürgermeister und Rat liess<br />
zur besseren Kontrolle im Jahr 1475 die<br />
Berichte zweier Ratsboten über die Ablieferung<br />
von Briefen beurkunden. Aus ähnlichen<br />
Gründen muss auch der <strong>Bern</strong>er Rat<br />
im Eid der Boten und Zuboten 1481 folgende<br />
Klausel eingeführt haben: falls die<br />
Amtleute auf ihren Wegen einem ihnen<br />
unbekannten Boten begegnen sollten, der<br />
silbrin oder annder büchsen miner herren<br />
unerlaubt tragen würde, müssten sie das<br />
unverzüglich min hern oder einen stattschriber<br />
melden. Demnach war es auch<br />
in <strong>Bern</strong> bereits zu Zwischenfällen gekommen.<br />
Menschliche Unzulänglichkeiten anderer<br />
Art belegt der Fall eines Solothurner<br />
Boten, der im Jahre 1509 «aus dem<br />
Löwen herausgefallen ist», was entweder<br />
auf Trunkenheit oder einen Raufhandel im<br />
Wirtshaus hindeutet.<br />
Trotz solcher Zwischenfälle war die Nachrichtenübermittlung<br />
über Boten im Spätmittelalter<br />
sehr zuverlässig, wovon in<br />
<strong>Bern</strong> allein die 8500 Botengänge zeugen,<br />
die der Seckelmeister in den zwischen<br />
1375 und 1527 erhaltenen Stadtrechnungen<br />
verzeichnet hat. Im Schnitt wurden<br />
dabei rund 400 Botengänge pro Jahr ausgeführt.<br />
Diese Effizienz ist wahrscheinlich<br />
nicht zuletzt der flexiblen Organisa-<br />
tionform zu verdanken. Die Wertschätzung<br />
für diese Art der Nachrichtenübermittlung<br />
blieb auch mit der Einführung<br />
fester Post- und Botenkurse im Verlauf<br />
des 16. Jahrhunderts bestehen.<br />
Lic. phil. Klara Hübner<br />
Historisches Institut<br />
Abteilung Mittelalter<br />
Literatur:<br />
• Hans-Dieter Heimann: Zur Visualisierung städ-<br />
tischer Dienstleistungskultur: Das Beispiel der<br />
kommunalen Briefboten, in: Anzeiger des Ger-<br />
manischen Nationalmuseums 1993, S. 22–35.<br />
• Klara Hübner: <strong>Bern</strong>s Louffende Botten von den<br />
Anfängen bis zur Reformation. Entstehung, Orga-<br />
nisation und Funktionsweise des <strong>Bern</strong>er Botenwe-<br />
sens zwischen Tradition und Innovation, Lizentiat<br />
<strong>Bern</strong> 2000.<br />
• Otto Lauffer: Der laufende Bote im Nachrichten-<br />
wesen der früheren Jahrhunderte. Sein Amt, seine<br />
Ausstattung und seine Dienstleistungen, in: Bei-<br />
träge zur deutschen Volks- und Altertumskunde 1<br />
(1954), S. 19–60.<br />
UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />
25
Wahrnehmungsprobleme zur Zeit der Kreuzzüge<br />
Haben Andersgläubige<br />
keine Geschichte?<br />
Viele grössere und kleinere Kreuzzüge haben christliche<br />
Heere zwischen 1095 und 1291 unternommen, um<br />
das Heilige Land oder spanischen Boden den «Ungläubigen»<br />
zu entreissen. Vielfach wurden die historischen Taten<br />
der Kreuzfahrer beschrieben, die der Gegner aber nicht.<br />
Obwohl sie eine hohe Kultur besassen, gibt es aus jener Zeit<br />
keine christlichen Darstellungen der Geschichte der Muslime.<br />
Mit zwei Ausnahmen: Erzbischof Wilhelm von Tyrus<br />
(ca. 1130–1186) verfasste eine «Geschichte der orientalischen<br />
Fürsten», und Rodrigo Ximénez de Rada, Erzbischof von<br />
Toledo (1170–1247), schrieb eine «Geschichte der Araber».<br />
Die christliche Geschichtsschreibung liess<br />
Andersgläubigen keinen eigenen Platz. Sich<br />
mit der Geschichte von Heiden oder Juden<br />
auseinanderzusetzen, galt als unnütz und<br />
nahezu wertlos, war eine res negligenda,<br />
eine zu vernachlässigende Angelegenheit,<br />
so meinten die Chronisten und Kronzeugen<br />
Adam von Bremen († um 1081) und<br />
Otto von Freising († 1158). In deren Geschichtsphilosophie<br />
konzentrierte sich in<br />
Anlehnung an die Lehren des Kirchenvaters<br />
Augustinus alles von Bedeutung und<br />
Wert, Heil, Herrschaft und fortschreitendes<br />
Wissen in einem, dem christlichen und<br />
westlichen Teil der Welt, in der alleinherrschenden<br />
civitas Christi, die sich als römische<br />
Papstkirche in Europa verstand, während<br />
dem anderen und östlichen Teil der<br />
Welt als der civitas perfida der Juden und<br />
Heiden nichts blieb und, zum Untergang<br />
bestimmt, nichts bleiben sollte. Ein solches<br />
Geschichtsbild hinderte zwar nicht<br />
daran, Wissen über Andere anzuhäufen;<br />
doch fehlte die historische Verarbeitung<br />
des vielfach Erfahrenen, die Wahrnehmung<br />
des Anderen durch das Medium der<br />
Geschichtsschreibung.<br />
Bis heute sind in Europa nur zwei christliche<br />
Ausnahmen bekannt geworden, die<br />
jede auf ihre Weise das verordnete Desinteresse,<br />
eine förmliche «Ideologie des<br />
Schweigens» durchbrachen. Es handelt<br />
sich in beiden Fällen um historische Darstellungen<br />
der Muslime seit den Tagen Mohammeds,<br />
zum einen um die «Geschichte<br />
26 UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />
der orientalischen Fürsten» (Gesta orientalium<br />
principum) des Erzbischofs Wilhelm<br />
von Tyrus, zugleich Kanzler des<br />
Kreuzfahrerkönigreichs Jerusalem, zum<br />
anderen um die «Geschichte der Araber»<br />
(Historia Arabum) des Erzbischofs von<br />
Toledo und Primas von Spanien, Rodrigo<br />
Ximénez de Rada. Wilhelms von Tyrus<br />
«Geschichte der orientalischen Fürsten»,<br />
noch im 13. Jahrhundert im lateinischen<br />
Orient benutzt, ist indessen nach 1300 in<br />
Vergessenheit geraten und dann wohl verloren<br />
gegangen. Dass ihr im Gegensatz<br />
zu seiner lateinischen «Kreuzfahrerchronik»,<br />
die fortgesetzt und in andere Sprachen<br />
übersetzt, vielfach abgeschrieben<br />
und gelesen wurde, kein Erfolg beschieden<br />
war, zeigt nur allzu deutlich, wie stark<br />
die Vorbehalte im Westen gewesen sind,<br />
zumal am Ende der europäischen Präsenz<br />
im Orient: Crusades were interesting,<br />
but Muslims were not (R. H. C. Davis).<br />
So muss man ersatzweise Wilhelms<br />
«Kreuzfahrerchronik» studieren. Anders<br />
war die Ausgangslage im Reconquista-<br />
Spanien. Hier blieb trotz der Vertreibungen<br />
und des künftigen Missionsdrucks ein<br />
historisches Interesse am islamischen Spanien<br />
bestehen. Nicht nur Rodrigos Haupt-<br />
Abb. 1: Die Abqualifizierung der Anderen diente der Immunisierung der Eigenen. Muslime<br />
galten zumeist als Heiden, mithin Teufels- und Dämonenkinder, die mit Christen nur<br />
Böses im Sinn hatten: Ein «heidnischer Mohren-König» droht dem Christen, der sich weigert,<br />
das Götzenbildnis zu verehren, mit Enthauptung (13. Jh).<br />
(Terry Jones, Alan Ereira, Die Kreuzzüge, München 1995, S. 19)
Abb. 2: «Heiden» werden trotz gleicher ritterlich-kultureller Standards als dämonische Wesen durchschaut: Fiktiver Zweikampf zwischen<br />
dem Kreuzfahrer Richard Löwenherz, König von England, und dem Sultan Saladin von Ägypten. Der Sultan verliert seinen Helm<br />
und entpuppt sich unter der Maske des Ritterlichen als Heide mit dämonischen Zügen und drachenartigem Schuppenpanzer (14. Jh).<br />
werk, die «Geschichte Spaniens oder gotische<br />
Geschichte» (De rebus Hispaniae seu<br />
Historia Gothica), sondern auch seine Historia<br />
Arabum wurden noch in der Neuzeit<br />
in der spanischen Chronistik benutzt und<br />
frühzeitig gedruckt.<br />
Wilhelm von Tyrus und Rodrigo Ximénez,<br />
die als gelehrte Juristen und Theologen,<br />
als Kirchenfürsten, Hofmänner<br />
und Geschichtsschreiber viele Gemeinsamkeiten<br />
aufwiesen, lebten in kulturellen<br />
Grenzräumen des Nahen Ostens und<br />
Spaniens und hatten offenbar kaum Wahrnehmungsprobleme.<br />
Dies lässt sich an fünf<br />
Punkten überprüfen:<br />
1. Die Religion<br />
Die Tatsache, dass Muslime historiographisch<br />
zu Subjekten ihrer Geschichte gemacht<br />
wurden und man damit sowohl in<br />
Tyrus als auch in Toledo der angeblichen<br />
Bedeutungslosigkeit der Anderen widersprach,<br />
lässt schon eine andere Einstellung<br />
erwarten, als sie gemeinhin im europäischen<br />
Mittelalter den hostes crucis,<br />
den «Feinden des Kreuzes» entgegengebracht<br />
worden ist. Muslime wurden von<br />
beiden Gewährsmännern nicht als Heiden,<br />
sondern als Gottgläubige wahrgenommen,<br />
die den gemeinsamen Gott verehrten,<br />
wenn auch auf andere Weise als<br />
die Christen. Die Verehrung an sich erschien<br />
beiden Autoren ein durchaus positives<br />
Verhalten zu sein, das heisst, Wilhelm<br />
von Tyrus und Rodrigo Ximénez waren in<br />
der Lage, obwohl sie sich von der anderen<br />
Religion als einer doctrina pestilens<br />
schärfstens distanzierten, der Religiosität<br />
der Menschen dennoch Achtung entgegen<br />
zu bringen. Diese Form der inhaltlichen<br />
Wahrnehmung von Religion sei daher «der<br />
Vorrang der Religiosität» genannt. Beide<br />
anerkannten im Islam eine Lehre, die<br />
ebenfalls, wenn auch nur in dessen Denken<br />
und eigenen Traditionen und nicht auf<br />
der Stufe der christlicherseits beanspruchten<br />
Vollkommenheit, zu Gottesfurcht und<br />
Frömmigkeit und zu einem reinen, heiligmässigen<br />
Lebenswandel anleiten konnte.<br />
Mit solchen Auffassungen, die allesamt<br />
ein persönliches Moment im Umgang mit<br />
Religion betonten, stellten sich die beiden<br />
Autoren, obwohl Lateiner, in eine orientchristliche<br />
bzw. spanisch-mozarabische<br />
Tradition hinein, die nicht lange nach der<br />
Ausbreitung des Islam begann und erst einmal<br />
das Verbindende zwischen beiden Religionen<br />
suchte.<br />
2. Die Menschen<br />
Der Vorrang der Religiosität kündigt im<br />
Grunde bereits an, in welcher Weise Menschen,<br />
handelnde Völker, Gruppen und<br />
Personen durch die beiden Geschichtsschreiber<br />
betrachtet worden sind. Die<br />
Masse der Muslime oder einzelne Völker,<br />
die Araber, die Türken, die Berber, die<br />
Ägypter bleiben seltsam amorph und farblos.<br />
Ethnische Vorurteile, positive wie negative,<br />
finden sich nur selten. Ganz anders<br />
schrieben sie, wenn es um überschaubare<br />
Einheiten oder mehr noch um einzelne<br />
Personen ging, freilich um Standesgenossen,<br />
die die tragenden Rollen der Landesgeschichte<br />
spielten; dann wurden sie aus<br />
(Terry Jones, Alan Ereira, Die Kreuzzüge, München 1995, S. 188–89)<br />
der Masse herausgehoben, mit ihren Tugenden<br />
und Untugenden, Fähigkeiten und<br />
Leistungen, auch dann, wenn oder gar obwohl<br />
dieselben zum Schaden christlichen<br />
Landes verwendet wurden. Diese Form<br />
der Wahrnehmung von Anderen sei «der<br />
Vorrang des Individuellen» benannt. Wil-<br />
Abb. 3: Muslime haben als «Heiden» dunkelhäutige,<br />
grobe, «barbarische» Gesichtszüge,<br />
selbst als Fürsten: Verwandtschaft<br />
Sultan Saladins (um 1350).<br />
(Peter Milger, Die Kreuzzüge. Krieg im Namen Gottes, Mün-<br />
UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />
chen 1988, S. 32)<br />
27
helm und Rodrigo beurteilten islamische<br />
Herrscher vornehmlich danach, wie sie die<br />
politischen Tugenden ausübten, zum Nutzen<br />
oder zum Schaden ihrer Reiche und<br />
Völker, ohne dabei Rücksicht auf christliche<br />
Belange zu nehmen.<br />
Eindrucksvoll gelang es beiden Autoren,<br />
Sympathien und Antipathien zu formulieren<br />
und Persönlichkeitsbilder zu zeichnen,<br />
in denen das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein<br />
von Eigenschaften wie<br />
milde, freigebig, gütig, gerecht, gottesfürchtig,<br />
religiös, umsichtig, menschlich,<br />
moderat, friedfertig, beständig, geduldig,<br />
würdig, glücklich und gesegnet, jedoch<br />
nicht die Tatsache der Andersgläubigkeit,<br />
eine grosse Rolle spielten. Herrscher<br />
mochten gut oder schlecht, stark oder<br />
schwach sein, sie waren vor allem für Rodrigo<br />
am schlimmsten, wenn sie sich als<br />
solche Leichtgewichte erwiesen, dass in<br />
ihrer Regierungszeit nichts passierte, was<br />
würdig gewesen wäre, überliefert zu werden:<br />
Welch ein Unterschied zu Adam von<br />
Bremen und Otto von Freising, die noch<br />
Abb. 5: Ein besonderer Kreuzfahrer und<br />
Verehrer des Heiligen Landes: Ritter Kuno<br />
von Buchsee als Stifter der Johanniterkomturei<br />
in Münchenbuchsee, Kt. <strong>Bern</strong>, Chorfenster<br />
in der Kirche von Münchenbuchsee<br />
(13. Jh).<br />
(Peter Meyer (Hg.), <strong>Bern</strong>er – deine Geschichte; 1981, S. 63)<br />
28 UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />
Abb. 4: Zahlreiche Kreuzfahrer-Darstellungen<br />
in den<br />
Chroniken dienen der Verherrlichung<br />
der «christlichen<br />
Helden» und ihrer Taten:<br />
Gottfried von Bouillon und<br />
der päpstliche Kreuzzugslegat,<br />
Bischof Adhémar von Le<br />
Puy, an der Spitze des siegreichen<br />
Heeres auf dem ersten<br />
Kreuzzug (13. Jh).<br />
(Silvia Rozenberg (Hg.), Knights of the<br />
Holy Land)<br />
Nutzen und Würde der Historiographie<br />
von ihrem christlichen Gehalt abhängig<br />
machten!<br />
3. Das Recht<br />
Die lateinischen Gesellschaften in Spanien<br />
und im Heiligen Land werden oft<br />
als Pionier- oder Frontgesellschaften beschrieben,<br />
wobei man bewusst oder unbewusst<br />
assoziiert, dass ununterbrochen<br />
Reconquista-Kriege, Heilige Kriege oder<br />
Kreuzkriege geführt worden seien. Insgesamt<br />
waren jedoch die Friedenszeiten<br />
viel häufiger und länger als die Kriegszeiten,<br />
und nicht selten waren jene auch<br />
vertraglich gesichert. Die Basis dazu war<br />
das Recht, worauf Wilhelm und Rodrigo,<br />
Abb. 6: Friedenszeiten waren<br />
viel länger als die Zeiten des<br />
Krieges und boten Chancen<br />
zur Verständigung: Muslim<br />
und Christ beim Schachspiel<br />
(11./12. Jh).<br />
(Terry Jones, Alan Ereira, Die Kreuzzüge,<br />
München 1995, S. 96)<br />
beide hochrangige politische Mitgestalter<br />
ihrer Reiche, wenigstens reflexiv in ihrer<br />
Historiographie Einfluss nehmen konnten.<br />
Im Gegensatz zu den herrschenden<br />
Vorstellungen der lateinischen Papstkirche,<br />
in denen Ungläubigen entweder gar<br />
keine oder nur mindere Rechte zugebilligt<br />
wurden, machten sie keinerlei Unterschiede.<br />
Daher sei diese Form inhalt-<br />
licher Wahrnehmung «der Vorrang gleichen<br />
Rechts» genannt. Für diesen Vorrang<br />
trat insbesondere Wilhelm von Tyrus<br />
ein. Er zögerte nicht, den feindlichen<br />
Nachbarn gerade auch dann das Recht auf<br />
Heimat, Freiheit, Eigentum und Familie<br />
zuzugestehen, wenn die territoriale oder<br />
städtische Hoheit des muslimischen Ge-
meinwesens durch ein christliches Heer<br />
bedrängt und verletzt wurde, ein Heer,<br />
das seinerseits mit dem Anspruch der<br />
Verteidigung des Erbes Christi im Heiligen<br />
Land operierte. Darüber hinaus besassen<br />
die Muslime in den Augen des Tyrers<br />
das Recht, sich nicht nur gegen christliches<br />
Unrecht (injuria) zur Wehr zu setzen, sondern<br />
auch selbst aktiv zur Rache für ein erlittenes<br />
Unrecht ein bellum justum, einen<br />
gerechten Krieg zu führen. Dieses Recht<br />
war absolut, d. h. es galt auch dann, wenn<br />
die christliche Seite ein gleiches geltend<br />
machte. Und folgerichtig fügte sich allem<br />
Recht der Muslime die lex pactorum,<br />
das Vertragsrecht als formelle Grundlage<br />
der rechtlichen Gleichstellung mit Christen<br />
hinzu. Wilhelm und Rodrigo Ximénez,<br />
beide Juristen, beide ausgebildet in den berühmten<br />
Rechtsschulen von Bologna, waren<br />
zutiefst überzeugt, selbstverständlich<br />
schon aus politischer Notwendigkeit, dass<br />
Verträge gehalten werden müssen, und<br />
zwar uneingeschränkt etiam infidelibus,<br />
auch den Ungläubigen.<br />
4. Wahrnehmung und Toleranz<br />
Die Aufwertung der Anderen durch Geschichtsschreibung<br />
und der darin betonte<br />
Vorrang der Religiosität, des Individuellen<br />
und des gleichartigen Rechts stiess in<br />
der Rezeption der Werke Wilhelms und<br />
Rodrigos bei Bearbeitern, Übersetzern<br />
und Fortsetzern auf Unverständnis und<br />
zum Teil harsche Kritik. Man deutete um,<br />
schwächte ab, verfälschte, unterschlug,<br />
missverstand und gebärdete sich als Glaubenskampfideologe,<br />
der gerade dort wieder<br />
auf Feindbilder setzte, wo die beiden<br />
Autoren Gemeinsamkeiten und individuell<br />
Lobenswertes hervorgehoben hatten. Die<br />
vielen, oft zurechtweisenden Korrekturen<br />
lassen freilich die nicht alltägliche Haltung<br />
der beiden Gewährsleute umso klarer<br />
hervortreten. Diese Haltung kann man<br />
als eine frühe Form von Toleranz verstehen<br />
oder genauer als eine mit inhaltlicher<br />
Intoleranz gepaarte informelle Toleranz.<br />
Selbstverständlich war diese Haltung auch<br />
eine politische und ganz und gar pragmatische,<br />
aber sie ging doch entschieden über<br />
die Notwendigkeiten der Tagespolitik hinaus.<br />
Im übrigen ist mittelalterliche Toleranz<br />
immer eine pragmatische Toleranz<br />
gewesen. Man ertrug mehr oder weniger<br />
gelassen, was man doch nicht oder im Augenblick<br />
nicht ändern konnte. Das Problem<br />
war nur, dass ein solches Ertragen,<br />
Abb. 7: Trotz grundsätzlicher religiöser Gegnerschaft gab es zahlreiche gemeinsame Interessen,<br />
Dienste an anderen Höfen oder gemeinsamer Kampf – sogar unter christlichen<br />
Feldzeichen – gegen gemeinsame Feinde: Szenen der Reconquista aus den Cantigas de<br />
Santa Maria König Alfons X., des Weisen, von Kastilien (13. Jh).<br />
erst recht ein im modernen Sinne bewusstes<br />
Geltenlassen von anderen Meinungen<br />
und Verhaltensweisen gar nicht begrifflich<br />
durch tolerantia oder tolerare wiedergegeben<br />
werden musste. Wilhelms und Rodrigos<br />
Toleranz war keine tolerantia; dieser<br />
Begriff stand bei ihnen nur für das Ertragen<br />
von Hunger, von Durst, von Unrecht,<br />
von Lasten aller Art, von Steuerlasten bis<br />
zu Gebetslasten. Ihre tolerante Wahrnehmung<br />
des Anderen drückte sich vielmehr<br />
in einer Reihe von Synonymen des klassischen<br />
Lateins aus: humanitas, mode-<br />
(Jonathan Riley-Smith (Hg.), The Oxford Illustrated History of the Crusades, Oxford 1995, S. 53)<br />
ramen, clementia, paciencia – Menschlichkeit,<br />
Mässigung, Milde, Geduld<br />
waren Begriffe, die allesamt im antiken<br />
und frühchristlichen Denken Toleranz<br />
meinten oder wenigstens teilweise abdeckten.<br />
5. Konditionen<br />
der Wahrnehmung<br />
Fünf Konditionen könnten zusammenwirkend<br />
die besondere und in ihrer Zeit herausragenden<br />
Haltungen Wilhelms und Rodrigos<br />
begründen:<br />
UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />
29
1. Die Nähe zur islamischen Kultur. Wilhelm,<br />
in Jerusalem geboren, fühlte sich<br />
stolz als Orientlateiner. Rodrigo de Rada<br />
aus Navarra ging bereits früh nach Toledo<br />
an den Hof Kastiliens. Zwischen Jerusalem<br />
und Tyrus bzw. in Toledo kamen beide<br />
mit dem Islam in Berührung, sammelten<br />
Wissen, Erfahrungen, Begegnungen; beide<br />
kamen neben anderen Sprachen auch mit<br />
dem Arabischen zurecht und nutzten für<br />
ihre Werke arabisch geschriebene Quellen.<br />
Weder physische noch geistige Nähe waren<br />
jedoch allein ein Garant für Wahrnehmungsfähigkeit.<br />
2. Die Bildung. Wilhelm und Rodrigo hatten<br />
in Paris und Bologna Philosophie, Theologie<br />
und Recht studiert. Beide gehörten<br />
damit in den wachsenden Kreis der Intellektuellen,<br />
die auf geistige Arbeit, rationales<br />
Denken und die eigene Bildungsbiographie<br />
enorm stolz waren. In diesem Milieu<br />
war auch in der Theologie Vieles noch im<br />
Flusse und im besten Sinne «fragwürdig».<br />
Offen konnte man in den Pariser Schulen<br />
nach der Güte ausserchristlicher Ethik<br />
und ihrer Heilswirksamkeit fragen. Möglich<br />
ist, dass neben den Bologneser Rechtstudien<br />
hier ein Raum geöffnet wurde, den<br />
Wilhelm und Rodrigo später mit eigenen<br />
Erfahrungen der Nähe zum Islam füllen<br />
konnten.<br />
3. Karrieren. Beide Gewährsleute durchliefen<br />
herausragende politische und geistliche<br />
Karrieren und wurden Mitgestalter<br />
der Politik ihrer Länder zwischen Krieg<br />
und Frieden, Kreuzzügen und Allianzen.<br />
So lag der Zugang zur Welt der Anderen<br />
bereits auf einem hohen politischen Niveau.<br />
Politik machen und Krieg führen<br />
war das eine, unabhängig denken freilich<br />
das andere.<br />
4. Die Landesgeschichte. In Wilhelms<br />
und Rodrigos Werken ist die jeweilige<br />
Landesgeschichte der gemeinsame Nenner<br />
für christliche wie muslimische Geschichte.<br />
Zwar erhoben beide unbedingten<br />
Anspruch auf Reconquista, auf ein<br />
Wiederanknüpfen an die unterbrochene<br />
christliche Herrschaft, deswegen nannte<br />
Rodrigo seine Spaniengeschichte Historia<br />
Gothica und deswegen liess Wilhelm<br />
seine Kreuzfahrerchronik im 7. Jahrhundert,<br />
in den Tagen des oströmischen Kaisers<br />
Heraklius, beginnen. Und doch waren<br />
sich beide bewusst, dass die Muslime<br />
30 UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />
Abb. 8: Kreuzfahrerhelden<br />
sind wahre Ritter Christi, demütig<br />
und fromm, und als<br />
solche dem heidnischen<br />
Gegner haushoch überlegen:<br />
König Heinrich III.<br />
von England als Kreuzritter<br />
(um 1250).<br />
(Jonathan Riley-Smith (Hg.), Oxford<br />
1995, S. 51)<br />
selbständige und subjektiv bedeutende Anteile<br />
an der Geschichte des gemeinsamen<br />
Bodens hatten. Dieser Boden war auch patria,<br />
Vaterland der Anderen, der Orientales<br />
wie der Hispani Arabes, ausgestattet<br />
mit weit zurückreichenden historischen<br />
Rechten, die zu verteidigen auch niemand<br />
rechtlich bestritt. So schrieben sie nicht<br />
einfach ein Kapitel über die Anderen (wie<br />
in manchen späteren Weltchroniken), sondern<br />
eigenständige Historien mit überwiegend<br />
moderaten Interpretationen, um vielleicht<br />
den anderen Teil ihrer eigenen und<br />
eben nicht unwürdigen Geschichte nicht<br />
zu verdrängen.<br />
5. Die persönliche Entscheidung. Wilhelm<br />
und Rodrigo waren Hofhistoriographen,<br />
beide offiziell durch ihre Könige beauftragt,<br />
so dass man geneigt sein könnte,<br />
wenigstens von einem hofgesellschaftlichen<br />
Konsensus zu sprechen. Doch was<br />
diese beiden gelehrten Politiker von Anderen<br />
an Religiosität, Individualität und<br />
Rechtsgleichheit wahrnahmen und in einem<br />
inklusiven Geschichtsbild unterzubringen<br />
vermochten, stand so klar über<br />
der im Westen und gerade auch in Spanien<br />
weitverbreiteten Meinung, dass man<br />
letztlich der persönlichen und unabhängigen<br />
Entscheidung den wichtigsten Effekt<br />
unter den Konditionen der Wahrnehmung<br />
zubilligen muss.<br />
Prof. Dr. Rainer C. Schwinges<br />
Historisches Institut<br />
Abteilung für Mittelalterliche Geschichte<br />
Eine ausführliche Studie zu den angesprochenen<br />
Problemen findet sich in Rainer C. Schwinges: Die<br />
Wahrnehmung des Anderen durch Geschichtsschrei-<br />
bung. Muslime und Christen im Spiegel der Werke<br />
Wilhelms von Tyrus († 1186) und Rodrigo Ximénez'<br />
de Rada (†1247), in: Toleranz im Mittelalter, hg.<br />
von Alexander Patschovsky und Harald Zimmer-<br />
mann (Vorträge und Forschungen 45), Sigmarin-<br />
gen 1998, S. 101–127.
Das Riesenreich im Osten<br />
Pax Mongolica<br />
Das mongolische Weltreich verband im 13. und<br />
14. Jahrhundert Europa und Asien miteinander. Politische<br />
Stabilität, ein funktionierendes Post- und Kurierwesen,<br />
offene Handelswege sowie die religiöse Toleranz<br />
der mongolischen Herrscher ermöglichten kulturellen<br />
Austausch und Handelsbeziehungen.<br />
Es mag zunächst erstaunen, in einem dem<br />
europäischem Mittelalter gewidmeten<br />
Themenheft einen Beitrag zu den Mongolen,<br />
einem zentralasiatischen Nomadenvolk,<br />
zu finden. Was haben die Mongolen<br />
mit unserem Mittelalter zu tun? Die<br />
Antwort ist einfach: die Mongolen gestalteten<br />
im 13./14. Jahrhundert die politischen,<br />
ökonomischen und auch kulturgeschichtlichen<br />
Gegebenheiten Europas mit.<br />
So wie in der Neuzeit Asien und Europa<br />
keineswegs zwei in sich geschlossene Kulturräume<br />
darstellen, so bildete im europäischen<br />
Mittelalter das mongolische<br />
Weltreich mit Europa einen gemeinsamen<br />
Kulturraum. Eine Geschichte Europas im<br />
13./14. Jahrhundert, die ohne die Einbeziehung<br />
der Geschichte des mongolischen<br />
Weltreichs und seiner in der Folgezeit entstandenen<br />
Teilreiche geschrieben wird,<br />
bleibt ein Torso und in zahlreichen kulturellen,<br />
religiösen und wirtschaftlichen Aspekten<br />
unverständlich.<br />
Pax Mongolica – der Titel weckt Assoziationen<br />
zur Pax Romana. Und in der Tat<br />
stellte auch das mongolische Weltreich<br />
ein übernationales Imperium dar, das in<br />
Abb. 1: Chinggis Khan. (Mongolia. The Legacy of Chinggis Khan, S. 26)<br />
wesentlichen Aspekten von einheitlichen<br />
Grundsätzen getragen wurde. Im Folgenden<br />
sollen die Entstehung dieses riesigen<br />
Reichs sowie seine kulturgeschichtliche<br />
Bedeutung für das mittelalterliche Europa<br />
im 13. und 14. Jahrhundert geschildert<br />
werden.<br />
Die Entstehung des<br />
mongolischen Weltreichs<br />
Die Geschichte der Mongolen als Volk ist<br />
mit dem Namen Chinggis Khans verbunden,<br />
der nicht nur die einzelnen Klans der<br />
«Monggol» zu einer Föderation zusammenschloss,<br />
sondern auch eine Reihe anderer<br />
mongolischer und türkischer Stammesgruppen<br />
durch sein Charisma an sich<br />
zu binden verstand. Temüdschin, der spätere<br />
Chinggis Khan, wurde in den sechziger<br />
Jahren des 12. Jahrhunderts im Klan<br />
der Bordschigid geboren. Nach einer entbehrungsreichen<br />
Kindheit und Jugend gelang<br />
es ihm, sich die benachbarten turkmongolischen<br />
Stämme zu unterwerfen.<br />
Auf einem Quriltai, einer Versammlung<br />
der Stammesfürsten der verschiedenen<br />
Steppenstämme, im Jahre 1206 wurde<br />
er zu ihrem Herrscher erhoben, die neunschwänzige<br />
Standarte als sichtbares Symbol<br />
seiner Herrschermacht wurde aufgepflanzt<br />
und der Titel Chinggis Khan<br />
wurde ihm verliehen. In den folgenden drei<br />
Jahren reorganisierte er die soziale Ordnung<br />
der nun «Monggol» genannten Stammesverbände,<br />
indem er die bisherige, an<br />
Deszendenzlinien orientierte Sozialstruktur<br />
zugunsten einer politisch-militärischen<br />
Ordnung ersetzte, die in Zehntausendschaften<br />
untergliedert war. Führungspositionen<br />
wurden allein nach Verdienst und<br />
Leistung vergeben. Die neue Sozialstruktur<br />
erwies sich als ausserordentlich flexibel<br />
und ermöglichte es, immer neue Völker<br />
dem mongolischen Reich einzugliedern.<br />
Nach Feldzügen gegen die Tanguten und<br />
das chinesische Chin-Reich wandte sich<br />
Chinggis Khan 1218 nach Westen und<br />
eroberte das Reich der Kara-Kitai, dann<br />
Buchara und Samarkand, Balch und Chorasan.<br />
1223 schlugen die mongolischen<br />
Truppen ein vereinigtes Heer von Kumanen<br />
und Russen an der Kalka und stiessen<br />
UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />
31
Abb. 2: Feldzüge des Chinggis Khan und seiner Nachfolger. (Die Mongolen und ihr Weltreich, S. 46–47)<br />
bis zum Dnjepr vor. 1227, im Todesjahr<br />
Chinggis Khans, war aus dem mongolischen<br />
Steppenimperium ein Weltreich bisher<br />
nicht bekannten Aussmasses geworden,<br />
das unter Chinggis Khans Sohn und Nachfolger<br />
Ögedei stabilisiert und noch weiter<br />
ausgedehnt wurde.<br />
Die Herrschaft<br />
Ögedei Khagans<br />
Ögedei Khagan setzte die Eroberungspolitik<br />
seines Vaters mit einem Feldzug gegen<br />
das Chin-Reich fort, das 1234 endgültig besiegt<br />
wurde. 1237 fielen die mongolischen<br />
Heere in Osteuropa ein und eroberten Rjazan,<br />
Kolomna und Moskau. 1238 fielen die<br />
Städte Wladimir, Twer und Rostow, 1240<br />
wurde die «Mutter der russischen Städte»,<br />
Kiew, eingenommen. Die Mongolen waren<br />
nun zu einer akuten Bedrohung Europas<br />
geworden. Nach dem Sieg über ein polnisches<br />
Heer bei Krakau drangen die Mongolen<br />
ins Odertal vor, zerstörten Breslau<br />
und brachten schliesslich am 9. April 1241<br />
dem deutschen Ritterheer bei Liegnitz eine<br />
vernichtende Niederlage bei. Zur gleichen<br />
Zeit rückten mongolische Truppen gegen<br />
Buda, die ungarische Hauptstadt, vor und<br />
schlugen am 11. April 1241 das ungarische<br />
Heer. Aber plötzlich zogen die mongolischen<br />
Truppen ab: Ögedei Khagan war in<br />
der Mongolei gestorben, und die mongolischen<br />
Fürsten und Befehlshaber wurden<br />
unverzüglich nach Karakorum zu einem<br />
32 UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />
Quriltai einberufen, um die Nachfolge zu<br />
regeln. Europa verdankte seine Rettung<br />
vor den Mongolen einem Zufall.<br />
Grundlagen<br />
der Pax Mongolica<br />
Ögedei Khagan zeichnete sich nicht nur<br />
als Feldherr aus, sondern er legte auch<br />
den Grundstein für die «Pax Mongolica».<br />
Nach der Geheimen Geschichte der Mongolen<br />
aus dem Jahre 1241 schreibt sich<br />
Ögedei selbst vier Leistungen zu, von denen<br />
die zweite von besonderer Bedeutung<br />
ist: «Meine zweite Leistung ist, dass ich<br />
Poststellen errichtet habe für den dazwischen<br />
laufenden Eilverkehr unserer Kuriere<br />
und für die Beförderung meiner<br />
wichtigen Amtssachen.»<br />
Das von ihm eingerichtete Postwesen<br />
Abb. 3: Paiza in Phags-pa-<br />
Schrift, spätes 13. Jh.<br />
(Mongolia. The Legacy of Chinggis Khan,<br />
S. 32, Abb. 5)<br />
und der Kurierverkehr führten dazu, dass<br />
das Mongolenimperium über Nachrichten-<br />
und Reiseverbindungen verfügte, wie<br />
sie bis dahin noch nicht existiert hatten.<br />
Durch das dichte Netz von Pferdewechselstationen<br />
konnten Reisende pro Tag<br />
100 Meilen zurücklegen. Spezialkuriere<br />
des Khans brachten es durch siebenfachen<br />
Pferdewechsel sogar auf 200 Meilen<br />
pro Tag. Als «Passierschein» im gesamten<br />
mongolischen Herrschaftsbereich<br />
diente den Reisenden der paiza, eine vom<br />
Khan legitimierte Erkennungsmarke.<br />
Unter Ögedei Khagan wurde schon 1229/<br />
1230 ein einheitliches Steuerwesen im<br />
mongolischen Reich etabliert. Zwecks<br />
Festlegung der Steuerabgaben liess er<br />
1235 den ersten Zensus in den mongo-
lischen Gebieten Nordchinas durchführen.<br />
Für die Einrichtung der ersten Staatskanzlei<br />
im Herbst 1231 nutzte Ögedei<br />
geschickt die administrativen Kenntnisse<br />
der ihm unterworfenen Völker. Das Kanzleiwesen<br />
wies im ganzen Reich ein hohes<br />
Mass an Verbindlichkeit auf, wie vielfach<br />
belegt ist durch die in chinesischer, türkischer,<br />
persischer, tibetischer und altrussischer<br />
Sprache überlieferten mongolischen<br />
Herrscherurkunden. 1234 erliess Ögedei<br />
eine Reihe von Zivil- und Militärgesetzen,<br />
die im ganzen Reich Gültigkeit hatten, und<br />
1236 befahl er den Druck von Papiergeld<br />
und dessen Umlauf. Mit diesen Massnahmen<br />
schuf er die Basis für die politische<br />
Stabilität des mongolischen Imperiums<br />
und ebnete den Weg für die transkon-<br />
tinentalen Kultur- und Handelsbeziehungen.<br />
So wurde es möglich, dass asiatische Gewürze<br />
und Seidenstoffe nach Venedig<br />
und Genua, Murano-Glas und mechanische<br />
Uhren nach China gelangten. Über<br />
die politischen und administrativen Gegebenheiten<br />
hinaus, spielte die bemerkenswerte<br />
religiöse Toleranz der Mongolen<br />
eine wichtige Rolle für den kulturellen<br />
Austausch. Sie war allerdings an die Bedingung<br />
geknüpft, dass der Klerus der verschiedenen<br />
Religionen seine Dienste stets<br />
dem Herrscherhaus zur Verfügung stellte,<br />
wie aus vielen der Steuerbefreiungserlasse<br />
hervorgeht, die den Vertretern der einzelnen<br />
Religionen gewährt wurden.<br />
Eine gemeinsame<br />
mittelalterliche Welt:<br />
Europa und Asien<br />
1245 schickte Papst Innozenz IV. eine Gesandtschaft<br />
zu den Mongolen. Ihm ging es<br />
vor allem darum, die Mongolen als Verbündete<br />
gegen die Muslime zu gewinnen<br />
und mit ihrer Hilfe die heiligen Stätten<br />
in Jerusalem zu befreien. Der Franziskaner<br />
Plano Carpini überbrachte ein entsprechendes<br />
Schreiben dem neu gewählten<br />
Güyük Khagan in Karakorum. Das<br />
Antwortschreiben, in einer in arabischer<br />
Schrift geschriebenen persischen Fassung<br />
überliefert und mit dem Siegel des Güyük<br />
Khagan versehen, etablierte den mongolischen<br />
Anspruch auf Weltherrschaft. Erst<br />
jetzt ahnten die Westeuropäer die politische<br />
Bedeutung des neu entstandenen<br />
Mongolenreiches.<br />
Nach dieser ersten offiziellen Gesandt-<br />
schaft wurden die diplomatischen Kontakte<br />
und die Handelsbeziehungen zwischen<br />
Europäern und Mongolen ausgebaut.<br />
Die in den unbekannten Weiten Asiens liegende<br />
Mongolei, die zuerst nur Stoff für<br />
Mythen hergab, wandelte sich schnell zu<br />
einem Reich, das in vielem den europäischen<br />
Christen vertraut war. Durch die<br />
Missionare und Kaufleute, die in dem<br />
riesigen mongolischen Reich unterwegs<br />
waren, kam es zu einem vorher nie dagewesenen<br />
Informationsfluss über bisher<br />
unbekannte Gebiete und Völker. In den<br />
mittelalterlichen Berichten können wir das<br />
Erstaunen über fremde Bräuche und religiöse<br />
Traditionen, die immer an den eigenen<br />
christlichen Paradigmen gemessen<br />
werden, und über die Prunkentfaltung<br />
am Hof der mongolischen Herrscher herauslesen.<br />
Trotz der Betonung der kulturellen<br />
Differenzen wird vor allem in dem<br />
Bericht des Guilelmus de Rubruc deutlich,<br />
dass über einen gemeinsamen kulturellen<br />
Raum gesprochen wird, der über<br />
die Konstante der Sesshaftigkeit definiert<br />
wird. Die Mongolen galten so lange als die<br />
vollkommen Fremden, wie sie als nomadische<br />
Reiterkrieger erlebt wurden, in Rubrucs<br />
Worten: «Nirgends haben sie eine<br />
feste Niederlassung, keine bleibende Stadt,<br />
noch wissen sie vorher ihren nächsten Aufenthaltsort.»<br />
In dem Augenblick jedoch, in<br />
dem die Reisenden in der Hauptstadt Karakorum<br />
eintrafen, begegneten sie inmitten<br />
einer für sie unberechenbaren, nicht lokalisierbaren<br />
Welt einem festen Ort. Die<br />
Erfahrung von Karakorum als städtischer<br />
Mittelpunkt des mongolischen Weltreichs<br />
veränderte die europäische Wahrnehmung<br />
der Mongolen und transformierte sie zu<br />
einem Volk, dem ebenfalls Kultur, wenn<br />
auch eine fremde und andere, eignete.<br />
Karakorum, eine<br />
mittelalterliche Metropole<br />
Karakorum, die 1220 gegründete Hauptstadt<br />
des mongolischen Weltreichs – rund<br />
370 km südwestlich des heutigen Ulaanbaatar<br />
gelegen –, stellte im 13. Jahrhundert<br />
eines der wichtigsten Machtzentren<br />
der mittelalterlichen Welt dar. Hier traf<br />
man auf russische Goldschmiede, deutsche<br />
Bergleute, uigurische Kanzleibeamte<br />
und armenische Händler. Der französische<br />
Bildhauer und Architekt Guillaume Boucher<br />
konstruierte für Möngke Khagan einen<br />
goldenen Baum, der schlangenartige<br />
Äste besass, welche unter Musikbeglei-<br />
Abb. 4: Ausschnitt des Schreibens Güyük<br />
Khagan an Papst Innozenz IV.<br />
(Plano Carpini, Kunde von den Mongolen, Farbtafel 22)<br />
UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />
33
tung die vom Khagan gewünschten Getränke<br />
spendeten. Dieses Wunderwerk<br />
versetzte noch den venezianischen Kaufmann<br />
Marco Polo in Erstaunen. Karakorum<br />
war eine multinationale und multireligiöse<br />
Stadt, sie besass ein muslimisches<br />
Viertel mit zwei Moscheen, eine nestorianische<br />
Kirche, deren Innenausstattung<br />
ebenfalls von Boucher gestaltet worden<br />
war, und eine Reihe tibetisch-buddhistischer<br />
Tempel, in Rubrucs Worten «Götzentempel».<br />
Die Stadt wurde um 1235 ausgebaut,<br />
mit einem Wall umgeben, und ein<br />
Palast, dessen Dach mit Löwendrachen<br />
als Verzierung gekrönt war, wurde nach<br />
den Plänen eines chinesischen Baumeisters<br />
errichtet. Der Palast wird seit kurzem<br />
in einem gemeinsamen Projekt der mongolischen<br />
Akademie der Wissenschaften<br />
und des Deutschen Archäologischen Instituts<br />
sowie des Instituts für Vor- und Frühgeschichte<br />
der <strong>Universität</strong> Bonn (D) ausgegraben<br />
und rekonstruiert.<br />
Karakorum, während der Yuan-Dynastie<br />
zugunsten von Dayidu, dem heutigen Beijing,<br />
von den mongolischen Herrschern<br />
aufgegeben, wurde nach 1368 wieder zur<br />
mongolischen Hauptstadt. Kurze Zeit später,<br />
1380, zerstörten chinesische Truppen<br />
in einer Strafexpedition die Stadt.<br />
Nach dem Zusammenbruch der mongolischen<br />
Yuan-Dynastie fielen die durch die<br />
Mongolen etablierten transkontinentalen<br />
Kultur- und Handelsbeziehungen bald<br />
der Vergessenheit anheim. Die Verbindungen<br />
zwischen Asien und Europa brachen<br />
ab, Innerasien wurde zu einem unbekannten,<br />
öden Raum, die Mongolen zu<br />
einem geschichtslosen, wilden Volk, zum<br />
Inbegriff des «Barbaren». Auch heute wird<br />
das Bild der Mongolen als eines in einem<br />
Urzustand elementarer Wildheit verharrenden<br />
Volkes fortgeschrieben, während<br />
die kulturelle Bedeutung der Mongolen<br />
und ihres Weltreiches für das europäische<br />
Abendland fast unbekannt ist. Vielleicht<br />
vermag die Wiederentdeckung von<br />
Karakorum, einer der bedeutendsten Metropolen<br />
der mittelalterlichen Welt, den<br />
Europäern einen vergessenen Teil ihrer<br />
eigenen Vergangenheit wieder in Erinnerung<br />
zu rufen.<br />
Prof. Dr. Karénina Kollmar-Paulenz<br />
Institut für Religionswissenschaft<br />
34 UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />
Abb. 5: Antonio Pisanello (etwa 1395–1450/55): Tatarischer Krieger. Ausschnitt aus dem<br />
Fresko San Giorgio e la Principessa (Chiesa di Sant`Anastasia, Verona).<br />
(Heisig, Müller (Hrsg.), Die Mongolen, Bd. 2, S. 62)<br />
Abb. 6: Steinerne Schildkröte, zur einstigen Palastanlage von Karakorum gehörend.<br />
(Die Mongolen und ihr Weltreich, S. 184)
Mittelalterliche englische Reiseberichte im kolonialistischen Werk Richard Hakluyts<br />
The principall navigations …<br />
Unter der Herrschaft von Königin Elisabeth I. erlebte<br />
England seinen Aufstieg zur grössten Seemacht der damaligen<br />
Zeit und den Beginn seiner erfolgreichen Kolonialpolitik.<br />
Das wachsende nationale Selbstbewusstein<br />
äusserte sich unter anderem in Schriften, in denen nicht<br />
nur zeitgenössische Schilderungen fremder Gegenden<br />
sondern auch Berichte über mittelalterliche Reisende der<br />
Überlegenheit britischen Denkens und Handelns Ausdruck<br />
gaben.<br />
Unter den Tudorkönigen und besonders<br />
unter Königin Elisabeth I. (1533–1603) begannen<br />
sich englische Gelehrte erstmals<br />
für Texte und Artefakte zu interessieren,<br />
welche aus der ihnen nicht mehr unmittelbar<br />
zugänglichen Vergangenheit stammten.<br />
So entstanden im 16. Jahrhundert einerseits<br />
die ersten grossen Manuskriptsammlungen,<br />
Literaturgeschichten und Kuriositätenkabinette,<br />
andererseits zugleich die<br />
Wissenschaftsbereiche des Antiquars und<br />
des Ethnographen. Eine neue Form von<br />
ethnographischen Schriften entwickelte<br />
sich im Zusammenhang mit den kolonia-<br />
listischen Ambitionen der Elisabethaner.<br />
Es ging in diesen Schriften entweder darum,<br />
die fremden Gegenden als potentiellen<br />
Markt für englische Produkte (vor<br />
allem Wolle) zu fördern oder darum, sie<br />
als Gelegenheit darzustellen, die königlichen<br />
Herrschaftsgebiete zu vermehren und<br />
die Geldtruhen zu füllen. Als Gegenleistung<br />
erhielten die einheimischen Heiden<br />
das unüberbietbare Geschenk des christlichen<br />
Heilsversprechens. Dieses Gedankengut<br />
kommt im Werk jenes elisabethanischen<br />
Gelehrten zu Ausdruck, der 1582<br />
(in seinem Werk «Divers Voyages Concer-<br />
Abb. 1: Titelblatt der Erstausgabe<br />
von The Principall Navigations,<br />
Voiages, and Discoveries<br />
of the English Nation […]. (London:<br />
George Bishop and Ralph Newberie, 1589)<br />
ning the Discovery of America») das gesamte<br />
vorhandene Wissen über das östliche<br />
Nordamerika vereinigte und es dem<br />
unmittelbar propagandistischen Ziel unterwarf,<br />
Sir Philip Sydneys Unterstützung<br />
für amerikanische Kolonialunternehmungen<br />
zu gewinnen.<br />
Hakluyt und sein Werk<br />
Es handelt sich bei diesem Gelehrten um<br />
Richard Hakluyt, der während der letzten<br />
Herrschaftsjahre des früh verstorbenen<br />
Edward VI. (1553) zur Welt kam – zu einer<br />
Zeit also, in welcher die ersten Engländer<br />
Reisen nach dem afrikanischen Guinea<br />
unternahmen. Hakluyt starb 1616, d. h.<br />
im selben Jahr wie ein gewisser William<br />
Shakespeare, welcher seine vielfach als<br />
kolonialistisch aufgefasste Vorstellung einer<br />
Brave New World in seinem zauberhaften<br />
Spätwerk «The Tempest» reflektierte.<br />
Der zum Kleriker ausgebildete, jedoch öfter<br />
als Spion in her majesty’s service tätige<br />
Richard Hakluyt war ein Aktionär der<br />
Virginia Company. Dieser persönliche Anteil<br />
an den Kolonialisierungsbestrebungen<br />
führte direkt zu seinem umfangreichen<br />
Hauptwerk «The Prinicipall Navigations,<br />
Voiages and Discoveries of the English Nation...,»<br />
1 dem Sammelband, der sich heute<br />
noch häufig in gekürzter und popularisierter<br />
Form in jeder englischen Hausbibliothek<br />
findet (vgl. dazu die Titelseite einer<br />
Populärausgabe von 1928 (Abb. 2) mit<br />
dem geradezu geschwätzigen Titelblatt der<br />
Erstausgabe von 1589 (Abb. 1). Elf Jahre<br />
später folgte eine zweite, erweiterte Ausgabe,<br />
zu deren Titel das Wort «Traffiques»<br />
hinzugefügt worden war, um auf die Handelsinteressen<br />
der elisabethanischen Seefahrt<br />
hinzuweisen. (Dazu konnte man sich<br />
damals noch ohne Scham bekennen.)<br />
Neunzig Prozent der in der ersten Ausgabe<br />
zusammengefassten Dokumente, welche<br />
England als Nation des Welthandels darstellen<br />
sollten, bestehen aus meist zeitge-<br />
1 Auf Deutsch würde der Titel etwa so lauten: «Die<br />
wichtigsten Seefahrten, Reisen und Entdeckungen<br />
der englischen Nation, auf dem See- oder Landweg,<br />
in die entlegensten und weitest entfernten Teile der<br />
Erde, im Zeitraum dieser 1500 Jahre: Aufgeteilt in<br />
drei Teile gemäss Richtungen, die die Reisende eingeschlagen<br />
hatten ... verfasst von Richard Hakluyt,<br />
Magister Artes und ehemaliger Student von Christchurch<br />
in Oxford.»<br />
UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />
35
nössischen Schriften verschiedensten Charakters.<br />
Neben eigentlichen Reiseberichten<br />
stehen hier Inventare, Bordbücher, königliche<br />
Botschaften, Privilegien, usw. Die<br />
übrigen zehn Prozent des zusammengefügten<br />
Materials beziehen sich auf das englische<br />
Mittelalter. Die Fragen, die sich nun<br />
der Mediävistin stellen, sind: Erstens, zu<br />
welchem Zweck wurden diese (durch die<br />
Überlieferung oftmals stark verfälschten)<br />
mittelalterlichen Texte angeführt? Und<br />
zweitens, was passiert mit einem mittelalterlichen<br />
Reisebericht, wenn die englische<br />
Renaissance ihn sich angeeignet hat?<br />
Kolonialisierung<br />
der Vergangenheit<br />
In seinen einleitenden Worten stellt Hakluyt<br />
sich selbst als einen Kulturhistoriker<br />
dar, der das Verborgene ans Licht bringt<br />
und eine nahezu verlorene Vergangenheit<br />
zum Leben erweckt, indem er ihre Fragmente<br />
in mühsamer Arbeit wieder zusammenfügt.<br />
Dabei bedient sich der gelehrte<br />
Antiquar der «Geographie» und der «Chronologie»<br />
beziehungsweise der Geschichte.<br />
Wenn der Renaissance-Autor auf die mittelalterlichen<br />
Kreuzfahrten zurückblickt,<br />
glaubt er, die Ziele der Kolonialisierung<br />
Virginias wiederzuerkennen. Auch in Virginia<br />
gehe es letztlich um den glühenden<br />
Wunsch, den christlichen Glauben zu verbreiten<br />
und zu beschützen. Es handelt sich<br />
hier um eine ganz bestimmte Art von Kolonisierung,<br />
nämlich jener des Mittelalters<br />
durch die Renaissance. Diese Art kultureller<br />
«Kolonisierung» führt zur Neukonzeption<br />
und Neuerfindung des mittelalterlichen<br />
Reisenden als eines heimlichen oder<br />
unheimlichen Doppelgängers aus der Vergangenheit.<br />
Die sich herausbildende Nationalidentität<br />
wird durch diesen Doppelgänger<br />
einerseits legitimiert, andererseits<br />
gelegentlich aber auch bedroht.<br />
Die heilige Helena<br />
Ein eindrückliches Beispiel für diese Kolonisierung<br />
der Vergangenheit findet sich<br />
im ersten Eintrag, welcher fast beiläufig<br />
die Reise von Konstantins Mutter, der britisch<br />
geborenen Heiligen Helena, nach<br />
Jerusalem erwähnt. Diese Beiläufigkeit<br />
überrascht, bedenkt man, dass die heilige<br />
Helena durch das Mittelalter hindurch vor<br />
allem wegen des Auffindens des Wahren<br />
Kreuzes im Heiligen Land verehrt wurde.<br />
Noch überraschender ist demgegenüber<br />
die stark betonte Darstellung dieser Hei-<br />
36 UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />
Abb. 2: Titelblatt einer Populärausgabe<br />
von Hakluyts Werk aus<br />
dem Jahre 1928.<br />
ligen als eine gelehrte Kaiserstochter, die<br />
eine unheimliche Ähnlichkeit mit einer<br />
gewissen Tudor-Königin auf dem englischen<br />
Thron zur Zeit der «Principall Navigations»<br />
aufweist. Von Helena wird gesagt,<br />
dass sie alle ihre Zeitgenossinnen an<br />
Kenntnissen der freien Künste, an musikalischem<br />
Geschick, an Sprachgewandtheit<br />
übertreffe. Ihre hervorragende Erziehung<br />
verdanke sie dem Umstand, dass sie die<br />
einzige legitime Thronnachfolgerin gewesen<br />
sei. Schliesslich wird sie weiter als Autorin<br />
zahlreicher Bücher und griechischer<br />
Gedichte dargestellt.<br />
Diese «Stammmutter der Reisenden» teilt<br />
mit frühen Protagonisten der Reiseberichte<br />
Hakluyts die Eigenschaft, dass sie<br />
sich als gelehrte Vielsprachige, übrigens<br />
genauso wie der Renaissance-Autor Hakluyt<br />
selbst, mit der Arbeit des Studierens,<br />
Schreibens und Übersetzens beschäftigt.<br />
Viele der Reisenden sind zudem anachronistischerweise<br />
als <strong>Universität</strong>sgebildete<br />
dargestellt: Hakluyt selbst hatte in Oxford<br />
Theologie studiert.<br />
Kollektives Identitätsbewusstein<br />
In dieser Zeit des Übergangs von Mittel-<br />
alter zu Renaissance entwickelten die Engländer<br />
ein kollektives Identitätsbewusst-<br />
sein, das mehr als je zuvor mit der geographischen<br />
Tatsache zu tun hatte, dass<br />
sie sich auf einer Insel befanden, und dass<br />
dementsprechend für jeglichen Kontakt<br />
mit anderen Ländern (sei es zwecks Handel,<br />
Landesverteidigung oder Territorialgewinn)<br />
die Seefahrt unentbehrlich war.<br />
Kein Wunder, dass des Nationalhistorikers<br />
Projekt, England als Seemacht aufzubauen,<br />
auf dem Sammeln, Übersetzen und<br />
der Neugestaltung von früheren Diskursen<br />
beruht, die fähig sind, «die Anfänge, Ursprünge<br />
und das Wachstum der Seefahrt<br />
dieser Insel» zu dokumentieren. 2 Die von<br />
Hakluyt aufgeführten mittelalterlichen<br />
Reisenden und Seefahrer liefern letztlich<br />
eine Genealogie für eine Nation, die sich<br />
spätestens seit der Renaissance als Reise-<br />
und Handelsnation versteht.<br />
Prof. Dr. Margaret Bridges<br />
Institut für Englische Sprache<br />
und Literaturen<br />
2 Von Hakluyts «Principall Navigations» ist keine<br />
vollständige Ausgabe, welche akademische Ansprüche<br />
erfüllt, vorhanden. Eine im Penguin Verlag<br />
erhältliche Auswahl der von Hakluyt gesammelten<br />
Schriften (ohne Erläuterungen) ist 1972 von<br />
Jack Beeching herausgegeben worden. Siehe ferner:<br />
Quinn, D. B. et al., eds. «Principall Navigations.<br />
Facsimile edition for the Hakluyt Society and the<br />
Peabody Museum of Salem». Cambridge, 1965.
Ein Lexikon der Sprichwörter des romanisch-germanischen Mittelalters<br />
Thesaurus proverbiorum<br />
medii aevi<br />
Der Thesaurus proverbiorum medii aevi ist ein Lexikon<br />
der Sprichwörter des romanisch-germanischen Mittelalters<br />
und ein einzigartiges Werk, weil es Materialien aus<br />
zahlreichen Sprachgebieten und einer langen Epoche<br />
enthält. Es sollte nach der Absicht des Gründers, des <strong>Bern</strong>er<br />
Altgermanisten Samuel Singer, mehr als ein blosses Nachschlagewerk<br />
sein.<br />
Samuel Singer (1860–1948), der über den<br />
altgermanistischen Bereich hinaus weite<br />
Kenntnisse in anderen Sprachen und Epochen<br />
hatte, wollte mit seinem Thesaurus<br />
mittelalterlicher Sprichwörter einen Beitrag<br />
leisten zu einer «Weltliteratur» im<br />
goetheschen Sinn. Das Resultat sollte<br />
«mehr als blosses Nachschlagewerk» sein,<br />
«denn, wenn mit weltliterarischer Betrachtungsweise<br />
Ernst gemacht werden soll, so<br />
wird diese sich zuerst den kleinen Dichtungsarten<br />
der Sprichwörter, Rätsel, Anekdoten,<br />
etc. zuwenden, an denen sich wegen<br />
ihrer leichteren Überschaubarkeit<br />
und ihrer Ubiquität die Einheitlichkeit<br />
menschlicher oder wenigstens eurasischer<br />
Denk- und Empfindungsart am Bes-<br />
ten aufzeigen und untersuchen lässt». Die<br />
Einheitlichkeit der mittelalterlichen Geisteswelt,<br />
«auf die gleiche christliche Religion<br />
gegründet, durch die gleiche lateinische<br />
Sprache und Bildung überbaut, an<br />
die antike Humanität angeschlossen», galt<br />
Singer als beispielhaft für die Überwindung<br />
nationalistischer Beschränktheit, wie<br />
sie zur Zeit des Zweiten Weltkrieges nicht<br />
nur in Politik und Öffentlichkeit, sondern<br />
auch in gewissen wissenschaftlichen Positionen<br />
unheilvoll wirksam war.<br />
Bildungstradition<br />
Dieses singer’sche Grundkonzept ist im<br />
Lexikon vielfach dokumentiert, vornehmlich<br />
in Fällen, wo gut erkennbare Tradi-<br />
Auf dem Gemälde «Die holländischen Sprichwörter» des Malers Pieter Bruegel d. Ä. sind<br />
über 100 Sprichwörter dargestellt.<br />
tionen mit biblischem oder antik griechischem<br />
und lateinischem Ursprung in einer<br />
Reihe von mittelalterlichen Sprachen weiterleben.<br />
Daneben treibt aber auch die<br />
Phantasie der verschiedenen Sprachregionen,<br />
unbeeinflusst von Bildungstraditionen,<br />
ihre Blüten. Ein Ausdruck von<br />
spontaner Lebenserfahrung und Sprachwitz,<br />
wie ihn Samuel Singer, der nicht<br />
nur ein seriöser Gelehrter, sondern auch<br />
ein Geniesser, Freund von Volkstümlichem<br />
und Sinnlichem und Liebhaber von<br />
Frauen und Katzen war, mit Bestimmtheit<br />
geschätzt hat.<br />
Die Vielfalt der Inhalte, die in Sprichwörtern<br />
thematisiert werden, spiegelt sich in<br />
einer bunten Fülle des Ausdrucks. Während<br />
menschliches Verhalten im weitesten<br />
Sinn als ein gemeinsamer Nenner<br />
sprichwörtlicher Rede gelten kann, sind<br />
die konkreten Ausgestaltungen der jeweiligen<br />
Themen auf einer breiten Skala angesiedelt.<br />
Sie reichen von abstrakten Sprüchen<br />
wie etwa Errare humanum est «Irren<br />
ist menschlich» über Formulierungen mit<br />
einzelnen bildlichen Elementen bis hin zu<br />
völlig verschlüsselten Aussagen. Nicht selten<br />
sind Beobachtungen an Tieren Hintergrund<br />
für Anweisungen oder Warnungen,<br />
die sich an Menschen richten, so<br />
etwa im Sprichwort Oveja que bala, bocado<br />
pierde «Das Schaf, das blökt, verliert<br />
den Bissen».<br />
Die Parallelisierung von Tier und Mensch<br />
oder die Chiffrierung menschlichen Verhaltens<br />
in Tierfabeln hat andererseits eine<br />
lange Tradition, die in die Antike zurückreicht.<br />
Diese Tradition erzeugt Sprichwörter<br />
in den verschiedenen romanischen und<br />
germanischen Ländern. Im Artikel WOLF<br />
z. B. gibt es eine Menge Material zum<br />
Thema «Unverbesserlichkeit des Menschen»,<br />
das an die Erzählung vom Wolf<br />
anknüpft, der ein Mönch werden wollte<br />
und zur Schule ging, aber nicht von seinem<br />
Hauptinteresse, dem Verzehr des<br />
Lamms, abzubringen war. Von den zum<br />
Thema «Unverbesserlichkeit des Wolfes»<br />
in zahlreichen Sprachen verbreiteten<br />
UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />
37
Sprichwörtern, die dieses Motiv variieren,<br />
ein Beispiel aus dem Altnordischen: Si lupus<br />
instruitur in numen credere magnum<br />
Semper dirigitur ab eo respectus ad agnum.<br />
– Kaendh wlff pater noster han syr<br />
alth lam lam «Wenn der Wolf gelehrt wird,<br />
an die grosse göttliche Macht zu glauben,<br />
dann wird von ihm immer der Blick auf<br />
das Lamm gerichtet. – Lehrt den Wolf<br />
das Paternoster: er sagt immer ‚Lamm,<br />
Lamm‘».<br />
Wortspiele und Grundmuster<br />
Zuweilen besteht die Prägnanz einer sprichwörtlichen<br />
Formulierung in einem an die betreffende<br />
Einzelsprache gebundenen Wortspiel:<br />
Het ich ist ein boeser vogel Habich<br />
ist ein guter «‚Hätte ich‘ ist ein böser Vogel,<br />
‚Habe ich‘ ein guter». Personifizierung<br />
einzelsprachlich geläufiger Redewendungen<br />
(Syntagmen) ist nicht selten: Getrow<br />
wol den hengst hin reit «Trauwohl ritt den<br />
Hengst weg»; Haddywyst cometh euer to<br />
late «‚Hätte ich gewusst‘ kommt immer<br />
zu spät». Ähnlich ist die Substantivierung<br />
einer Verbform in einem Sprichwort,<br />
das vor allem im Französischen äusserst<br />
gut belegt ist: Mieuz vaut uns ‚tien‘ que<br />
dous ‚tu l’avras‘ «Mehr wert ist ein ‚da<br />
hast du‘ als zwei ‚du wirst haben‘». Vielfach<br />
findet sich ein Inhalt, der Sprichwörtern<br />
zugrunde liegt, in verschiedenen Sprachen,<br />
wobei einzelne Elemente je nach der<br />
Herkunftsregion variieren können. So ist<br />
das beim Typus «Ein Individuum mit bestimmten<br />
negativen Eigenschaften hält einem<br />
anderen, das dieselben Eigenschaften<br />
hat, seine Fehler vor» in einigen Sprachen<br />
der Esel der Täter, wie im heute noch geläufigen<br />
deutschen Sprichwort «Ein Esel<br />
schimpft den anderen Langohr». Oder:<br />
Dixo el asno al mulo: Tira alla orejudo<br />
«Der Esel sagte zum Maultier: Pack dich,<br />
Langohr!». Im Altnordischen ist es der<br />
Troll, der seinen Artgenossen beschimpft:<br />
Hvert trollit tryller annad «Jeder Troll<br />
schilt den andern Troll».<br />
Die Musterkarte könnte nach Belieben<br />
fortgesetzt werden. Es wäre auch reizvoll,<br />
den Grundmustern nachzugehen, die einer<br />
Grosszahl von Sprichwörtern zugrundeliegen.<br />
Elementare Denkfiguren wie Gegensatz<br />
und Vergleich nehmen eine zentrale<br />
Stellung ein, Zahlenverhältnisse spielen<br />
eine wichtige Rolle. Das reichhaltige Material<br />
des Thesaurus lädt dazu ein, dieser<br />
und anderen Fragen nachzugehen.<br />
38 UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />
Eine Seite aus<br />
dem Thesau -<br />
rus Singer.<br />
(WOLF, Thesaurus<br />
Band 13, S. 178)<br />
Überblickt man die Fülle des Materials,<br />
das in den 13 Bänden verarbeitet ist, bleibt<br />
der Eindruck von viel Wiederkehrendem<br />
und Parallelem, aber auch einer Menge heterogener<br />
Einzelheiten zurück. Dies hängt<br />
einerseits mit der Masse von Belegen aus<br />
verschiedenen Sprachen, verschiedenen<br />
Zeiten und verschiedenen Traditionen zusammen,<br />
andererseits auch mit dem weiten<br />
Sprichwortbegriff, den Samuel Singer<br />
seiner Sammlung zugrunde legte: Er überschritt<br />
die Grenze dessen, was gemeinhin<br />
als Sprichwort 1 betrachtet wird, sowohl<br />
nach unten als auch nach oben: nach unten<br />
durch die Aufnahme sprichwörtlicher Redensarten<br />
und fester Fügungen, die im Extremfall<br />
auf ein einziges Wort beschränkt<br />
sind, nach oben durch den Einbezug von<br />
satzübergreifenden Texten, Sprüchen oder<br />
Kurzdialogen.<br />
1 Ein Sprichwort ist ein festgeprägter, syntaktisch unabhängiger<br />
Satz.<br />
«Sie trägt Wasser in der einen und Feuer<br />
in der andern Hand»; sie verdient kein<br />
Vertrauen.
«Er schägt mit dem Kopf gegen die Wand»;<br />
Er ist vergebens eigensinnig.<br />
Schatztruhe des Mittelalters<br />
Es versteht sich von selbst, dass ein Werk<br />
von der Art des Thesaurus Singer, von einem<br />
Einzelnen konzipiert und in jahrzehntelanger<br />
Arbeit, mit etlichen Unterbrüchen,<br />
von zahlreichen Bearbeitern zu Ende geführt,<br />
seine Mängel hat. Der gravierendste<br />
ist wohl die ungleiche Ausschöpfung der<br />
Quellen. Die Redaktion, die für die definitive<br />
Fassung verantwortlich ist, hat sich<br />
jedoch dazu entschlossen, im Wesentlichen<br />
das von Singer gesammelte Material<br />
zu publizieren. Eine systematische Ergänzung<br />
hätte zu einer jahre-, wenn nicht<br />
jahrzehntelangen Verzögerung des Abschlusses<br />
geführt. Auch in seiner jetzigen<br />
Form wird der Thesaurus proverbiorum<br />
medii aevi für Forschungen in vielen Disziplinen<br />
ein wertvolles Arbeitsinstrument<br />
sein. Literatur- und Sprachwissenschafter,<br />
aber auch Historiker, Rechtshistoriker<br />
und Ethnologen werden verschiedene<br />
Fragestellungen an das Sprichwortlexikon<br />
herantragen. Und nicht zuletzt ist der<br />
Thesaurus eine Fundgrube oder eben eine<br />
Schatztruhe für jedermann, der sich für die<br />
Kultur und das Leben des Mittelalters interessiert.<br />
Prof. Dr. Ricarda Liver<br />
Ginsberg<br />
3432 Lützelflüh<br />
Thesaurus proverbiorum medii aevi. Lexikon der<br />
Sprichwörter des romanisch-germanischen Mittel-<br />
alters. Begründet von Samuel Singer. Hrsg. Kurato-<br />
rium Singer der Schweiz. Akademie der Geistes- und<br />
Sozialwissenschaften, Berlin/New York (Walter de<br />
Gruyter). 13 Bde. + 1 Quellenband.<br />
Thesaurus proverbiorum medii aevi<br />
Im Januar 2002 ist der 13. und letzte<br />
Band des umfangreichen Sprichwort-<br />
Lexikons erschienen, das in der ersten<br />
Hälfte des vergangenen Jahrhunderts<br />
vom <strong>Bern</strong>er Altgermanisten Samuel<br />
Singer begründet worden war und<br />
nach einer langen und wechselvollen<br />
Entstehungsgschichte, in den Jahren<br />
1995 bis 2002 bei de Gruyter<br />
in Berlin gedruckt wurde. Zu den 13<br />
Bänden, die das Material präsentieren,<br />
kommt noch ein Quellenband, der<br />
die Zitate aufschlüsselt und über neuere<br />
Literatur zu den vielfach in alten<br />
Ausgaben zitieren Texten orientiert.<br />
Der Thesaurus Singer, wie das Werk<br />
im Hausgebrauch genannt wird, ist in<br />
mancher Hinsicht ein Unikum. Singer hatte für den Begriff «Mittelalter» die Zeitspanne<br />
von 500 bis 1500 festgelegt, wobei gewisse Grenzüberschreitungen<br />
nicht ausgeschlossen waren. Vor allem der Endpunkt wird vielfach überschritten,<br />
da zahlreiche Quellen des 16. Jahrhunderts, die älteres Sprichwortgut enthalten,<br />
mit einbezogen sind.<br />
Die Sprachen, die im Lexikon vorkommen, sind sämtliche romanischen und germanischen<br />
Sprachen, aus denen schriftliche Zeugnisse aus dem Mittelalter überliefert<br />
sind. Entsprechend fehlen aus dem heutigen Kanon der romanischen Sprachen<br />
das Rumänische und das Rätoromanische, wo die Schrifttradition erst im<br />
16. Jahrhundert einsetzt. Vertreten sind jedoch Französisch, Provenzalisch, Katalanisch,<br />
Spanisch, Portugiesisch. Im germanischen Bereich sind es Altnordisch,<br />
v. a. Isländisch und Dänisch, seltener Schwedisch, Englisch, Niederländisch<br />
und Deutsch. Ferner sind mittellateinische und mittelgriechische Sprichwörter einbezogen.<br />
Wo immer möglich, werden die Quellen der mittelalterlichen Sprichwörter<br />
aus der Antike (klassisches Latein und klassisches Griechisch) an den<br />
Anfang gestellt. Eine besonders gewichtige Quelle ist die Bibel, die in der lateinischen<br />
Übersetzung des Hieronymus (Vulgata) zitiert wird, gefolgt von der<br />
deutschen Version Martin Luthers. Dieses Inventar ergibt eine Gesamtzahl von<br />
12 oder 14 Sprachen, je nachdem, ob man das Altnordische als eine einzige<br />
oder als drei Sprachen zählt.<br />
Angesichts dieser Vielfalt, die noch zusätzlich durch markant voneinander abweichende<br />
Sprachstufen (Altfranzösisch und Mittelfranzösisch, Altenglisch und<br />
Mittelenglisch, Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch und Frühneuhochdeutsch) kompliziert<br />
wird, entschlossen sich die Bearbeiter, jedes Sprichwort, das zunächst<br />
im Originaltext wiedergegeben wird, auch in modernes Deutsch zu übersetzen.<br />
Die ursprüngliche Konzeption Singers, wonach die Sprichwörter unter deutschen<br />
Titelstichwörtern alphabetisch geordneten Artikeln zugeteilt werden sollten, wurde<br />
beibehalten. Dagegen verzichtete man aus leicht nachvollziehbaren Gründen auf<br />
das an sich sinnvolle Vorhaben Singers, einzelne Sprichwörter mehrfach, d. h. in<br />
verschiedenen Artikeln, aufzunehmen, also z. B. «Alle Wege führen nach Rom»<br />
unter ALL, WEG und ROM. Stattdessen wurde ein differenziertes System von<br />
Querverweisen eingeführt, das erlaubt, die von Singer anvisierten Zusammenhänge<br />
herzustellen. Der Umfang der Artikel ist höchst unterschiedlich. Er reicht<br />
von einem blossen Verweis oder einem einzigen Sprichwort bis zu umfangreichen<br />
Artikeln wie etwa FRAU, 1818 Sprichwörter, 127 Seiten; GOTT, 1443<br />
Sprichwörter, 84 Seiten oder LIEBE, 1630 Sprichwörter, 88 Seiten.<br />
UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />
39
Minnesang der Stauferzeit<br />
Höfische Liebeskunst<br />
als Gesellschaftsspiel<br />
Minnesang ist Gesellschaftskunst. In ihm wird das Wertesystem<br />
der alteuropäischen Adelskultur zelebriert. Er<br />
inszeniert die Liebe als Erfahrungs- und Bewährungsfeld<br />
ästhetisch-ethischer Normen. Doch diese schwerblütige<br />
Erhabenheit wird bald vom ausgelassenen Gegengesang<br />
entzaubert.<br />
Her Walther von der Vogelweide:<br />
Swer des vergêze der tête mir leide:<br />
Alein er wêre niht rîch des guotes,<br />
Doch was er rîch sinniges muotes.<br />
Mit diesen Worten erinnerte drei Generationen<br />
nach dem Tode Walthers der Bamberger<br />
Schulrektor Hugo von Trimberg an<br />
einen der grössten Lyriker deutscher Sprache.<br />
Aber wie könnte man dieses ständig<br />
am Hungertuch nagende Genie der Poesie,<br />
den Schöpfer nobler und mutiger Gedanken,<br />
je dem Vergessen anheim geben,<br />
Walther von der Vogelweide, der wie<br />
kein zweiter Zugang hatte zur Gedankenwelt<br />
der Staufer und gewiss auch zu ihren<br />
Schatzmeistern! Für König Philipp von<br />
Schwaben (1198–1208) tritt er ebenso auf<br />
die politische Bühne wie für dessen jungen<br />
Neffen, den grossen Kaiser Friedrich<br />
II. (1212–1250) – und zwischendurch auch<br />
mal für den welfischen Gegenspieler Otto<br />
IV. von Braunschweig (1198–1218). Aber<br />
wer wollte ihn dafür tadeln, wo doch sogar<br />
der Papst die Fronten wechselte und<br />
ein Poet keine Pfründen besass, sondern<br />
nur das Brot des Gönners, dessen Lied<br />
er sang.<br />
Walther schuf Klanggebilde der verschiedensten<br />
Art und mit den unterschiedlichsten<br />
Themen: das fromme Lob des dreifaltigen<br />
Gottes und der Gottesmutter Maria;<br />
der verwirrende Zauber unnahbarer weiblicher<br />
Schönheit; die verträumte Zärtlichkeit<br />
des liebenden Mädchens; der<br />
bohrende Schmerz des abgewiesenen<br />
Liebhabers; die reuevolle Sorge um das<br />
eigene Seelenheil; die zehrende Melancholie<br />
des altgewordenen Mannes; aber<br />
40 UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />
auch: die scharfe Attacke gegen die skandalösen<br />
Missstände im Reich und in der<br />
Kirche; der politische Aufruf zu Umkehr<br />
und Erneuerung.<br />
Imperiale Poesie<br />
Die staufische Aristokratie feierte sich<br />
selbst, wenn sie bei glanzvollen Festen ihren<br />
höfischen Lebensstil zur Schau trug.<br />
Dann blühte sie auf im raffinierten Spiel<br />
mit den ästhetischen Erfahrungen, die der<br />
Die Insignien der<br />
Macht und das<br />
Schriftband präsentieren<br />
Heinrich VI.<br />
als Herrscher und<br />
Autor in der Tradition<br />
des Dichterkönigs<br />
David.<br />
Kult der unerreichbaren Dame auslöste.<br />
Die existentielle Gewalt der Minne, die<br />
gerade im zelebrierten Verzicht auf den<br />
sexuellen Vollzug erotische Kräfte und<br />
spirituelle Energien freisetzte, bildete<br />
das Lieblingsthema dieser hochkultivierten<br />
Rittergesellschaft. Heinrich VI. (1190<br />
bis 1197), der Sohn Friedrich Barbarossas,<br />
hat sich selber als Minnesänger betätigt.<br />
Zu Recht eröffnet daher sein Bildnis die<br />
berühmte Manessische Liederhandschrift<br />
aus Zürich, heute in Heidelberg.<br />
Der Kaiser spricht in einem seiner Gedichte<br />
von einer Liebeserfahrung, die ihn<br />
seine ganze weltliche Macht vergessen<br />
lässt. Immer wenn er von dieser einen Frau<br />
Abschied nehmen müsse, hülfen ihm Herrschaft<br />
und Reichtum nicht das geringste,<br />
um seinen Sehnsuchtsschmerz loszuwerden.<br />
Diese Liebe bedeute ihm so viel, dass<br />
er nicht von ihr lassen könne:
ê ich mich ir verzige, ich verzige mich ê<br />
der krône.<br />
Bevor ich auf sie verzichte, verzichte ich<br />
lieber auf die Krone.<br />
Grosse Worte eines Kaisers, dem es die<br />
Wirklichkeit ersparte, die Probe auf sein<br />
rhetorisches Exempel machen zu müssen.<br />
Nicht die Minne zwang ihn zur Abdankung,<br />
sondern der Tod, der ihn 32-jährig<br />
in Messina ereilte, als er mit den Vorbereitungen<br />
zu seinem Kreuzzug beschäftigt<br />
war. Den Staufern lag die Minne nicht allein<br />
auf der Zunge, sondern auch im Blut.<br />
Der Barbarossa-Enkel, Kaiser Friedrich II.,<br />
führte nicht nur vier Frauen, die ihm zusammen<br />
zehn Kinder schenkten, zu politisch<br />
motivierten Ehen heim; er hatte auch<br />
noch mindestens acht aussereheliche Beziehungen,<br />
aus denen wenigstens neun<br />
weitere Kinder hervorgingen. Verständlich,<br />
dass dieser Kaiser, der an seinem<br />
sizilischen Hof die Dichterelite der Zeit<br />
um sich scharte, auch in der literarischen<br />
Liebesmode mit gutem Beispiel vorangehen<br />
wollte. Als «Kind Apuliens» tat er es<br />
nicht im strengen Mittelhochdeutsch seiner<br />
schwäbischen Vorfahren, sondern im<br />
melodiösen Italienisch seiner apulisch-sizilischen<br />
Heimat:<br />
Oi lasso! non pensai<br />
sì forte mi parisse<br />
lo dipartire da madonna mia.<br />
O weh, ich dachte nicht,<br />
dass es mich so hart ankäme,<br />
das Fortziehn von meiner Herrin.<br />
Wer dem weltmännischen Friedrich – «von<br />
Gottes Gnaden immer erhabener Kaiser<br />
der Römer, König von Jerusalem und Sizilien»<br />
– seine Not nicht glauben wollte,<br />
hätte den intellektuell-erotischen Witz und<br />
die schmachtende Reflexion dieser poesievollen<br />
Spielkunst nicht verstanden. Sieger<br />
blieb hier immer der, dem ein neuer dichterischer<br />
Einfall gelang, der für sein Publikum<br />
das Vertraute in aparten neuen Varianten<br />
präsentierte, so dass es sogar in der<br />
scheinbar ewigen Monotonie von Liebesfreud<br />
und Liebesleid immer wieder von<br />
neuem knisterte und unerwartete Funken<br />
sprühten.<br />
Betörende Lieder<br />
Kenner waren es, die in den staufischen<br />
Residenzen und Pfalzen zum Vortrag der<br />
Sänger beisammen sassen. Dann konnte<br />
sich jener kostbare Augenblick höchsten<br />
Kunstgenusses einstellen, wenn die Meister<br />
ihres Faches auftraten. Die Wirkung,<br />
die sie mit ihren Kompositionen erzielten,<br />
beschreibt Gottfried von Strassburg in seinem<br />
Tristanroman: Als Tristan zur Harfe<br />
griff und die alten Weisen von lieb unde<br />
leit so ganz neu intonierte, da geschah es,<br />
daz maneger da stuont unde saz,<br />
der sin selbes namen vergaz:<br />
da begunden herze und oren<br />
tumben unde toren<br />
und uz ir rehte wanken;<br />
da wurden gedanken<br />
in maneger wise vür braht.<br />
Mancher stand und sass<br />
ganz selbstvergessen da;<br />
Herz und Ohr<br />
gerieten ausser sich<br />
und kamen ab von altgewohnter Bahn.<br />
Vielfache Gedankenbilder<br />
stellten sich ein.<br />
Gottfried traut dem Minnesang geradezu<br />
therapeutische Wirkungen zu: Erklängen<br />
die lieblichen Sommerlieder des neuen<br />
Orpheus Reinmar von Hagenau oder Walthers<br />
von der Vogelweide nicht, so sagt er,<br />
dann gäbe es keine Hochgestimmtheit in<br />
der Welt. Apathisch und antriebslos lebten<br />
die Menschen dahin. Denn Wort und<br />
Weise dieser wundersamen Poesie bringen<br />
UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />
Im Rosenhag beschwört<br />
der Gestus der ineinander<br />
gelegten Hände die Minneharmonie<br />
zwischen dem Ritter<br />
<strong>Bern</strong>ger von Horheim und<br />
seiner Dame.<br />
in jedem, der jemals der Liebe zugewandt<br />
war, das Gute zum Schwingen, setzen Gefühle<br />
frei, die das Herz mit Sanftmut erfüllen.<br />
Eine gelöste Stimmung breitet sich aus<br />
und führt zu meditativer Versenkung.<br />
Seelische Zerreissproben<br />
<strong>Bern</strong>ger von Horheim, bezeugt in zwei italienischen<br />
Urkunden Philipps von Schwaben,<br />
beschwört in seiner Minneklage eine<br />
absolute Liebe, die in ihrer radikalen Hingabe<br />
sogar die legendäre Leidenschaft<br />
Tristans und Isoldes übertrifft; und dies,<br />
obwohl der Liebende bei <strong>Bern</strong>ger nicht<br />
von jenem Minnetrank gekostet hat, der<br />
Tristan und Isolde rettungslos einander<br />
auslieferte. Tatsächlich ist die seelische<br />
Situation dieses Liebenden noch verzweifelter<br />
als die Not Tristans. Denn Isolde gab<br />
sich Tristan hin, während hier eine Treue<br />
besungen wird, die auf Dauer im entsagungsvollen<br />
Verzicht ausharrt:<br />
doch singe ich, swie ez darumbe ergât,<br />
und klage, daz sî mich trûren lât.<br />
Doch sing’ ich, wie’s auch kommen mag,<br />
und klag’, dass sie mich trauern lässt.<br />
Welch tiefen Konflikt die Ritterpflicht herbeiführen<br />
kann, macht der zwischen Bingen<br />
und Mannheim ansässige Friedrich<br />
von Hausen, der hochangesehene Ministeriale<br />
Kaiser Friedrich Barbarossas, zum<br />
41
Thema eines ergreifenden Minneliedes.<br />
Den Liebenden muss es zerreissen, wenn<br />
er zum Kreuzzug aufbrechen soll, um gegen<br />
die Heiden zu kämpfen, und die verehrte<br />
Dame zurücklassen muss, die seinem<br />
Herzen so nahe ist. Den Minneritter, der<br />
zugleich ein zum Kampf entschlossener<br />
Kreuzritter sein will, quält es unsäglich,<br />
dass Leib und Herz, also seine soldatischchristliche<br />
und seine ästhetisch-erotische<br />
Existenzform, sich jetzt nicht mehr werden<br />
zur Deckung bringen lassen, wenn Gott<br />
nicht eingreift:<br />
Mîn herze und mîn lîp diu wellent scheiden,<br />
diu mit ein ander wâren nu manige zît.<br />
der lîp wil gerne vehten an die heiden,<br />
sô hât iedoch daz herze erwelt ein wîp<br />
Vor al der welt. daz müet mich iemer sît,<br />
daz siu ein ander niht volgent beide.<br />
mir habent diu ougen vil getân ze leide.<br />
got eine müese scheiden noch den strît.<br />
Mein Herz und mein Leib wollen sich<br />
scheiden,<br />
die beisammen waren nun schon lange<br />
Zeit.<br />
Der Leib möchte kämpfen gegen die Heiden,<br />
das Herz jedoch hat eine Frau erwählt<br />
vor aller Welt. Das schmerzt mich seither<br />
unaufhörlich,<br />
dass beide einander nicht mehr Folge<br />
leisten.<br />
Mir haben die Augen viel Leids getan.<br />
Gott allein könnte diesen Zwiespalt noch<br />
aufheben.<br />
Am 6. Mai 1190, wenige Wochen vor dem<br />
Tode seines Kaisers, ist Friedrich von Hausen<br />
auf dem dritten Kreuzzug bei Philomelium,<br />
dem heutigen Akschehir in Anatolien,<br />
gefallen.<br />
Gegengesänge<br />
Man besässe ein ziemlich einseitiges<br />
Bild von der Lyrik des staufischen Mittelalters,<br />
wäre man nur von dem Goldgrund<br />
fasziniert, auf dem sich die hehrsten<br />
Gedanken, die edelsten Gefühle, die<br />
ernstesten Pflichten und die würdevollsten<br />
Aufgaben ein elegantes Stelldichein<br />
geben. Schon Wolfram von Eschenbach,<br />
der berühmte Autor des Parzivalromans,<br />
hat hier humorvoll wider den Stachel vom<br />
Minnepathos gelökt und mit seinem Publikum<br />
manchen Schabernack getrieben, sei<br />
es, dass er die schlanke Taille eines adli-<br />
42 UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />
Der Kreuzfahrer Friedrich von Hausen<br />
sinniert über die Gefahren der Expedition.<br />
gen Fräuleins mit einer Ameise oder einem<br />
Hasen am Spiess verglich oder mitten<br />
am Karfreitag die Töchter eines barfuss<br />
im Schnee pilgernden Ritters mit Parzival<br />
flirten liess, was der Dichter mit den<br />
Worten kommentiert:<br />
wîp sint et immer wîp:<br />
werlîches mannes lîp<br />
hânt si schier betwungen:<br />
in ist dicke alsus gelungen.<br />
Frauen bleiben halt immer Frauen.<br />
Auch den abwehrbereiten Mann<br />
haben sie schnell bezwungen.<br />
Das ist ihnen schon oft gelungen.<br />
Über den vielbeschworenen, scheinbar so<br />
idealistischen Minnedienst nobler Frauenverehrer<br />
macht sich Wolfram nicht die geringsten<br />
Illusionen. Seine Ehefrau, so sagt<br />
er, hätte er nicht ins grosse Gedränge der<br />
Feste bei König Artus gelassen, wo mancher<br />
ihr zugeflötet hätte, dass seine Liebe<br />
zu ihr ihm zusetze und seine Lebensfreude<br />
verdunkle. Bevor ihr der Galan immerwährenden<br />
Minnedienst angeboten hätte,<br />
wenn sie ihn nur aus seiner Liebesqual erlösen<br />
wollte, hätte er, Wolfram, sich mit<br />
seiner Frau eiligst davongemacht.<br />
In der späten Stauferzeit wird die Liebespoesie<br />
ausgelassen. Neidhart von Reuenthal<br />
und der Tannhäuser schätzen den<br />
Tiefgang ihrer klassischen Vorgänger nur<br />
noch insofern, als er sich, wie alles Erhabene,<br />
trefflich karikieren und parodieren<br />
lässt: Man nehme einen Natureingang,<br />
stelle ihn an den Beginn des Liedes und signalisiere<br />
damit, dass bei Frühlingsblüte<br />
und Vogelgezwitscher die Minne nicht<br />
mehr weit sein kann. Dann lande man<br />
einen literarischen Coup, mache aus der<br />
distanzierten edlen Dame ein triebhaftes<br />
Bauernmägdlein und bringe als moralische<br />
Instanz für Sitte und Ordnung dessen<br />
eigene Mutter ins Spiel. Diese möchte<br />
ihrer Tochter den Jungbauer von nebenan<br />
als standesgemässe Partie ans Herz legen,<br />
doch das Töchterchen hat Höheres<br />
im Sinne, verschwiegene Minne nämlich<br />
zu einem stolzen Ritter – ich minne einen<br />
stolzen ritter also tougen – und nicht die<br />
Heirat mit dem bäurischen Nachbarn. Das<br />
Mädchen setzt ganz auf die Ritterkarte.<br />
Und die Leute werden schon noch merken,<br />
dass sein Sinn strebt gein Riuwental.<br />
Da konnte ein höfisches Publikum – und<br />
nur für ein solches komponierte Neidhart<br />
von Reuenthal – sich köstlich amüsieren.<br />
Wie unmöglich es war, Minne in Mesalliancen<br />
zu pflegen, das kannte man aus<br />
dem Leben ebenso gut wie aus der Literatur.<br />
Dieser Tausendsassa von Neidhart,<br />
kokettierte der auf minnesängerischem<br />
Klavier mit der Schnulze, dass ein Bauernmädchen<br />
hinter ihm her sei, wo doch<br />
jeder wusste, wohin eine solche Affäre im<br />
Ernst führen würde: nämlich direkt «zum<br />
Reuenthal» – ins Jammertal.<br />
Und erst der Tannhäuser! Wenn seine<br />
Tanzlieder erklingen, dann ist das dort verherrlichte<br />
Weib noch bezzer danne guot.<br />
An dieses Frauenzimmer, so schön und<br />
Abschied und Trennung von der Minneherrin:<br />
der Reichsschenk von Limburg.
hochgesinnt und so integer wie die ideale<br />
Minnedame, reicht keine Isolde, Juno oder<br />
Helena heran. Der Dichter trumpft auf mit<br />
einer Revue aller Traumfrauen aus Literatur<br />
und Mythologie, um dann abrupt seinen<br />
respektablen Katalog, dieses alte Zeug,<br />
zu beenden und den Blick auf seine eigene,<br />
für die Minne wie geschaffene Tanzpartnerin<br />
zu lenken, die schönste Frau der ganzen<br />
Welt:<br />
Von Oriende unz z’Occidende wart<br />
nie schoener wip geborn.<br />
Augenzwinkernd geht der Sängerdichter<br />
sogar noch in die Details, schwärmt von<br />
der Vollkommenheit ihrer drallen Proportionen,<br />
phantasiert von einem abwärts ge-<br />
Des Tannhäusers Lied von der Vergeblichkeit männlicher Hoffnungen und<br />
von der Unerfüllbarkeit weiblicher Bedingungen<br />
Staeter dienest der ist guot,<br />
den man schoenen frouwen tuot,<br />
als ich miner han getan.<br />
der muoz ich den salamander bringen.<br />
Einez hat si mir geboten,<br />
daz ich schicke ir abe den Roten<br />
hin von Provenz in daz lant<br />
ze Nüerenberc, so mac mir wol gelingen,<br />
Und die Tuonouw über Rin;<br />
füege ich daz, so tuot si, swes ich muote.<br />
danc so habe diu frouwe min,<br />
sist geheizen Guote.<br />
spriche ich ja, si sprichet nein,<br />
sus so hellen wir enein.<br />
heia hei!<br />
sist ze lange gewesen uz miner huote.<br />
Ein boum stet in Indian,<br />
groz, den wil si von mir han.<br />
minen willen tuot si gar,<br />
seht, ob ich irz allez her gewinne.<br />
Ich muoz bringen ir den gral,<br />
des da pflac her Parzival,<br />
und den apfel, den Paris<br />
gap durch minne Venus der gütinne,<br />
Und den mantel, der besloz<br />
gar die frouwen, diust unwandelbaere.<br />
dannoch wil si wunder groz,<br />
deist mir worden swaere:<br />
ir ist nach der arke we,<br />
diu beslozzen hat Noe.<br />
heia hei!<br />
braehte ich die, wie liep ich danne waere!<br />
rutschten Hüftband, dorthin, wo man in ihrem<br />
Saal – aber, aber – den Reigen tanzt.<br />
Minne machen möchte er mit der, die gerade<br />
von rehter arte der eren krone tragen<br />
sollte. Solch anzügliche Träumereien lassen<br />
den Tänzer so richtig in die Höhe hüpfen:<br />
nu heia, Tanhusaere! Zergangen ist<br />
din swaere – verflogen ist die Depression.<br />
Schaut, wie die Geliebte tanzt und springt.<br />
Auf zur Linde, da singen wir zum Tanze.<br />
Ein Reinmar von Hagenau oder ein Friedrich<br />
von Hausen hätten sich im Grab herumgedreht,<br />
wenn diese späthöfische<br />
Avantgarde zu ihnen gedrungen wäre.<br />
Der Tannhäuser wiederum hätte sich<br />
ganz schön gelangweilt, wenn er die unsinnlichen<br />
Minnereflexionen und das<br />
steife Minnezeremoniell seiner Vorgänger<br />
über sich hätte ergehen lassen müssen.<br />
Nach einem Tango mag halt niemand mehr<br />
ein Menuett tanzen!<br />
Prof. Dr. Hubert Herkommer<br />
Institut für Germanistik<br />
Dauerdienst, ja der ist gut,<br />
den man an schönen Frauen tut,<br />
wie ich’s bei meiner hab’ getan:<br />
Der ich den Salamander bringen muss!<br />
Und noch ein zweites sie mir abverlangt:<br />
Dass ich die Rhône umleit ihr<br />
aus der Provence hinauf in<br />
Nürnbergs Land: dann hätt’ ich Erfolg bei ihr!<br />
Doch noch die Donau lenken sollt’ ich übern Rhein;<br />
schafft’ ich dies, dann gäb’ sie sich mir hin.<br />
Merci, Madame!<br />
Sie heisst die Gute.<br />
Sag’ ich ja, dann sagt sie nein,<br />
so passen wir zusammen!<br />
Juchhei, juchhe!<br />
Zu lang ist sie emanzipiert gewesen.<br />
Einen mächt’gen Baum aus Indien,<br />
den will sie von mir haben.<br />
Zu Willen ist sie mir,<br />
schaut, wenn ich das schaffe.<br />
Ich muss erringen ihr den Gral,<br />
um den sich Parzival gekümmert,<br />
und den Apfel, den Paris<br />
vor lauter Minn’ der Göttin Venus gab dahin,<br />
und auch den Zaubermantel noch,<br />
der nur die treue Frau umhüllt.<br />
Und dann will sie was ganz Extremes,<br />
wo mich die Schwermut gleich gepackt:<br />
Ihr ist so nach der Arche weh,<br />
in der geborgen war Noe.<br />
Juchhei, juchhe!<br />
Schleppt’ ich die an, wie lieb ich ihr dan wär!<br />
UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />
43
Der Dagulf-Psalter und das kirchenpolitische Umfeld seiner Entstehung<br />
Der König als Priester<br />
Der Austausch von Geschenken gehört zum Protokoll<br />
politischer Diplomatie. Dies war auch im Mittelalter nicht<br />
anders. Würde ein Staatspräsident heute allerdings dem<br />
Papst eine Bibel schenken, wäre das Erstaunen wohl gross.<br />
Genau dies jedoch plante Karl der Grosse. Er beabsichtigte,<br />
Papst Hadrian I. den am Aachener Hof fertiggestellten<br />
Dagulf-Psalter anlässlich der Frankfurter Synode von 794<br />
zu übergeben. Weshalb damit trotzdem keine Eulen nach<br />
Rom getragen worden wären, lässt sich mit einem genaueren<br />
Blick in die Handschrift nachweisen.<br />
Der «Goldene Psalter», wie der Dagulf-Psalter<br />
1 wegen der für die gesamte<br />
Handschrift verwendeten Goldfarbe auch<br />
genannt wird, ist ein Bild- und Schriftzeugnis<br />
für das Bemühen um die Bewahrung<br />
des reinen Prophetenwortes. Nach<br />
Meinung der mittelalterlichen Theologen<br />
soll der Mensch am Wort Gottes, dem seiner<br />
Propheten oder Evangelisten, da als<br />
Offenbarung gleichsam in Stein gehauen,<br />
nicht kritzeln. Der Mensch darf nur, ja er<br />
muss sogar, die «Ablagerungen» fälschlicher<br />
Überlieferungen entfernen.<br />
Kunstvoller Einband<br />
aus Elfenbein<br />
Der als Geschenk an den Papst gedachte<br />
Dagulf-Psalter wurde von Hoftheologen<br />
Karls des Grossen unter der Leitung des<br />
Iren Alkuin zusammengestellt. Die Redaktoren<br />
signalisieren bereits mit dem<br />
Elfenbein-Einband, dass sie eine originalgetreue<br />
Abschrift der Psalmen Davids<br />
vorlegen wollen. Die Vorderseite der<br />
kunstvoll gefertigten Tafeln zeigt auf der<br />
oberen Bildhälfte, wie David vier Schreiber<br />
mit grosser Geste beauftragt, seine Gesänge<br />
gleichsam «live» mitzuschreiben,<br />
und unten, wie dieser Auftrag ausgeführt<br />
wird (Abb. 1, linke Tafel). Auf der Rückseite<br />
des Einbands wird Hieronymus von<br />
einem Boten des Papstes beauftragt, den<br />
in der Zwischenzeit nicht mehr originalen,<br />
sondern korrumpierten Psalmentext zu re-<br />
1 Der nach dem Schreiber Dagulf benannte Psalter<br />
ist eine kleinformatige (12x19cm) Prachthandschrift<br />
der Psalmen aus dem Alten Testament. Im<br />
Unterschied zur neuzeitlichen Bibelauslegung<br />
glaubte das Mittelalter, dass die hochpoetischen<br />
Lob-, Dankes- und Klagelieder allesamt von David<br />
stammen würden.<br />
44 UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />
digieren. Im unteren Bildfeld diktiert Hieronymus<br />
seinen verbesserten Text einem<br />
Schreiber (Abb. 1, rechte Tafel).<br />
Geschenk für den Papst<br />
Auf einem Einzelblatt, noch vor den Vorreden<br />
und dem eigentlichen Psalmentext<br />
eingebunden, finden sich zwei Widmungsgedichte.<br />
Dank dem ersten Widmungsgedicht<br />
(siehe Kasten «Erstes Widmungsgedicht»<br />
und Abb. 2 ) weiss man, dass Karl<br />
der Grosse das schmuckvolle Bändchen<br />
Papst Hadrian I. schenken wollte. Es blieb<br />
allerdings bei der Absicht. Der Papst hat<br />
die Gabe vor seinem Tode am ersten Weihnachtstag<br />
795 wohl nicht mehr erhalten.<br />
Weshalb jedoch beabsichtigt ein weltlicher<br />
Herrscher, dem geistlichen Oberhaupt<br />
eine Psalmenhandschrift zu schenken?<br />
Das Werk des Schreibers Dagulf ist<br />
wahrscheinlich eine Verdankung der zahlreichen<br />
Handschriften, welche Hadrian I.<br />
Abb. 1: Der Einband des Dagulf-<br />
Psalters aus Elfenbein.<br />
ins Frankenreich geschickt hatte. Indem<br />
der Papst die Buchwünsche des Königs<br />
er-füllte und sowohl kirchenpolitisch als<br />
auch pastoral bedeutsame Texte als Dauerleihgabe<br />
freigab, ermöglichte er diesem,<br />
weit-greifende liturgische Reformen<br />
einzuleiten. Bekanntestes Beispiel dieser<br />
Reformen ist die im Namen Karls an<br />
den fränkischen Klerus gerichtete Mahnschrift<br />
mit dem Titel Admonitio generalis<br />
von 789. Darin fordert er, «dass jedes<br />
Kloster darum bemüht sein soll, mit grösster<br />
Sorgfalt den Wortlaut der Psalmen authentisch<br />
wiederzugeben und, wenn notwendig,<br />
von den besten Theologen und<br />
Schreibern originalgetreue Abschriften<br />
der Psalmen anfertigen zu lassen».<br />
Gegen die byzantinische<br />
Bilderverehrung<br />
Der Dagulf-Psalter könnte folglich auch<br />
ein Schriftbeweis für die erfolgreich<br />
durchgeführte Verbreitung orthodoxer<br />
Schrifttradition sein und den Absender<br />
vor dem Papst als Hüter der Rechtgläubigkeit<br />
erscheinen lassen. Dies ist um so<br />
naheliegender, als der König genau in jenen<br />
Jahren mit beinahe schon päpstlichem<br />
Eifer an zwei Fronten als Verteidiger der<br />
katholischen Lehre auftrat: Auf der Synode<br />
von Frankfurt 794 kämpfte Karl<br />
der Grosse einerseits gegen die byzantinische<br />
Bilderverehrung und andererseits<br />
gegen die spanische Irrlehre des Adoptianismus<br />
2 . Der Dagulf-Psalter ist nicht<br />
nur ein Beweis vom treuen Schaffen, er<br />
trägt auch explizite Spuren dieser beiden
Erstes Widmungsgedicht<br />
Dem obersten Bischof und dem Heiligen Vater, Hadrian,<br />
sage ich, König Karl: »Sei gegrüsst, Vater, es möge Dir wohl ergehen!”<br />
Vorsteher des Apostolischen Stuhls, nimm dieses Geschenk an,<br />
es ist zwar aussen von geringem Wert, innen jedoch ist es edel.<br />
Es zeigt eine Harfe, die durch Davids Schlagstab erklingt<br />
und es enthält süss klingende Gesänge zur Lyra.<br />
Dieses Saiteninstrument, Christus, lässt Deine erhabenen Wunder erklingen,<br />
Du, der Du den Schlüssel Davids, sein Reich und sein Haus besitzst.<br />
Geheimnissvoll mit siebenfachem Siegel verschlossen wären diese Lieder geblieben,<br />
hätte sie Christus als Gott nicht erschlossen.<br />
Deshalb widme ich Euch dieses Geschenk, frommer Priester,<br />
damit ich mich als Sohn in das Andenken meines Vaters bringen kann.<br />
Und so denkt an mich in Euren heiligen und frommen Gebeten,<br />
wenn Ihr dieses kleine Geschenk oft in den Händen haltet.<br />
Auch wenn das Büchlein nur in mässigem Glanz schimmert,<br />
so mögen doch die erhabenen Lieder Davids Dir gefallen.<br />
Möge mein Rinnsal von Eurem Strom aufgenommen werden<br />
und unsere kleine Blume auf den Blumenhain gelangen.<br />
Du sollst als Lenker auf lange Zeit hinaus gesund bleiben<br />
und die Kirche Gottes mit der Kunst der dogmatischen Lehre leiten.<br />
Streitsachen. Die kritische Position Karls<br />
gegenüber der Bilderverehrung wird mitbestimmend<br />
für die Ausstattung des Psalters<br />
gewesen sein: Auf Miniaturen wurde<br />
ganz verzichtet. Der für eine Prachthandschrift<br />
typische Buchschmuck findet sich<br />
nur in der Form von Schmuckinitialen<br />
(Abb. 3). Die traditionellerweise als Miniaturen<br />
in die Handschriften eingebundenen<br />
Autorbilder oder Christusdarstellungen<br />
fehlen. Ihre Funktion übernimmt der<br />
Elfenbein-Einband.<br />
Gegen die spanische Irrlehre<br />
Die fränkische Haltung gegenüber dem<br />
spanischen Adoptianismus bezeugen die<br />
fünf Glaubensbekenntnisse in den Vorreden.<br />
Es ist zwar üblich, dass am Ende einer<br />
mittelalterlichen Psalterhandschrift<br />
das Apostolische Taufbekenntnis angeführt<br />
wird. Ganz und gar ungewöhnlich<br />
allerdings ist es, fünf unterschiedliche<br />
Glaubensbekenntnisse in die Vorreden<br />
mitaufzunehmen, so wie dies die Redaktoren<br />
der Vorreden des Dagulf Psalters<br />
machten. Dieser Bruch mit der Tradition<br />
hätte mit Bestimmtheit auch den Papst irritiert.<br />
Rom liess keine Gelegenheit aus,<br />
die fränkischen Theologen darauf hin-<br />
2 «Adoptianismus» bezeichnet eine theologische<br />
Lehre, wonach Jesus Christus nur ein Mensch gewesen<br />
sei, der von Gott gleichsam «adoptiert» wurde.<br />
Diese Lehre war Anlass der Synoden in Regensburg<br />
im Jahr 792, in Frankfurt im Jahr 794 und in<br />
Aix-la-Chapelle im Jahr 799, die den Adoptianismus<br />
als Irrlehre verurteilten.<br />
zuweisen, dass neben dem Altrömischen<br />
Bekenntnis aus dem zweiten Jahrhundert<br />
keine neuen Bekenntnisse mehr aufgestellt<br />
werden sollten. Auch gegen die zeitgleich<br />
mit der Anfertigung des Psalters<br />
vorgenommene Aufnahme des Glaubensbekenntnisses<br />
in die fränkische Liturgie<br />
wehrte sich der Klerus Roms. Seine Argumentation<br />
war so entschieden wie entwaffnend:<br />
«Die römische Kirche hat sich<br />
niemals mit dem Bodensatz einer Irrlehre<br />
befleckt, sondern ist in der Reinheit des<br />
katholischen Glaubens entsprechend der<br />
Lehre des Petrus unerschütterlich geblieben,<br />
weshalb es diejenigen nötiger haben,<br />
das Bekenntnis zu singen, welche sich von<br />
einer Ketzerei beschmutzen liessen.»<br />
Die Kirche des Frankenreichs jedoch<br />
musste sich von diesem Vorwurf nun<br />
wirklich nicht betroffen fühlen. Gerade<br />
in den Grenzregionen zu Spanien wurde<br />
mit Vehemenz und auch Erfolg ein Herüberschwappen<br />
des spanischen Irrglaubens<br />
bekämpft. In den Augen des fränkischen<br />
Klerus’ war das Singen des Glaubensbekenntnisses<br />
eng verbunden mit der Verteidigung<br />
der Rechtgläubigkeit. So schreibt<br />
der Abt des Klosters Reichenau: «Unter<br />
den Galliern und Germanen begann das<br />
Bekenntnis in den Abendmahlsfeiern häufiger<br />
rezitiert zu werden nach der Absetzung<br />
des adoptianistischen Ketzers Felix,<br />
der in der Regierungszeit Karls verurteilt<br />
wurde». Für die Franken war das Singen<br />
Abb. 2: Erstes Widmungsgedicht.<br />
des Glaubensbekenntnisses gerade nicht<br />
ein Zeichen fehlender Glaubensstärke,<br />
sondern Verteidigung und Vergewisserung<br />
der eigenen Rechtgläubigkeit. Nur vor diesem<br />
Hintergrund wird verständlich, weshalb<br />
die Aachener Hoftheologen gleich<br />
fünf Versionen des Glaubensbekenntnisses<br />
in die Vorreden des Dagulf-Psalters<br />
aufnahmen. Weil die Irrlehren immer wieder<br />
andere sind, müssen auch stets neue Bekenntnisse<br />
formuliert werden.<br />
Hüter der reinen Lehre<br />
Die fünf Glaubensbekenntnisse integrieren<br />
Karl in die lange Geschichte der kirchlichen<br />
Streitfragen, womit sein Agieren in<br />
kirchlichen Angelegenheiten auch legitimiert<br />
wird. Diese Legitimierung gegenüber<br />
dem geistlichen Oberhaupt ist deshalb<br />
notwendig geworden, weil Karl der<br />
Grosse in der Bilderfrage eine vom Papst<br />
abweichende Position bezog und in der<br />
Frage des Adoptianismus immer wieder<br />
am Papst vorbei direkt mit den Spaniern<br />
verhandelte.<br />
Die Reihe der Bekenntnisse beginnt mit einer<br />
auf dem 1. Konzil von Nikäa (325) gebilligten<br />
Formel. Sie bildet gleichsam die<br />
Folie, durch die hindurch die Zusätze der<br />
folgenden Bekenntnisse ersichtlich werden.<br />
Gleich wie die Mehrzahl der übrigen<br />
Formeln trägt auch das Nizänische<br />
Bekenntnis die Spur seiner Entstehung im<br />
Kampf gegen den Irrglauben: Jene wel-<br />
UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />
45
che die Göttlichkeit Jesu weiterhin leugneten,<br />
würde «die katholische Kirche mit<br />
dem Bannfluch» belegen, wird am Schluss<br />
gedroht. Die drei folgenden Bekenntnisse<br />
unterstreichen die Göttlichkeit der trinitarischen<br />
Personen. Die fünfte Glaubensformel<br />
ist mit sieben Seiten die längste Fassung.<br />
Sie nennt den Schlüsselbegriff im<br />
Adoptianismus-Streit: «Wir glauben an<br />
Jesus Christus, Gottes einziggeborener<br />
Sohn, der nicht adoptiert wurde, sondern<br />
wahrhaftig geboren und wesensgleich mit<br />
dem Vater ist.»<br />
Indem Karl der Grosse im unmittelbaren<br />
zeitlichen Umfeld der Frankfurter Synode<br />
gedenkt, den Dagulf-Psalter Papst Hadrian<br />
I. zu schenken, wird eine nicht ganz<br />
selbstlose Absicht offenbar: Karl will sich<br />
vor dem Nachfolger Petri als «Defensor»,<br />
als Verteidiger des rechten Glaubens präsentieren<br />
und damit die Einlösung jener<br />
Verpflichtung signalisieren, welche in den<br />
päpstlichen Briefen mit dem Zusatz «Defensor<br />
Ecclesiae» zum offiziellen Titel<br />
Karls wiederholt ausgesprochen wurde.<br />
Der neue David<br />
Der Dagulf-Psalter ist aber ebenso eine<br />
bild-textliche Darstellung einer weiteren<br />
Betitelung Karls, die sich auch genau für<br />
besagte Jahre am Aachener Hof ein erstes<br />
Mal nachweisen lässt und die in der Folge<br />
beinahe inflationäre Verwendung fand:<br />
die Bezeichnung Karls als «novus David».<br />
Im zweiten Widmungsgedicht vergleicht<br />
der Schreiber Dagulf Karl den Grossen mit<br />
David. Seine Widmung schliesst mit einem<br />
Segenswunsch: «Möge Dein Szepter mit<br />
vielen Siegen geschmückt werden/und Du<br />
selbst dem Chor Davids beigesellt!» Die<br />
Beziehung zwischen David und Christus<br />
wird im ersten Widmungsgedicht ausgeführt:<br />
«Dieses Saiteninstrument, Christus,<br />
lässt Deine erhabenen Wunder erklingen,/<br />
Du, der Du den Schlüssel Davids, sein<br />
Reich und sein Haus besitzst».<br />
Auf der Bildebene des Elfenbein-Einbands<br />
ist dieser Bezug geschaffen über<br />
das Lamm Gottes, welches in die Zierleiste<br />
über dem auf einem Thron psalmierenden<br />
David eingelassen ist. Der Dreischritt<br />
von David zu Christus und von<br />
David zu Karl, mithin also die Herrschaft<br />
legitimierende heilsgeschichtliche Anbindung<br />
des Frankenkönigs an die biblische<br />
Zeit, ist Bild- und Textprogramm des<br />
46 UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />
Abb. 3: Eine Zierseite aus dem Psalter.<br />
Psalters. Wie eng der Zusammenhang zwischen<br />
der Bezeichnung Karls mit David<br />
und der Verteidigung der Rechtgläubigkeit<br />
ist, zeigt der erste Beleg überhaupt für diesen<br />
Vergleich. Er findet sich in einem die<br />
Streitfrage des Adoptianismus behandelnden<br />
Brief Alkuins aus dem Jahre 794:<br />
«Selig schätzen kann sich jenes Volk, das<br />
einen ebenso hervorragenden Lenker (rector)<br />
wie begnadeten Prediger (praedicator)<br />
hat; einen Herrscher, der in seiner Rechten<br />
das siegreiche Schwert der Macht führt,<br />
in seiner Linken aber das klingende Horn<br />
der katholischen Verkündigung. Genau auf<br />
diese Weise hat einst der Psalmensänger<br />
David, von Gott erwählt und von Gott geliebt,<br />
das Volk Israel geführt. Von seinen<br />
Nachfahren und der jungfräulichen Maria<br />
wurde Christus geboren. Es ist dieser<br />
Christus, der seinem Volk nun in der heutigen<br />
Zeit einen Herrscher – nämlich Karl<br />
– schenkt, der nicht nur den Namen, sondern<br />
auch die Macht und den Glauben Davids<br />
hat.»<br />
Wird Karl am Aachener Hof mit David angesprochen,<br />
so trägt der Frankenregent damit<br />
nicht nur den Namen des alttestamentlichen<br />
Königs, sondern er verkörpert auch<br />
dessen ideale Herrschaftsform, welche in<br />
der Verbindung von weltlicher und geistlicher<br />
Macht besteht und in der Formel «rector<br />
et praedicator» zum Ausdruck kommt.<br />
Als König und Priester wird auch David<br />
auf dem Elfenbein-Einband dargestellt: als<br />
thronender Psalmist. Statt der Herrsche-<br />
rinsignien hält er die Harfe, welche nach<br />
Hieronymus «wegen ihrer Schildform als<br />
die Kirche im Kampf gegen die Häresie<br />
ausgelegt werden kann».<br />
Genau wie David mit seinem Psalmengesang<br />
den orthodoxen Glauben verkündet,<br />
tut Karl dies im Rahmen der Synoden.<br />
Der Dagulf-Psalter liest sich wie<br />
eine dem Papst vorgelegte Signatur dieses<br />
Dienstes am Glauben. Im letzten der<br />
fünf Glaubensbekenntnisse kommt die<br />
aktuelle Ausrichtung einer jahrhundertelangen<br />
Glaubensverkündigung und -verteidigung<br />
zum Ausdruck, welche mit David<br />
ihren Ursprung hat, in Christus ihre<br />
Offenbarung und Erfüllung, über die jeweils<br />
unterschiedlichen Bekenntnisse fortgeschrieben<br />
wurde und in Karl einen vorläufigen<br />
Abschluss findet. Die Anbindung<br />
Karls an diese Tradition gelingt nur auf<br />
der Basis einer Lehre von Christus, wie sie<br />
gegen den Adoptianismus verteidigt und<br />
im letzten Glaubensbekenntnis angezeigt<br />
wurde: Christus als Inkarnation der unversehrten<br />
Göttlichkeit im unversehrten Menschen.<br />
Nur so kann die genealogische Linie<br />
von David zu Christus als Erwählung<br />
Karls durch Christus fortgesetzt werden.<br />
Karl der Grosse äussert in seinem Widmungsgedicht<br />
den Wunsch, der Papst<br />
möge seiner im Gebet gedenken, wenn<br />
er «das kleine Geschenk oft in den Händen»<br />
hält. Wichtiger wohl als die päpstliche<br />
Fürbitte war dem König jedoch, dass<br />
das geistliche Oberhaupt sich anhand des<br />
Psalters seiner Verdienste um die Sache<br />
der Kirche bewusst wurde. In dieser<br />
Hinsicht war grosses diplomatisches<br />
Geschick wahrlich vonnöten und dabei<br />
waren prachtvolle Geschenke sicherlich<br />
förderlich. Immerhin ist es traditionellerweise<br />
die Aufgabe des Papstes, sich als<br />
Hüter der Rechtgläubigkeit zu beweisen.<br />
In einer Zeit jedoch, in welcher der Papst<br />
sich oft genug ausgesprochen weltlich gab<br />
und sogar, zum ersten Mal in der Papstgeschichte,<br />
Kriegszüge in eigenem Namen<br />
durchführte, konnte es schon vorkommen,<br />
dass der König als Priester auftrat.<br />
Lic. phil. hist. Adrian Mettauer<br />
Institut für Germanistik
Gemeinsame Arbeit an einem berühmten Figurenportal<br />
Die Basler Galluspforte<br />
Die Galluspforte ist eines der bedeutendsten romanischen<br />
Skulpturenwerke der Schweiz. Das heilgeschichtliche<br />
Figurenprogramm des triumphbogenartigen Portals ist<br />
vielseitig interpretiert worden. Ist die gut erhaltene Pforte<br />
ein aus älteren Portalen zusammengestückeltes Flickwerk<br />
oder stellt sie ein streng theologisch begründetes Gesamtkunstwerk<br />
dar?<br />
Im Bogenfeld thront Christus als Weltenrichter<br />
umgeben von Petrus, Paulus und<br />
den Stiftern. Im Türsturz, Bezug nehmend<br />
auf den Kircheneingang, stehen die<br />
törichten Jungfrauen – ihre erloschenen<br />
Lampen in der Hand – vor verschlossener<br />
Tür, die weisen Jungfrauen, deren Lampen<br />
noch brennen, werden jedoch von Christus<br />
empfangen und aufgefordert, einzutreten.<br />
Im Gewände, d. h. in der seitlichen<br />
Umgrenzung links und rechts neben dem<br />
Eingang, stehen die vier Evangelisten; die<br />
in je drei übereinander gestellten Ädikulen<br />
(Baldachinen) dargestellten Werke der<br />
christlichen Barmherzigkeit daneben sollen<br />
dem Gläubigen einen möglichen Weg<br />
Abb. 1: Basel,<br />
Münster, Gal -<br />
luspforte.<br />
(Foto: E. Schmidt<br />
ins ewige Leben exemplarisch vorführen.<br />
Darüber, das Bogenfeld flankierend, stehen<br />
links Johannes der Täufer und rechts<br />
Johannes der Evangelist. Im obersten Register<br />
blasen zwei Engel zum Gericht des<br />
jüngsten Tages; die Toten erwachen, steigen<br />
aus ihren Gräbern und kleiden sich an,<br />
um beim Jüngsten Gericht zu erscheinen.<br />
Ausgangslage<br />
Die Galluspforte am Nordquerhaus des<br />
Basler Münsters wird mit dem spätromanischen<br />
Neubau nach einem allerdings<br />
durch eine zweifelhafte Quelle überlieferten<br />
Brand des Münsters im Jahre 1185 datiert.<br />
Sie verdankt ihre Berühmtheit der<br />
Bezeichnung als erstes Figurenportal im<br />
deutschsprachigen Raum (Abb. 1). Dieser<br />
Umstand hat die kunstgeschichtliche Literatur<br />
bewogen, Herleitungen jedweder<br />
Art zu entdecken. Die verschiedenen inhaltlichen<br />
Anregungen können vor allem<br />
in Frankreich und Italien gefunden werden.<br />
So ist der Gerichtsgedanke am Westportal<br />
der Abteikirche von Cluny, die Werke der<br />
Barmherzigkeit am linken Türpfosten des<br />
Nordportals des Baptisteriums von Parma<br />
ebenfalls anzutreffen.<br />
Auch der antike Triumphbogen von Besançon,<br />
die Porte Noire, gehört zu den<br />
Mosaiksteinen, aus denen das Bild der<br />
Galluspforte sich immer wieder neu zusammensetzen<br />
liess (Abb. 2).<br />
Es galt, diese angeblichen Beziehungen<br />
auf ihre Glaubwürdigkeit zu überprüfen<br />
und dabei das Münster in seiner Gesamtheit<br />
in die Diskussion einzubeziehen.<br />
Nach der Restaurierung der 1990er-Jahre,<br />
dem 500-Jahrjubiläum der Vollendung des<br />
Münsters und der Ausstellung des Münsterschatzes<br />
sind in jüngster Zeit neue Impulse<br />
zur Erforschung des Basler Münsters<br />
zu verzeichnen. Der Zeitpunkt erschien<br />
deshalb günstig, sich wieder einmal intensiver<br />
mit der Galluspforte als einem<br />
der kunsthistorischen Angelpunkte des<br />
Münsters auseinanderzusetzen.<br />
Stand und Perspektiven<br />
der Forschung<br />
Der Forschungsstand zur Galluspforte<br />
wurde zuletzt 1990 von Dorothea Schwinn<br />
Schürmann zusammengefasst (s. Literaturverzeichnis).<br />
Sie resümierte auch kurz<br />
die Restaurierungsgeschichte des Portals.<br />
Ein wichtiger erster Schritt war die Frage,<br />
wie die «Tür gegen die Linden hinuß» (so<br />
eine Quelle des 16. Jahrhunderts) im Laufe<br />
der Jahrhunderte gesehen und behandelt<br />
wurde. Für diesen rezeptionsgeschichtlichen<br />
Ansatz wurden sämtliche erreichbaren<br />
Bildquellen und Beschreibungen<br />
der Pforte zusammengestellt. Dabei galt<br />
es, die in der genannten Publikation nur<br />
kurz dargestellten Resultate der restauratorischen<br />
Untersuchung von 1986–89 auf-<br />
UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />
47
zugreifen und vor allem der Frage der Farbigkeit<br />
in einem breiten Zusammenhang<br />
nachzugehen, wie das in den letzten Jahren<br />
etwa für die allerdings jüngeren Portale<br />
des <strong>Bern</strong>er oder des Freiburger Münsters<br />
sowie für das Portail peint von Lausanne<br />
(um nur die mittelalterlichen Beispiele aus<br />
der Schweiz zu nennen) geschehen ist.<br />
Das Portal: eine Einheit<br />
Offen waren aber auch die zentralen Fragen<br />
nach der Einheitlichkeit des Portals<br />
und – davon abhängig – nach seinem ursprünglichen<br />
Standort innerhalb des Münsters.<br />
Während Schwinn Schürmann 1990<br />
noch vermelden konnte, die neuere Forschungsliteratur<br />
gehe weitgehend einhellig<br />
von einer sekundären Montage verschiedener<br />
(West-)Portalteile aus, neigen die Beiträge<br />
der 1990er-Jahre eher wieder dazu,<br />
die Einheitlichkeit des Portals zu postulieren.<br />
Das hängt gewiss mit dem allgemeinen<br />
Bedeutungsrückgang normativer<br />
Vorstellungen zusammen; so wird heute<br />
beispielsweise die früher als störend empfundene<br />
Vielfalt – in Übereinstimmung<br />
mit dem mittelalterlichen Lob der «varietas»<br />
– durchaus als Qualität beurteilt. Insbesondere<br />
die überaus reiche Ornamentik<br />
ist in diesem Zusammenhang einer eingehenden<br />
Betrachtung wert. Der neue Blick<br />
hat aber auch die Augen für neue Vergleiche<br />
geöffnet, die als konkrete Argumente<br />
gegen die Stückwerk-Theorie aufgeführt<br />
werden können. So dürfen die zu Recht<br />
registrierten Stilunterschiede nicht über-<br />
48 UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />
Abb. 2: Besançon, Porte<br />
Noire.<br />
Abb. 3: Basel, Galluspforte, Auferstehende im Bogenzwickel.<br />
interpretiert werden, sind solche doch in<br />
der Portalskulptur des 12. und 13. Jahrhunderts<br />
allenthalben zu beobachten. Entsprechend<br />
wird in der neueren Forschung<br />
auf Händescheidungen (d. h. die Zuordnung<br />
einzelner Teile zu einem bestimmten<br />
Künstler) in der hochmittelalterlichen<br />
Bauhüttenskulptur oft ganz verzichtet.<br />
Den Vorwurf ikonografischer Inkonsistenz<br />
des Basler Portalprogramms konnte<br />
neuerdings Bruno Boerner (1994) wieder<br />
ausräumen. Und gegen das Argument der<br />
seltsamen Platzierung der Auferstehenden<br />
ist auf die sehr ähnliche Anordnung<br />
in den vor 1154 entstandenen Portalfresken<br />
von SS. Felice e Fortunato in Vicenza<br />
zu verweisen (Abb. 3 und 4). Auch die baugeschichtlich<br />
besten Argumente für eine<br />
sekundäre Versetzung des Portals, nämlich<br />
die Unregelmässigkeiten in der Innengliederung<br />
der Querhausstirnwand, waren<br />
unter Beachtung des ähnlichen Aufrisses<br />
etwa im Nordquerschiffs von St-Denis<br />
zu überdenken. So galt es, den Baubefund<br />
nochmals sorgfältig zu überprüfen<br />
und Vergleiche mit in situ befindlichen<br />
Portalen (wie dem vorbildlich untersuchten<br />
Fürstenportal des Bamberger Domes<br />
(Abb. 5), aber auch mit sicher sekundär<br />
versetzten zeitgleichen anzustellen. Gerade<br />
diese recht grosse Gruppe liefert unterschiedliche<br />
Modelle, zeigt aber auch,<br />
Abb. 4: SS. Felice e Fortunato in Vicenza,<br />
Hauptfassade, Auferstehende im Bogenzwickel.
dass diese Wertschätzung für romanische<br />
Portale im späteren Mittelalter ein<br />
Thema ist, das einer systematischen Diskussion<br />
in grösserem Rahmen bedarf. Zu<br />
nennen seien hier nur die Seitenportale in<br />
Bourges, die um 1172 zwar für eine neue<br />
Westfassade der romanischen Kathedrale<br />
geplant, dann aber im gotischen Neubau<br />
anderweitig verwendet wurden, oder das<br />
schon im frühen 13. Jahrhundert versetzte<br />
Ein Projekt der <strong>Universität</strong>en <strong>Bern</strong> und Basel<br />
Abb. 5: Bamberg, Dom, Fürstenportal.<br />
Johannes-Portal in der Petrikirche in Soest<br />
und die spätgotische Übernahme der<br />
«Goldenen Pforte» im Domneubau von<br />
Freiberg.<br />
Funktion des Portals<br />
Nicht betroffen von einem ursprünglich<br />
allenfalls anderen Status ist die Frage<br />
nach der Funktion der Galluspforte in ihrer<br />
heutigen Lage als Nordquerhausportal<br />
Die Kunsthistorischen Institute der <strong>Universität</strong>en <strong>Bern</strong> (Prof. Dr. Norberto Gramaccini,<br />
Dr. Sibylle Walther) und Basel (PD Dr. Hans-Rudolf Meier), unter Mitarbeit der<br />
Basler Denkmalpflege (Dorothea Schwinn Schürmann) und der Basler Münsterbauhütte<br />
(Peter Burckhardt, Münsterbaumeister), haben im Sommersemester 2001 ein<br />
gemeinsames Seminar zur Basler Galluspforte durchgeführt. Es ging darum, der<br />
eingefahrenenen kunsthistorischen Literatur gegenüber neue Aspekte abzugewinnen.<br />
Diskutiert wurde im Seminar und vor Ort, wobei die Studierenden beider Institute<br />
einander kennen lernten.<br />
Von Anbeginn war geplant, mit den Ergebnissen an eine breite Öffentlichkeit heranzutreten.<br />
Seit September 2002 ist es soweit: im Museum Kleines Klingental in Basel<br />
findet die Ausstellung statt (7. September 2002 bis 26. Februar 2003); dazu ist<br />
eine wissenschaftliche Publikation mit internationaler Autorenschaft erschienen.<br />
Für die Studierenden war ein weit gespannter Bogen von Fragen und Forschungsproblemen<br />
zu beschreiten, den sie mit den Fachleuten vor Ort besprechen konnten.<br />
In vielen Bereichen konnten echte Fortschritte erzielt, manchmal auch neue Fragestellungen<br />
aufgeworfen werden; zuweilen blieb es bei der Feststellung, dass man über<br />
das bisher Bekannte nicht hinaus komme. Dass man dabei einmal Studierende einer<br />
anderen <strong>Universität</strong> vor sich hatte und sich mit ihren Erfahrungen messen konnte, hat<br />
sich belebend ausgewirkt. So ist neben der wissenschaftlichen Ausbeute als Ergebnis<br />
der Gemeinschaftsarbeit in jedem Fall festzuhalten, dass diese Form der Lehrveranstaltung,<br />
mit der Arbeit vor dem Objekt und in Kooperation über die Grenzen der<br />
<strong>Universität</strong> hinaus, für Lehrende und Lernende gleichermassen anregend ist.<br />
Abb. 6: Basel, Münster, Galluspforte, Barmherzigkeit:<br />
die Kleidung des Nackten.<br />
(Foto: E. Schmidt, in Meier/Schwinn Schürmann, Galluspforte)<br />
im Rahmen von Liturgie und Repräsentation.<br />
Hier konnte an jüngste Vorarbeiten<br />
von Regine Abegg (z. Z. Lehrbeauftragte<br />
am Kunsthistorischen Institut in Zürich)<br />
angeknüpft werden, die darauf aufmerksam<br />
gemacht hat, dass die Galluspforte<br />
gemäss dem Ceremoniale des Domstifts<br />
der Ort war, bei dem in der Palmsonntagsprozession<br />
der Einzug in Jerusalem kommemoriert<br />
wurde. Das Basler Portal hätte<br />
damit temporär die Rolle des Jerusalemer<br />
Stadttors übernommen, ein Aspekt, der bei<br />
der Thematisierung des Portals im ikonografischen<br />
Zusammenhang zu berücksichtigen<br />
ist.<br />
Die Entstehungszeit<br />
Der Ausgang der Debatte um die Einheitlichkeit<br />
des Portals wirkt zurück auf die<br />
Frage nach seiner Entstehung. Dieses früher<br />
intensiv, in der letzten Dekade aber<br />
kaum mehr diskutierte Problem wird neuerdings<br />
um die Deutung des – relativ späten<br />
– Dendrodatums (Altersbestimmung<br />
mittels Jahrringzählung des Holzes) der<br />
Querhausrose bereichert. Zugleich drängt<br />
es sich auf, das für die Datierungsfrage<br />
des spätromanischen Münsters so zentrale<br />
Datum des Münsterbrandes von<br />
1185 – an dessen Relevanz bereits Stehlin<br />
zweifelte, das aber Hans Reinhardt wieder<br />
in der Forschungsdiskussion fixierte –<br />
quellenkritisch zu überprüfen. Mit der Datierungsfrage<br />
eng verknüpft ist jene nach<br />
den Stiftern, die im Tympanon der Galluspforte<br />
bekanntlich prominent dargestellt,<br />
aber leider nicht beschriftet sind. Nach einem<br />
frühen Versuch, sie mit Graf Fried-<br />
UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />
49
Abb. 7: Basel, Münster, Galluspforte, Türsturz, «Die törichten Jungfrauen».<br />
rich von Montbéliard und Pfirt (1093 bis<br />
1160) und dessen Gemahlin Stephania von<br />
Vaudémont-Egisheim (<strong>114</strong>0–1160) zu identifizieren,<br />
hat die neuere Forschung dazu<br />
nichts Neues beigetragen, jedoch die Portalstiftung<br />
als Thema des Programms hervorgehoben.<br />
Auch hierzu liessen sich weiterführende<br />
Vergleiche nennen, die zeigen,<br />
wie im Basler Tympanon die Tradition von<br />
Stifterdarstellungen im Portal mit jener<br />
der Thematisierung der (Himmels)-Pforte<br />
im Portalzusammenhang verknüpft wurde.<br />
Auch mit der in diesem Kontext seltenen<br />
Darstellung der Werke der Barmherzigkeit<br />
waren persönliche Erwartungshaltungen<br />
der Stifter verbunden (Abb. 6).<br />
Im selben heilsgeschichtlichen Zusammenhang<br />
steht die Verbindung von Weltgericht<br />
und Klugen und Törichten Jungfrauen,<br />
ein Thema, das auch im <strong>114</strong>0<br />
entstandenen Westportal von St-Denis<br />
vorkam (Abb. 7 und 8).<br />
Mit St-Denis, der Grabkirche der französischen<br />
Könige in der Nähe von Paris,<br />
ist ein Monument angesprochen, das zur<br />
Frage nach der Stellung der Galluspforte<br />
in der Geschichte des Figurenportals überführt:<br />
Auf welche Vorläufer in Frankreich<br />
und Italien nimmt das Basler Portal in welcher<br />
Weise Bezug, und welche entwicklungsgeschichtliche<br />
Bedeutung kommt<br />
ihm seinerseits für die deutschen Figurenportale<br />
der 1. Hälfte des 13. Jahrhunderts<br />
(u. a. Bamberg, Freiberg) zu?<br />
Ein neuerer methodischer Ansatz von<br />
Peter Cornelius Claussen (Ordinarius<br />
für Kunstgeschichte des Mittelalters am<br />
Kunsthistorischen Institut in Zürich) erwies<br />
sich dabei als fruchtbar: Mit dem<br />
50 UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />
Begriff «Transperipherie» bezeichnet er<br />
ein Denkmodell, mit dem für die Figurenportale<br />
das oft bemühte Schema von<br />
einfachen Abhängigkeiten vom Zentrum<br />
Ile-de-France (oder allenfalls Provence)<br />
durchbrochen werden kann. Im Zusammenhang<br />
mit Vorbildern für die Galluspforte<br />
war überdies die Bedeutung des<br />
römischen Stadttores von Besançon, der<br />
Porte Noire (s. Abb. 2) erneut zu diskutieren.<br />
In der Tat hat die Mittelalterforschung<br />
der Antikenrezeption, d. h. der<br />
Erforschung der Übernahme antiker Elemente<br />
in der Form und Gestaltung späterer<br />
Kunstwerke, in den letzten Jahren vermehrt<br />
Aufmerksamkeit geschenkt.<br />
Abb. 9: St Ursanne,<br />
Collégiale, Portal.<br />
(© Foto: Jacques Bélat)<br />
Abb. 8: Saint Denis, «törichte Jungfrau».
Auf die Frage der Nachfolge der Galluspforte<br />
ist neben dem entwicklungsgeschichtlichen<br />
sehr weiten Bogen auch der<br />
geographisch kleinere, jedoch konkretere<br />
Resultate liefernde Kreis der möglichen<br />
Nachfolger in der Region zu schlagen<br />
(St-Ursanne (Abb. 9), Neuenburg, das<br />
Elsass, Petershausen (nördlich von München)<br />
und Kloster Schöntal (östlich von<br />
Heidelberg).<br />
Die Basler Galluspforte oszilliert zwischen<br />
Antike und Moderne, zwischen<br />
Provinz und Transperipherie. Dabei weiss<br />
sie diese Bereiche eigenwillig miteinander<br />
zu verknüpfen, gleichermassen als wollte<br />
sie sich ebenso des berühmten Altertums<br />
wie der zeitgenössischen Scholastik vergewissern<br />
und ebenso Lokal- wie Weltpolitik<br />
treiben.<br />
Prof. Dr. Norberto Gramaccini,<br />
Dr. Sibylle Walther,<br />
Institut für Kunstgeschichte,<br />
PD Dr. Hans-Rudolf Meier,<br />
Kunsthistorisches Seminar,<br />
Uni Basel<br />
Abb. 2, 3, 4, 5, 7 und 8: Institut für Kunstgeschichte<br />
Literaturverzeichnis<br />
• Regine, Abegg, Funktion des Kreuzgangs im Mit-<br />
telalter – Liturgie und Alltag, in: Kunst + Archi-<br />
tektur in der Schweiz 48, 1997, S. 6–24.<br />
• Bruno Boerner: Überlegungen zum Programm der<br />
Basler Galluspforte, in: Kunst + Architektur in der<br />
Schweiz 45/3, 1994, 238–246.<br />
• Peter Cornelius Claussen: Zentrum, Peripherie,<br />
Transperipherie. Überlegungen zum Erfolg des go-<br />
tischen Figurenportals an den Beispielen Chartres,<br />
Sangüesa, Magdeburg, Bamberg und den Westpor-<br />
talen des Domes S. Lorenzo in Genua, in: Beck/<br />
Hengevoss-Dürkop1994, 665–687.<br />
• Regine Körkel-Hinkfoth: Sinnbild des Jüngsten Ge-<br />
richts – Darstellung der Parabel von den klugen<br />
und törichten Jungfrauen am Basler Münster, in:<br />
Unsere Kunstdenkmäler 44, 1993, 309–322.<br />
• Hans-Rudolf Meier, Dorothea Schwinn Schürmann<br />
(Hg.): Schwelle zum Paradies. Die Galluspforte des<br />
Basler Münsters, Basel 2002 (Ausstellungskata-<br />
log).<br />
• Hans Reinhardt, Das Basler Münster, Basel 1961.<br />
• Dorothea Schwinn Schürmann: Die Restaurie-<br />
rungs- und Forschungsgeschichte der Galluspforte,<br />
in: Die Münsterbauhütte Basel 1985–1990, Basel<br />
1990, 57–65.<br />
• Dies.: Das Basler Münster. Schweiz. Kunstführer<br />
GSK Nr. 689/80, <strong>Bern</strong> 2000.<br />
• Karl Stehlin, in: Baugeschichte des Basler Müns-<br />
ters, hrsg. vom Basler Münsterbauver., BS, 1895, 6f.<br />
UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />
51
Ringvorlesung des <strong>Bern</strong>er-Mittelalter-Zentrums (BMZ)<br />
52 UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />
Europa und der Orient<br />
im WS 2002/03<br />
Donnerstag, jeweils 17–19 Uhr, Hauptgebäude der <strong>Universität</strong>, Hochschulstrasse 4, Hörsaal 220.<br />
31.10.2002 Prof. Dr. Rainer C. Schwinges Vom Einfluss der Kreuzzüge<br />
auf die europäische Kultur<br />
07.11.2002 Prof. Dr. Hans-Joachim Schmidt, Fribourg Geographisches Wissen von fremden Räumen<br />
14.11.2002 Lic. phil. Adrian Mettauer Im Osten viel Neues. Die Wunder des Orients<br />
in der Literatur des 12. Jahrhunderts<br />
21.11.2002 Prof. Dr. Johannes Tripps Von Natterzungen, chinesischem Porzellan<br />
und Unterwasserpalmen: Pilgerandenken als<br />
Objekte mittelalterlicher Goldschmiedekunst<br />
28.11.2002 Lic. phil. Nicole Staub „Wir sind zu Orientalen geworden“.<br />
Wilhelm von Tyrus über Europäer und<br />
Orientalen im Kreuzfahrerkönigreich Jerusalem<br />
05.12.2002 Prof. Dr. Anke von Kuegelgen Die Tamerlane-Rezeption in Orient<br />
und Okzident<br />
12.12.2002 Dr. Therese Bruggisser-Lanke, Thun Der Moriskentanz – Vom Ritual zum Drama.<br />
Kollektive Erinnerung an Kreuzzüge<br />
und Türkenkriege (mit Musikbeispielen)<br />
19.12.2002 Prof. Dr. Volker Hoffmann Was verdankt die abendländische Baukunst<br />
dem Morgenlande?<br />
09.01.2003 PD Dr. Christoph T. Maier, Basel Die Rolle der Frauen in der Kreuzzugsbewegung<br />
16.01.2003 PD Dr. Paul Strässle, Zürich Krieg und Frieden in Byzanz<br />
23.01.2003 PD Dr. Andreas Kaplony, Zürich Ein Florentiner Kaufmann auf der Seidenstrasse:<br />
Pegolottis Handels-Handbuch im Vergleich<br />
mit muslimischen Reiseberichten<br />
30.01.2003 Prof. Dr. Stig Förster und Bedrohung aus dem Osten. Die Mongolen<br />
Prof. Dr. Karénina Kollmar-Paulenz<br />
06.02.2003 Prof. Dr. Hubert Herkommer Wolframs „Parzival“ als Orientroman
Senioren-<strong>Universität</strong> – Programm 2002/2003<br />
Die Vorträge finden in Räumen der <strong>Universität</strong> statt. Im Wintersemester sind jeweils der Dienstag und Freitag reserviert, im Sommersemester<br />
nur der Freitag. Dienstags steht der Hörsaal A 6, Institut für Exakte Wissenschaften, Sidlerstrasse 5, 16.15–18.00<br />
Uhr und freitags der Hörsaal 110 im Hauptgebäude der Uni, Hochschulstrasse 4, (1. Stock), 14.15–16.00 Uhr zur Verfügung.<br />
Anmeldung 2002/2003<br />
Die Anmeldefrist für die Mitgliedschaft dauert vom 1. Okt. bis 31. Dez. 2002. In besonderen Fällen können Anmeldungen noch<br />
während des laufenden akademischen Jahres erfolgen. Mitgliedern der Senioren-<strong>Universität</strong> wird das neue Programm mit eingeheftetem<br />
Einzahlungsschein automatisch zugestellt. Die Senioren-<strong>Universität</strong> steht jedermann offen, der das 60. Altersjahr überschritten<br />
hat. Frühpensionierte können sich ab dem 55. Altersjahr anmelden. Mitgliederbeitrag Fr. 60.– für das akademische Jahr.<br />
Vorträge<br />
Dienstag, 22. Oktober Wolfram von Eschenbach: «Parzivâl»/ Prof. Dr. phil. Hanns Peter Holl<br />
Adolf Muschg: «Der rote Ritter.<br />
Eine Geschichte von Parzivâl»<br />
Freitag, 25. Oktober Aus der Geschichte des <strong>Bern</strong>er Prof. Dr. ing. Daniel Vischer, ETHZ<br />
Hochwasserschutzes; vom Schwellenwesen zu<br />
den grossen Korrektionen des 19. Jahrhunderts<br />
Dienstag, 29. Oktober Psychische Folgen kritischer Lebensereignisse Prof. Dr. phil. Hansjörg Znoj<br />
Freitag, 1. November Zeitgenössische Westschweizer Literatur Dr. phil. Béatrice Chissalé (em.)<br />
Dienstag, 5. November Wasserwelten Neuseelands und der Schweiz – Dr. phil. Rolf Weingartner<br />
ein Vergleich<br />
Freitag, 8. November Halten Sie sich jung; Behandlung von Dr. med. Lasse Braathen<br />
Altershaut, Falten und Hautkrebsen<br />
Dienstag, 12. November Bewegung und Gesundheit Dr. med. Hans Hoppeler<br />
Freitag, 15. November Geldanlage ohne Kristallkugel Prof. Dr. rer. pol. Claudio Loderer<br />
Dienstag, 19. November Naturkatastrophen als Schrittmacher Prof. Dr. phil. Christian Pfister<br />
gesellschaftlicher Lernprozesse<br />
Freitag, 22. November Chemie: Vielfalt und Wandel des Materiellen Prof. Dr. phil. Jürg Hulliger<br />
Dienstag, 26. November Schweizerische Auswanderung nach Argentinien Dr. phil. Markus Glatz<br />
in der Zwischenkriegszeit des 20. Jahrhunderts<br />
Freitag, 29. November Herzinsuffizienz beim älteren Patienten Dr. med. Hullin Roger<br />
Dienstag, 3. Dezember Herzinfarkt – gibt es eine wirksame Prävention? PD Dr. med. Rubino Mordasini<br />
Freitag, 6. Dezember Klimawechsel und Erosion Prof. Dr. phil. Fritz Schlunegger<br />
Dienstag, 10. Dezember Zur Weltliteratur des Kindes: Prof. Dr. phil. Franz Georg Maier (em.)<br />
Die «Kinderbuchklassiker»<br />
Freitag, 13. Dezember Der alte Mensch in biblisch-theologischer Sicht Prof. Dr. theol. Martin Klopfenstein (em.)<br />
Dienstag, 17. Dezember Entstehung und Entwicklung der operativen PD Dr. med. Urs Heim (em.)<br />
Knochenbruchbehandlung<br />
UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />
53
Freitag, 20. Dezember Die gotische Kathedrale als Abbild des Prof. Dr. phil. Peter Kurmann, Fribourg<br />
himmlischen Jerusalem.<br />
Ein Mythos der Kunstgeschichte?<br />
Dienstag, 7. Januar So kamen die Bauern zu ihren Wappen Ehrensenator Berchtold Weber<br />
Freitag, 10. Januar «Der Mozart-Effekt» – macht Musik klüger? Prof. Urs Frauchiger<br />
Dienstag, 14. Januar Aus Geometrie und Zahlentheorie: Ungelöstes – Prof. Dr. phil. Jürg Rätz (em.)<br />
schön Gelöstes – Unlösbares<br />
Freitag, 17. Januar Sprachstörungen nach Hirnschlag Dr. med. Ellen Markus<br />
Dienstag, 21. Januar Der Glaube an Gott nach Auschwitz Prof. Dr. phil. Ernst Ludwig Ehrlich (em.)<br />
Freitag, 24. Januar Gehirn und Bewusstsein Prof. Dr. med. Norbert Herschkowitz (em.)<br />
Dienstag, 28. Januar Space Odyssee 2011: Prof. Dr. phil. Kathrin Altwegg<br />
die europäische Kometenmission Rosetta<br />
Freitag, 31. Januar Wohlfahrtsstaatliche Reformen in Europa Prof. Dr. rer. soc. Klaus Armingeon<br />
Dienstag, 4. Februar Möglichkeiten und Grenzen Dr. med. Brigitte Ausfeld<br />
der Traditionellen Chinesischen Medizin<br />
Freitag, 7. Februar Zur Entstehung und Entwicklung der Stadt <strong>Bern</strong> Dr. phil. Armand Baeriswyl<br />
im Mittelalter – alte und neue Erkenntnisse,<br />
Hypothesen und Spekulationen<br />
Freitag, 28. März Minotaurus und Theseus – oder: Tiermensch Prof. Dr. phil. Peter Rusterholz (em.)<br />
und Menschentier – Friedrich Dürrenmatts<br />
Texte und Bilder zur Frage nach der Natur<br />
des Menschen<br />
Freitag, 4. April Ein Entwicklungshilfeeinsatz in Tanzania PD Dr. med. Walter Schweizer<br />
Freitag, 11. April Die Geschichte des Universums: Prof. Dr. phil. Uwe-Jens Wiese<br />
Vom Urknall bis heute<br />
Freitag, 25. April Die Kunst der manuellen Druckgraphik Patricia Schneider, Solothurn<br />
Freitag, 2. Mai Aktuelle Themen und Probleme der Prof. Dr. med. Daniel Candinas<br />
Transplantationsmedizin<br />
Freitag, 9. Mai Die Chancen der Gewaltfreiheit in einer Welt Prof. Dr. theol. Wolfgang Lienemann<br />
der Gewalt<br />
Freitag, 16. Mai Bienen – soziale Insekten Dr. phil. Anna Heitzmann<br />
Entwicklungsprozesse im Bienenvolk<br />
Freitag, 23. Mai Digitale Bildgebung in der Medizin Prof. Dr. med. Peter Vock<br />
Freitag, 30. Mai Schweizer Puppentheater im 20. Jahrhundert Dr. phil. Elke Krafka<br />
Freitag, 6. Juni Franz Liszts musikalische Schweizerreise Prof. Dr. phil. Anselm Gerhard<br />
Freitag, 13. Juni Konstantin der Grosse und Dr. phil. Bruno Bleckman<br />
der Triumph des Christentums<br />
54 UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002
Freitag, 20. Juni UNESCO – Weltnaturerbe und die Schweiz PD Dr. phil. Meinrad Küttel<br />
Freitag, 27. Juni Hanf, Anbau und Ernte; Verarbeitung zu legalen Dr. phil. Werner <strong>Bern</strong>hard<br />
und illegalen Produkten<br />
Seminare, Führungen, Exkursionen und Kurse<br />
Bei den meisten Veranstaltungen unter dieser Rubrik (mit Ausnahme der Seminare) ist die Zahl der Teilnehmenden beschränkt. Zu allen<br />
Anlässen ohne Orts- und Zeitangabe werden entsprechende Informationen während des Semesters schriftlich aufgelegt sowie<br />
auf der Homepage der Seniorenuniversität publiziert: http://www.advd.unibe.ch/imd/seniorenuni<br />
Führungen, Besichtigungen und Exkursionen<br />
• „Theater in Gegenwart und Geschichte“ Prof. Martin Dreier und Prof. Andreas Kotte<br />
• Was sagt das Steinbeil? Prof. Felix Müller<br />
• Ausstellungsbesuch im Centre Dürrenmatt Prof. Peter Rusterholz<br />
• Forschungsstelle für Namenkunde mit Einführung in Entstehung und Arbeitsweise Dr. Erich Blatter und<br />
des Ortsnamenbuchs des Kantons <strong>Bern</strong> Frau Dr. Erika Derendinger<br />
• Herzzentrum Sonnenhof PD Rubino Mordasini<br />
• Grabungsbesuch auf dem Casinoplatz Dr. Armand Baeriswyl<br />
• Holzburgen im Raum Signau – zur Erstbesiedlung und zum Landesausbau Hans Grütter<br />
des Emmentals im Früh- und Hochmittelalter<br />
• Druckateliers der Hochschule für Gestaltung, Kunst und Konservierung in Bümpliz Patricia Schneider<br />
• Magnetresonanz -Tomographie (MRI) am Inselspital Prof. Peter Vock<br />
• Begleitung eines Vorstellungsbesuches des <strong>Bern</strong>er Puppentheaters Dr. Elke Krafka<br />
• Bienen und ihre Trachtpflanzen – Ein Blick in die Honigproduktion Dr. Anna Heitzmann<br />
• „<strong>Bern</strong>er Tanztage“ 11.–28. Juni Dr. Claudia Rosiny<br />
Seminare und Kurse<br />
• Amor fucatus – Marginalie zu einem wiederentdeckten Gemälde des H. v. Aachen Frau Prof. Ellen J. Beer (em.)<br />
• Urininkontinenz bei der Frau: das muss nicht sein Dr. med. Fiona Burkhard<br />
• Littérature suisse romande contemporaine – Zeitgenössische Westschweizer Literatur Dr. Béatrice Chissalé<br />
• Kurs in Kalligraphie Heidi Trachsel-Kurth (031 829 19 35)<br />
Kursangebot des Instituts für Sport- und Sportwissenschaft der <strong>Universität</strong><br />
Kursart Praktische Durchführung eines körperlichen Trainings mit den Themen: Dehnen, Kräftigen – Lösen, Entspannen<br />
– körperliche Beweglichkeit – geistige Beweglichkeit. Den eigenen Körper und seine Möglichkeiten<br />
bewusst wahrnehmen. Die Erfahrung auf Alltagshaltung und Alltagsbewegungen übertragen.<br />
Freude und Spass am gemeinsamen Bewegen, Tanzen, Sport und Spiel.<br />
Kursverantwortung Frau Margrit Bischof, Dozentin am Institut für Sport und Sportwissenschaft (ISSW)<br />
Kursleitung Frau Dr. Trudi Stiffler<br />
Voraussetzungen Der Kurs richtet sich an alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Senioren-<strong>Universität</strong>, die bereit sind,<br />
sich für ihr individuelles Wohlbefinden zu engagieren. Dazu sind keine besonderen sportlichen Voraussetzungen<br />
notwendig. Der Unterricht findet in 2 Gruppen statt. Gruppe A: Montag 14.00–15.00<br />
Uhr und Gruppe B: Montag 15.15–16.15 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen pro Gruppe<br />
beschränkt. Die Anmeldung beim Sekr. ISSW ist obligatorisch: Frau Elisabeth Waldvogel, Tel. 031<br />
631 47 62.<br />
Kursort Institut für Sport und Sportwissenschaft, Kleine Universtätsturnhalle, Bremgartenstrasse 145, 3012<br />
<strong>Bern</strong>, SVB-Endstation P+R Neufeld (Bus Nr. 11 ab Hauptbahnhof <strong>Bern</strong>).<br />
Kursbeginn 21. Oktober 2002. Das detaillierte Programm wird in Abhängigkeit von der Zahl der Teilnehmenden<br />
festgelegt.<br />
Kurskosten Die Kurskosten von Fr. 40.– sind mit gleichzeitiger Vorweisung des gültigen Mitgliederausweises der<br />
Senioren-<strong>Universität</strong> bei der Kursleiterin, Frau Dr. T. Stiffler, zu bezahlen.<br />
Bekleidung Bequeme Turn- oder Hauskleidung mit Turn- oder Hausschuhen.<br />
Weitere Informationen Kanzlei der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong>, Frau Heidi Wyss, Hochschulstrasse 4, 3012 <strong>Bern</strong>,<br />
(Schalteröffnungszeiten: 9.00–11.30 Uhr und 14.00–15.00 Uhr). Tel. 031 631 39 11 oder<br />
631 82 53, Fax 031 631 80 08, E-Mail seniorenuni@imd.unibe.ch,<br />
Internet http://www.advd.unibe.ch/imd/seniorenuni<br />
UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />
55