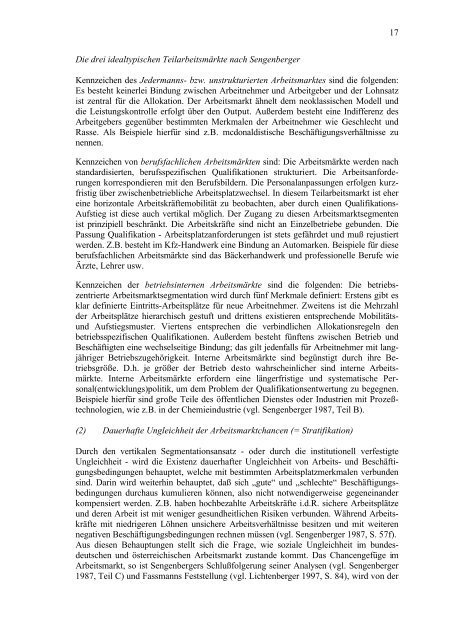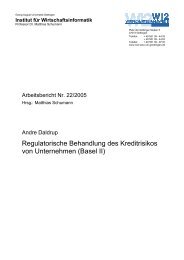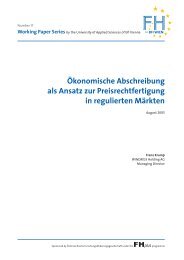Bewältigung von Personalentlassungen durch Gestaltung ... - EconBiz
Bewältigung von Personalentlassungen durch Gestaltung ... - EconBiz
Bewältigung von Personalentlassungen durch Gestaltung ... - EconBiz
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Die drei idealtypischen Teilarbeitsmärkte nach Sengenberger<br />
Kennzeichen des Jedermanns- bzw. unstrukturierten Arbeitsmarktes sind die folgenden:<br />
Es besteht keinerlei Bindung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber und der Lohnsatz<br />
ist zentral für die Allokation. Der Arbeitsmarkt ähnelt dem neoklassischen Modell und<br />
die Leistungskontrolle erfolgt über den Output. Außerdem besteht eine Indifferenz des<br />
Arbeitgebers gegenüber bestimmten Merkmalen der Arbeitnehmer wie Geschlecht und<br />
Rasse. Als Beispiele hierfür sind z.B. mcdonaldistische Beschäftigungsverhältnisse zu<br />
nennen.<br />
Kennzeichen <strong>von</strong> berufsfachlichen Arbeitsmärkten sind: Die Arbeitsmärkte werden nach<br />
standardisierten, berufsspezifischen Qualifikationen strukturiert. Die Arbeitsanforderungen<br />
korrespondieren mit den Berufsbildern. Die Personalanpassungen erfolgen kurzfristig<br />
über zwischenbetriebliche Arbeitsplatzwechsel. In diesem Teilarbeitsmarkt ist eher<br />
eine horizontale Arbeitskräftemobilität zu beobachten, aber <strong>durch</strong> einen Qualifikations-<br />
Aufstieg ist diese auch vertikal möglich. Der Zugang zu diesen Arbeitsmarktsegmenten<br />
ist prinzipiell beschränkt. Die Arbeitskräfte sind nicht an Einzelbetriebe gebunden. Die<br />
Passung Qualifikation - Arbeitsplatzanforderungen ist stets gefährdet und muß rejustiert<br />
werden. Z.B. besteht im Kfz-Handwerk eine Bindung an Automarken. Beispiele für diese<br />
berufsfachlichen Arbeitsmärkte sind das Bäckerhandwerk und professionelle Berufe wie<br />
Ärzte, Lehrer usw.<br />
Kennzeichen der betriebsinternen Arbeitsmärkte sind die folgenden: Die betriebszentrierte<br />
Arbeitsmarktsegmentation wird <strong>durch</strong> fünf Merkmale definiert: Erstens gibt es<br />
klar definierte Eintritts-Arbeitsplätze für neue Arbeitnehmer. Zweitens ist die Mehrzahl<br />
der Arbeitsplätze hierarchisch gestuft und drittens existieren entsprechende Mobilitätsund<br />
Aufstiegsmuster. Viertens entsprechen die verbindlichen Allokationsregeln den<br />
betriebsspezifischen Qualifikationen. Außerdem besteht fünftens zwischen Betrieb und<br />
Beschäftigten eine wechselseitige Bindung; das gilt jedenfalls für Arbeitnehmer mit langjähriger<br />
Betriebszugehörigkeit. Interne Arbeitsmärkte sind begünstigt <strong>durch</strong> ihre Betriebsgröße.<br />
D.h. je größer der Betrieb desto wahrscheinlicher sind interne Arbeitsmärkte.<br />
Interne Arbeitsmärkte erfordern eine längerfristige und systematische Personal(entwicklungs)politik,<br />
um dem Problem der Qualifikationsentwertung zu begegnen.<br />
Beispiele hierfür sind große Teile des öffentlichen Dienstes oder Industrien mit Prozeßtechnologien,<br />
wie z.B. in der Chemieindustrie (vgl. Sengenberger 1987, Teil B).<br />
(2) Dauerhafte Ungleichheit der Arbeitsmarktchancen (= Stratifikation)<br />
Durch den vertikalen Segmentationsansatz - oder <strong>durch</strong> die institutionell verfestigte<br />
Ungleichheit - wird die Existenz dauerhafter Ungleichheit <strong>von</strong> Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen<br />
behauptet, welche mit bestimmten Arbeitsplatzmerkmalen verbunden<br />
sind. Darin wird weiterhin behauptet, daß sich „gute“ und „schlechte“ Beschäftigungsbedingungen<br />
<strong>durch</strong>aus kumulieren können, also nicht notwendigerweise gegeneinander<br />
kompensiert werden. Z.B. haben hochbezahlte Arbeitskräfte i.d.R. sichere Arbeitsplätze<br />
und deren Arbeit ist mit weniger gesundheitlichen Risiken verbunden. Während Arbeitskräfte<br />
mit niedrigeren Löhnen unsichere Arbeitsverhältnisse besitzen und mit weiteren<br />
negativen Beschäftigungsbedingungen rechnen müssen (vgl. Sengenberger 1987, S. 57f).<br />
Aus diesen Behauptungen stellt sich die Frage, wie soziale Ungleichheit im bundesdeutschen<br />
und österreichischen Arbeitsmarkt zustande kommt. Das Chancengefüge im<br />
Arbeitsmarkt, so ist Sengenbergers Schlußfolgerung seiner Analysen (vgl. Sengenberger<br />
1987, Teil C) und Fassmanns Feststellung (vgl. Lichtenberger 1997, S. 84), wird <strong>von</strong> der<br />
17