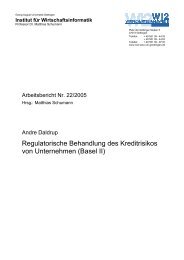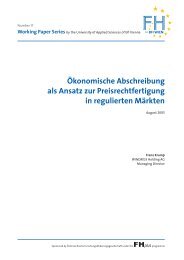Bewältigung von Personalentlassungen durch Gestaltung ... - EconBiz
Bewältigung von Personalentlassungen durch Gestaltung ... - EconBiz
Bewältigung von Personalentlassungen durch Gestaltung ... - EconBiz
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Beibehaltung des Ziels der Vollbeschäftigung mit der pragmatischen Politik des<br />
Durchtauchens der ökonomischen Krise mittels Budgetdefiziten (Deficit-spending) (vgl.<br />
Lichtenberger 1997, S. 263) 29 . „Ende der 70er Jahre war der Traum vom „Durchtauchen“<br />
ausgeträumt. Österreich mußte sich <strong>von</strong> einem über<strong>durch</strong>schnittlichen<br />
Wachstumspfad in eine rezessionsanfällige Weltwirtschaft einordnen“ (Lichtenberger<br />
1997, S. 263f.).<br />
Angesichts der oben beschriebenen Entwicklungen rückten die Sozialplanziele finanzielle<br />
Absicherung bei Arbeitslosigkeit sowie Überbrückung der Zeit bis zum Übergang in<br />
Rente in den Vordergrund (vgl. Kirsch u.a. 1999, S. 10). In beiden Ländern wurde eine<br />
sowohl vom Gesetzgeber als auch <strong>von</strong> betrieblicher Seite viele Jahre geförderte Strategie,<br />
die Freisetzungen auf ältere Arbeitskräfte zu konzentrieren, verfolgt.<br />
3.2 Grenzen der klassischen Sozialplanpolitik in Deutschland und Österreich 30<br />
Betriebliche Grenzen<br />
Die betriebliche Praxis, sich bei unvermeidlichen Personalreduktionen vorwiegend auf<br />
ältere Beschäftigte zu konzentrieren, stößt an ihre Grenzen. Aufgrund der Nutzung der<br />
verschiedenen Vor-Vorruhestandsmodelle in vielen Betrieben sind die älteren Jahrgänge<br />
schon sehr stark ausgedünnt. Es müßten somit bei weiterem Personalabbau auch jüngere<br />
Beschäftigte miteinbezogen werden. Dieses dürfte die finanziellen Möglichkeiten der<br />
Betriebe weit übersteigen. Zum einen müßten die Lohnersatzleistungen bis zur Rente<br />
über immer längere Zeitspannen aufgestockt werden und zum anderen wurden in den<br />
letzten Jahren die gesetzlichen Bestimmungen gegen den passiven Personalabbau<br />
verschärft (siehe Abschnitt 3.3). Zudem fehlten den Unternehmen für Investitionen in die<br />
Zukunft die finanziellen Mittel, wenn sie enorme Summen für passive Sozialpläne<br />
verwenden. Im allgemeinen entstehen den Betrieben bei dieser Art des Personalabbaus<br />
immense betriebswirtschaftliche Kosten 31 . Auch muß das Unternehmen u.U. auf ältere<br />
Mitarbeiter verzichten, die als Wissens- und Erfahrungsträger des Unternehmens gelten.<br />
29 Auch in Österreich kam es seit Mitte der 70er Jahre zu einer Abnahme der Zahl der Industriebeschäftigten<br />
(vgl. Lichtenberger 1997, S. 264), jedoch hatte die verstaatlichte Industrie eine<br />
beschäftigungs- und regionalpolitische Funktion inne (vgl. Lichtenberger 1997, S. 275). Z.B.<br />
verzeichnete die Gesamtindustrie im Jahre 1975 einen Beschäftigungsrückgang <strong>von</strong> 5,1%, während die<br />
verstaatlichte Industrie ein Beschäftigungswachstum <strong>von</strong> immerhin 0,9% zu verbuchen hatte (vgl.<br />
Quelle: Weber 1986, S. 24, zit. nach Lichtenberger 1997, S. 275). D.h., das österreichische<br />
Beschäftigungswunder gründete sich auf die massive Stützung der staatlichen Industrie (vgl.<br />
Lichtenberger 1997, S. 263f.). Daneben trugen „... die schon vor Beginn der Rezession beschlossene<br />
Steuerreform und Arbeitszeitverkürzung, der aufgestaute Nachholbedarf im Dienstleistungssektor, der<br />
Rückgang der Erwerbsquote sowie die beträchtliche „Abwanderung“ ausländischer Arbeitskräfte ...“ zu<br />
diesem österreichischen Beschäftigungswunder bei (Fach/Gierszewski 1985, S. 283).<br />
30 Anregungen zu diesem Abschnitt kamen aus folgender Literatur: Bergmann u.a. 1995; Kirsch u.a.<br />
1999; Knuth 1997; Knuth/Vanselow 1995; Müller 2000; Muth 2000; Neumann/Spies 1995; Schrader<br />
1998.<br />
31 Laut einer Erhebung des Instituts der deutschen Wirtschaft betrugen die Kosten für Sozialpläne im<br />
Jahre 1994 <strong>durch</strong>schnittlich 20 000 DM pro Kopf. In noch finanzstarken Großunternehmen, die vorsorglich<br />
Sanierungsmaßnahmen einleiten, werden vier- bis achtfache Summen bezahlt (vgl. Knuth<br />
1997, S. 203).<br />
23