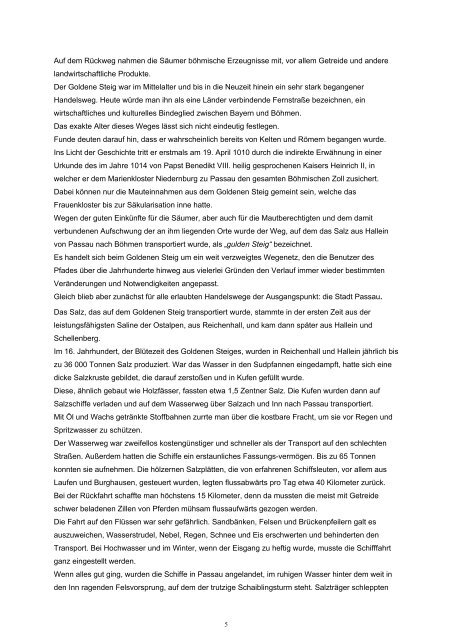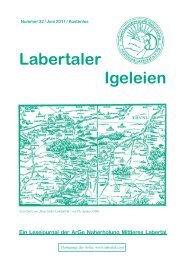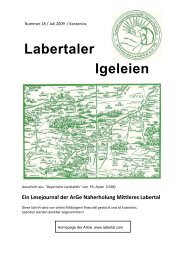Juni 2010 - Mittleres Labertal
Juni 2010 - Mittleres Labertal
Juni 2010 - Mittleres Labertal
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Auf dem Rückweg nahmen die Säumer böhmische Erzeugnisse mit, vor allem Getreide und andere<br />
landwirtschaftliche Produkte.<br />
Der Goldene Steig war im Mittelalter und bis in die Neuzeit hinein ein sehr stark begangener<br />
Handelsweg. Heute würde man ihn als eine Länder verbindende Fernstraße bezeichnen, ein<br />
wirtschaftliches und kulturelles Bindeglied zwischen Bayern und Böhmen.<br />
Das exakte Alter dieses Weges lässt sich nicht eindeutig festlegen.<br />
Funde deuten darauf hin, dass er wahrscheinlich bereits von Kelten und Römern begangen wurde.<br />
Ins Licht der Geschichte tritt er erstmals am 19. April 1010 durch die indirekte Erwähnung in einer<br />
Urkunde des im Jahre 1014 von Papst Benedikt VIII. heilig gesprochenen Kaisers Heinrich II, in<br />
welcher er dem Marienkloster Niedernburg zu Passau den gesamten Böhmischen Zoll zusichert.<br />
Dabei können nur die Mauteinnahmen aus dem Goldenen Steig gemeint sein, welche das<br />
Frauenkloster bis zur Säkularisation inne hatte.<br />
Wegen der guten Einkünfte für die Säumer, aber auch für die Mautberechtigten und dem damit<br />
verbundenen Aufschwung der an ihm liegenden Orte wurde der Weg, auf dem das Salz aus Hallein<br />
von Passau nach Böhmen transportiert wurde, als „gulden Steig“ bezeichnet.<br />
Es handelt sich beim Goldenen Steig um ein weit verzweigtes Wegenetz, den die Benutzer des<br />
Pfades über die Jahrhunderte hinweg aus vielerlei Gründen den Verlauf immer wieder bestimmten<br />
Veränderungen und Notwendigkeiten angepasst.<br />
Gleich blieb aber zunächst für alle erlaubten Handelswege der Ausgangspunkt: die Stadt Passau.<br />
Das Salz, das auf dem Goldenen Steig transportiert wurde, stammte in der ersten Zeit aus der<br />
leistungsfähigsten Saline der Ostalpen, aus Reichenhall, und kam dann später aus Hallein und<br />
Schellenberg.<br />
Im 16. Jahrhundert, der Blütezeit des Goldenen Steiges, wurden in Reichenhall und Hallein jährlich bis<br />
zu 36 000 Tonnen Salz produziert. War das Wasser in den Sudpfannen eingedampft, hatte sich eine<br />
dicke Salzkruste gebildet, die darauf zerstoßen und in Kufen gefüllt wurde.<br />
Diese, ähnlich gebaut wie Holzfässer, fassten etwa 1,5 Zentner Salz. Die Kufen wurden dann auf<br />
Salzschiffe verladen und auf dem Wasserweg über Salzach und Inn nach Passau transportiert.<br />
Mit Öl und Wachs getränkte Stoffbahnen zurrte man über die kostbare Fracht, um sie vor Regen und<br />
Spritzwasser zu schützen.<br />
Der Wasserweg war zweifellos kostengünstiger und schneller als der Transport auf den schlechten<br />
Straßen. Außerdem hatten die Schiffe ein erstaunliches Fassungs-vermögen. Bis zu 65 Tonnen<br />
konnten sie aufnehmen. Die hölzernen Salzplätten, die von erfahrenen Schiffsleuten, vor allem aus<br />
Laufen und Burghausen, gesteuert wurden, legten flussabwärts pro Tag etwa 40 Kilometer zurück.<br />
Bei der Rückfahrt schaffte man höchstens 15 Kilometer, denn da mussten die meist mit Getreide<br />
schwer beladenen Zillen von Pferden mühsam flussaufwärts gezogen werden.<br />
Die Fahrt auf den Flüssen war sehr gefährlich. Sandbänken, Felsen und Brückenpfeilern galt es<br />
auszuweichen, Wasserstrudel, Nebel, Regen, Schnee und Eis erschwerten und behinderten den<br />
Transport. Bei Hochwasser und im Winter, wenn der Eisgang zu heftig wurde, musste die Schifffahrt<br />
ganz eingestellt werden.<br />
Wenn alles gut ging, wurden die Schiffe in Passau angelandet, im ruhigen Wasser hinter dem weit in<br />
den Inn ragenden Felsvorsprung, auf dem der trutzige Schaiblingsturm steht. Salzträger schleppten<br />
5