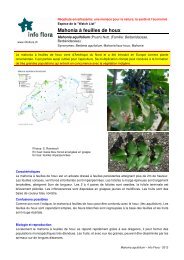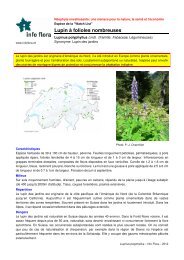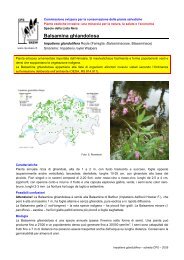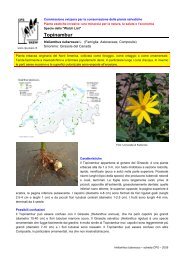Invasive Neophyten in der Schweiz: Lagebericht und ...
Invasive Neophyten in der Schweiz: Lagebericht und ...
Invasive Neophyten in der Schweiz: Lagebericht und ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
24<br />
Riesenbärenklau, Herkulesstaude (Heracleum mantegazzianum, Doldengewächse)<br />
Aus dem Kaukasus stammend, breitet sich diese über 3 m hohe Staude auch <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Schweiz</strong> zunehmend aus, vor allem an<br />
Waldrän<strong>der</strong>n, <strong>in</strong> Wiesen, im Uferbereich von Gewässern, an Wegrän<strong>der</strong>n <strong>und</strong> auf Ödland bis <strong>in</strong> die subalp<strong>in</strong>e Stufe. Die<br />
Staude bildet dichte Bestände <strong>und</strong> beschattet mit den riesigen Blättern den Unterwuchs, so dass die e<strong>in</strong>heimische<br />
Vegetation durch Lichtmangel verdrängt wird. Zudem ist die Pflanze giftig: Berührung bei gleichzeitiger o<strong>der</strong><br />
nachfolgen<strong>der</strong> direkter Sonnene<strong>in</strong>strahlung führt zu unangenehmen Hautentzündungen mit so starker Blasenbildung, dass<br />
Narben zurückbleiben können. Somit stellt <strong>der</strong> Riesenbärenklau e<strong>in</strong> ges<strong>und</strong>heitliches Risiko dar <strong>und</strong> wird an vielen Stellen<br />
bekämpft. Dabei können, wie aus dem Merkblatt unter www.naturschutz.zh.ch zu ersehen ist, relativ gute Erfolge erzielt<br />
werden, <strong>in</strong>dem <strong>der</strong> die Wachstumszone mit e<strong>in</strong>em 10-15 cm tiefen Spatenstich von <strong>der</strong> Wurzel vollständig abgetrennt <strong>und</strong><br />
entsorgt wird. Selbstverständlich muss auch das Aufkommen neuer Pflanzen aus <strong>der</strong> langlebigen Samenbank verh<strong>in</strong><strong>der</strong>t<br />
werden.<br />
Drüsiges Spr<strong>in</strong>gkraut (Impatiens glandulifera, Balsam<strong>in</strong>engewächse)<br />
Aus dem Himalaja als Zierpflanze e<strong>in</strong>geführt, kann diese raschwüchsige bis 2 m grosse, e<strong>in</strong>jährige Pflanze an<br />
Wasserläufen, nassen Stellen, <strong>in</strong> Auen <strong>und</strong> Waldschlägen dichte Re<strong>in</strong>bestände aufbauen. Die Art breitet sich dank des<br />
Schleu<strong>der</strong>mechanismus <strong>der</strong> Frucht <strong>und</strong> durch Mitschwemmung an Gewässern rasch aus. Dichte Bestände des Spr<strong>in</strong>gkrautes<br />
führen zu e<strong>in</strong>er Verarmung <strong>der</strong> Begleitvegetation durch Lichtentzug. In Wäl<strong>der</strong>n verh<strong>in</strong><strong>der</strong>t es die Verjüngung. Entlang von<br />
Gewässern verdrängt es die e<strong>in</strong>heimische Ufervegetation mit <strong>der</strong> Folge, dass nach dem Absterben <strong>der</strong> Stängel im Herbst<br />
offene Stellen entstehen, die erosionsgefährdet s<strong>in</strong>d. E<strong>in</strong>e erfolgreiche E<strong>in</strong>dämmung kle<strong>in</strong>er Bestände ist durch Ausreissen<br />
möglich. Grössere Bestände s<strong>in</strong>d unmittelbar vor dem Blühen zu mähen. Wegen Aufkommen neuer Pflanzen aus <strong>der</strong><br />
Samenbank s<strong>in</strong>d diese Masnahmen während mehrerer Jahre fortzuführen (E<strong>in</strong>zelheiten siehe www.naturschutz.zh.ch).<br />
Japanischer Staudenknöterich (Reynoutria japonica = Fallopia japonica = Polygonum cuspidatum,<br />
Knöterichgewächse)<br />
Der Japanische Staudenknöterich ist e<strong>in</strong>e raschwüchsige, 1-3 m hohe kräftige Staude mit dicken unterirdischen<br />
Kriechsprossen (Rhizome) bis <strong>in</strong> über 1 m Tiefe. Die Art stammt aus Asien <strong>und</strong> wurde als Zierstaude e<strong>in</strong>geführt. Sie ist weit<br />
verbreitet <strong>und</strong> häufig im Uferbereich von Gewässern, <strong>in</strong> Waldrän<strong>der</strong>n <strong>und</strong> Hecken, auf Schuttplätzen des Tieflandes bis zur<br />
unteren Bergstufe. In mehreren europäischen Län<strong>der</strong>n sowie im östlichen Nordamerika <strong>und</strong> <strong>in</strong> Neuseeland ist die Art e<strong>in</strong><br />
gefürchtetes Unkraut. Die Art stellt heute durch grossflächige Überwucherung e<strong>in</strong> Problem für den Naturschutz <strong>und</strong> den<br />
Unterhalt von Bahntrassen <strong>und</strong> Gewässerufern dar. Hier kann <strong>der</strong> Staudenknöterich u.a. Uferbefestigungen durchwachsen<br />
<strong>und</strong> lockern <strong>und</strong> so die Erosion för<strong>der</strong>n.<br />
Wie bei www.naturschutz.zh.ch zu ersehen ist, ist <strong>der</strong> Staudenknöterich selbst mit Herbiziden kaum erfolgreich zu<br />
bekämpfen, vor allem wegen <strong>der</strong> tief gelegenen Rhizome <strong>und</strong> weil bereits 2 cm grosse Ausläuferstücke wie<strong>der</strong> austreiben<br />
können. Deshalb kommt <strong>der</strong> Prävention grösste Bedeutung zu!<br />
Aufrechte Ambrosie o<strong>der</strong> Traubenkraut (Ambrosia artemisiifolia, Korbblütler)<br />
Die Ambrosie ist e<strong>in</strong>e 20-90 cm hohe e<strong>in</strong>jährige Pflanzenart, die mit ihren verschiedenen Rassen e<strong>in</strong>en ursprünglichen<br />
Verbreitungsschwerpunkt <strong>in</strong> den östlichen USA hat. In die <strong>Schweiz</strong> gelangte Ambrosia als Verunre<strong>in</strong>igung <strong>in</strong> Saatgut <strong>und</strong><br />
Vogelfutter sowie bei Genf mit Erntemasch<strong>in</strong>en aus Frankreich. Ins Tess<strong>in</strong> gelangte die Art u.a. durch Samen <strong>in</strong> den Pneus<br />
von Automobilen (Ciotti & Maspoli 2004). E<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>zelne Pflanze kann <strong>in</strong> den vielen kle<strong>in</strong>en Blüten <strong>in</strong>sgesamt bis 60'000<br />
viele Jahre keimfähige Samen bilden.<br />
Die Ambrosie kann auf trockenen, nährstoffreichen, lockeren, auch salzhaltigen Böden <strong>in</strong> warmen Lagen Bestände von<br />
vielen Aren bilden. Bevorzugte Wuchsorte s<strong>in</strong>d Schuttstellen, Rabatten, Wegrän<strong>der</strong>, Gebüsch <strong>und</strong> Äcker des Tieflandes<br />
<strong>und</strong> <strong>der</strong> Hügelstufe.<br />
Der Pollen von Ambrosia ruft bei > 10 % <strong>der</strong> Bevölkerung starke Allergien auf <strong>der</strong> Haut, Asthma <strong>und</strong> Atemnot hervor <strong>und</strong><br />
zwar zur Blütezeit im Juli-Oktober, d.h. wenn <strong>der</strong> Gräserpollen bereits am Abkl<strong>in</strong>gen ist (Köhler 2003). In Kanada, <strong>in</strong><br />
Ungarn (wo es nationale Bekämpfungstage gibt) <strong>und</strong> <strong>in</strong> Südosteuropa stellt Ambrosia e<strong>in</strong> grosses ges<strong>und</strong>heitliches Problem<br />
dar, mit jählichen Kosten <strong>in</strong> Dutzenden von Mio CHF. In Frankreich werden <strong>in</strong> <strong>der</strong> Region Rhône-Alpes für Information<br />
über Ambrosia jährlich 250'000 CHF ausgegeben <strong>und</strong> 100’000 Menschen haben ges<strong>und</strong>heitliche Probleme mit<br />
entsprechen<strong>der</strong> Kostenfolge. Ähnlich ist die Situation <strong>in</strong> <strong>der</strong> Lombardei, wenige Kilometer von <strong>der</strong> schweizer Grenze<br />
entfernt; die Azienda Sanitaria della Prov<strong>in</strong>cia di Milano 1 schätzt die von Ambrosia verursachten jährlichen Kosten im<br />
Ges<strong>und</strong>heitsbereich auf über 1 Mio CHF (Ciotti & Maspoli 2004). In <strong>der</strong> <strong>Schweiz</strong> kommt Ambrosia bisher vor allem bei<br />
Genf vor, wo sie im Jahr 2003 schon 21 ha Landwirtschaftsland „<strong>in</strong>fiziert“ hat (Maurer 2003) sowie im Südtess<strong>in</strong> <strong>und</strong> bei<br />
Basel. Die Art ist <strong>in</strong> rascher Ausbreitung begriffen.<br />
Die Pflanzen lassen sich leicht (mit Handschuhen) ausreissen, was aber geschehen sollte, bevor sich die Blüten öffnen.<br />
Die Ambrosie stellt e<strong>in</strong> Beipiel dar, wo durch rechtzeitiges E<strong>in</strong>greifen, d.h. bevor die Art weit verbreitet ist, künftige<br />
Probleme <strong>und</strong> Kosten vermieden werden können.<br />
Weitere Details zu Verbreitung, Schadwirkungen <strong>und</strong> Bekämpfung <strong>der</strong> Ambrosie geben z.B. Delabays et al. (2002), Ciotti<br />
& Maspoli (2004), Jeanmonod et al. (2002, 2003) <strong>und</strong> Maurer (2003).