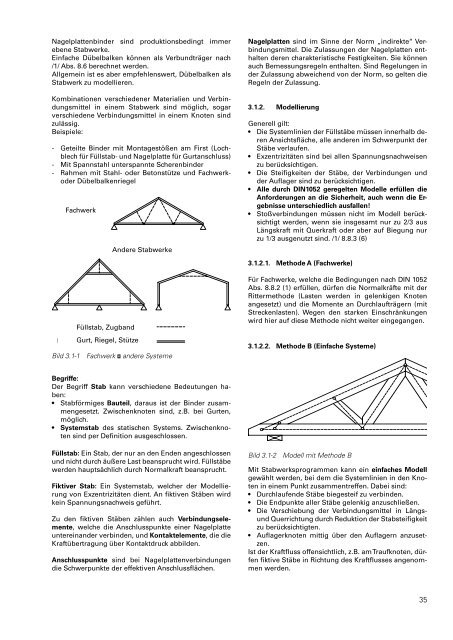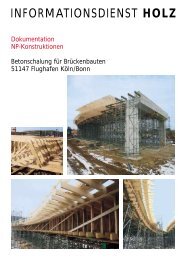Nagelplattenbinder nach DIN 1052:2008-12 - Gütegemeinschaft ...
Nagelplattenbinder nach DIN 1052:2008-12 - Gütegemeinschaft ...
Nagelplattenbinder nach DIN 1052:2008-12 - Gütegemeinschaft ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Nagelplattenbinder</strong> sind produktionsbedingt immer<br />
ebene Stabwerke.<br />
Einfache Dübelbalken können als Verbundträger <strong>nach</strong><br />
/1/ Abs. 8.6 berechnet werden.<br />
Allgemein ist es aber empfehlenswert, Dübelbalken als<br />
Stabwerk zu modellieren.<br />
Kombinationen verschiedener Materialien und Verbindungsmittel<br />
in einem Stabwerk sind möglich, sogar<br />
verschiedene Verbindungsmittel in einem Knoten sind<br />
zulässig.<br />
Beispiele:<br />
- Geteilte Binder mit Montagestößen am First (Lochblech<br />
für Füllstab- und Nagelplatte für Gurtanschluss)<br />
- Mit Spannstahl unterspannte Scherenbinder<br />
- Rahmen mit Stahl- oder Betonstütze und Fachwerk-<br />
oder Dübelbalkenriegel<br />
Fachwerk<br />
Füllstab, Zugband<br />
Gurt, Riegel, Stütze<br />
Andere Stabwerke<br />
Bild 3.1-1 Fachwerk ↔ andere Systeme<br />
Begriffe:<br />
Der Begriff Stab kann verschiedene Bedeutungen haben:<br />
• Stabförmiges Bauteil, daraus ist der Binder zusammengesetzt.<br />
Zwischenknoten sind, z.B. bei Gurten,<br />
möglich.<br />
• Systemstab des statischen Systems. Zwischenknoten<br />
sind per Definition ausgeschlossen.<br />
Füllstab: Ein Stab, der nur an den Enden angeschlossen<br />
und nicht durch äußere Last beansprucht wird. Füllstäbe<br />
werden hauptsächlich durch Normalkraft beansprucht.<br />
Fiktiver Stab: Ein Systemstab, welcher der Modellierung<br />
von Exzentrizitäten dient. An fiktiven Stäben wird<br />
kein Spannungs<strong>nach</strong>weis geführt.<br />
Zu den fiktiven Stäben zählen auch Verbindungselemente,<br />
welche die Anschlusspunkte einer Nagelplatte<br />
untereinander verbinden, und Kontaktelemente, die die<br />
Kraftübertragung über Kontaktdruck abbilden.<br />
Anschlusspunkte sind bei Nagelplattenverbindungen<br />
die Schwerpunkte der effektiven Anschlussflächen.<br />
Nagelplatten sind im Sinne der Norm „indirekte“ Verbindungsmittel.<br />
Die Zulassungen der Nagelplatten enthalten<br />
deren charakteristische Festigkeiten. Sie können<br />
auch Bemessungsregeln enthalten. Sind Regelungen in<br />
der Zulassung abweichend von der Norm, so gelten die<br />
Regeln der Zulassung.<br />
3.1.2. Modellierung<br />
Generell gilt:<br />
• Die Systemlinien der Füllstäbe müssen innerhalb deren<br />
Ansichtsfläche, alle anderen im Schwerpunkt der<br />
Stäbe verlaufen.<br />
• Exzentrizitäten sind bei allen Spannungs<strong>nach</strong>weisen<br />
zu berücksichtigen.<br />
• Die Steifigkeiten der Stäbe, der Verbindungen und<br />
der Auflager sind zu berücksichtigen.<br />
• Alle durch <strong>DIN</strong><strong>1052</strong> geregelten Modelle erfüllen die<br />
Anforderungen an die Sicherheit, auch wenn die Ergebnisse<br />
unterschiedlich ausfallen!<br />
• Stoßverbindungen müssen nicht im Modell berücksichtigt<br />
werden, wenn sie insgesamt nur zu 2/3 aus<br />
Längskraft mit Querkraft oder aber auf Biegung nur<br />
zu 1/3 ausgenutzt sind. /1/ 8.8.3 (6)<br />
3.1.2.1. Methode A (Fachwerke)<br />
Für Fachwerke, welche die Bedingungen <strong>nach</strong> <strong>DIN</strong> <strong>1052</strong><br />
Abs. 8.8.2 (1) erfüllen, dürfen die Normalkräfte mit der<br />
Rittermethode (Lasten werden in gelenkigen Knoten<br />
angesetzt) und die Momente an Durchlaufträgern (mit<br />
Strecken lasten). Wegen den starken Einschränkungen<br />
wird hier auf diese Methode nicht weiter eingegangen.<br />
3.1.2.2. Methode B (Einfache Systeme)<br />
Bild 3.1-2 Modell mit Methode B<br />
Mit Stabwerksprogrammen kann ein einfaches Modell<br />
gewählt werden, bei dem die Systemlinien in den Knoten<br />
in einem Punkt zusammentreffen. Dabei sind:<br />
• Durchlaufende Stäbe biegesteif zu verbinden.<br />
• Die Endpunkte aller Stäbe gelenkig anzuschließen.<br />
• Die Verschiebung der Verbindungsmittel in Längs-<br />
und Querrichtung durch Reduktion der Stabsteifigkeit<br />
zu berücksichtigten.<br />
• Auflagerknoten mittig über den Auflagern anzusetzen.<br />
Ist der Kraftfluss offensichtlich, z.B. am Traufknoten, dürfen<br />
fiktive Stäbe in Richtung des Kraftflusses angenommen<br />
werden.<br />
35