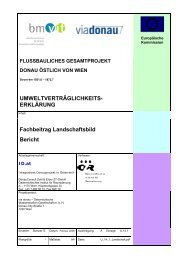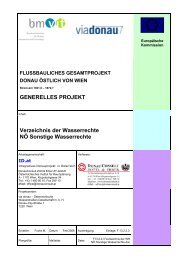Bericht (PDF 12.501 KB)
Bericht (PDF 12.501 KB)
Bericht (PDF 12.501 KB)
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
FLUSSBAULICHES GESAMTPROJEKT DONAU ÖSTLICH VON WIEN UMWELTVERTRÄGLICHKEITSERKLÄRUNG<br />
FACHBEITRAG GRUNDWASSER<br />
Name des Schongebietes Landesgesetzblattnummer<br />
Schongebiet Marchfeld LGBl.6950/22-0<br />
Tabelle 7: Vorhandene Grundwasserschutz- und –schongebiete (Amt der NÖ-Landesregierung Wasserbuch bzw.<br />
Wasserdatenverbund)<br />
Für das Marchfeld besteht seit 1964 eine wasserwirtschaftliche Rahmenverfügung:<br />
• Verordnung des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft vom 21. Feber 1964, mit der<br />
eine wasserwirtschaftliche Rahmenverfügung für das Marchfeld erlassen wird (BGBl. Nr.<br />
32/1964)<br />
Der wesentliche Punkt der Rahmenverfügung ist die Festlegung des öffentlichen Interesses an der<br />
quantitativen und qualitativen Erhaltung des Grundwasservorkommens Marchfeld.<br />
3.2.2 HYDROGEOLOGIE<br />
3.2.2.1 Geologie Wiener Becken<br />
Da die Geologie des Bereiches „Donau östlich von Wien“ nur im Zusammenhang mit der Anlage<br />
des übergeordneten geologischen Systems, dem Wiener Becken, zu verstehen ist, wird anfänglich<br />
auf Geologie und Geodynamik des Wiener Beckens eingegangen.<br />
Das Wiener Becken (vgl. Abbildung 21) reicht von Gloggnitz im Süden bis Hodonin im Norden (ca.<br />
250 km) und von Wien im Westen bis Bratislava im Osten (ca. 60 km). Das rhomboidförmige Becken<br />
ist allseits von alpinen geologischen Einheiten wie Flysch-, Kalkalpen-, Grauwacken- und<br />
Zentralalpine Zone umgeben. Die Donau teilt es in ein nördliches und ein südliches Wiener Becken.<br />
Das Wiener Becken ist ein tektonisches Zerrungsbecken, das eng mit der Entstehung der Alpen<br />
verknüpft ist. Vor ca. 17 Mio. Jahren (im Karpatium; vgl. stratigrafische Tabelle des Känozoikums,<br />
Tabelle 8) begann der Alpen-Karpaten-Körper im Bereich des südlichen Wiener Beckens aufgrund<br />
einer West-Ost-gerichteten Dehnung entlang von tektonischen Störungslinien sukzessive einzusinken.<br />
Die verschiedenen alpinen Zonen (Flysch-, Kalkalpen-, Grauwacken- und Zentralalpine<br />
Zone) setzen sich im Untergrund des Beckens fort und bilden die Basis einer miozänen, syntektonisch<br />
sedimentierten Beckenfüllung, die bis zu mehrere Kilometer mächtige Ablagerungen in unterschiedlicher<br />
Fazies (marin, brackisch, limnisch, in Randbereichen des Beckens fluviatil) umfasst.<br />
Die Schichten fallen von der ehemaligen Uferlinie des miozänen Meeres, dem Bisamberg im Westen<br />
bzw. den Hundsheimer und den Hainburger Bergen im Osten, flach gegen das Beckeninnere<br />
ein und sind durch Gräben- und Staffelbrüche unterschiedlich stark abgesenkt, sodass eine Strukturierung<br />
des Beckens durch Depressionen entstand. Die stärkste Einsenkung des präneogenen<br />
Untergrundes ist das so genannte Schwechat Tief. Hier ist die Basis der miozänen Schichten, d.h.<br />
die Oberkante des alpinen Körpers, mit ca. 5,5 km am tiefsten abgesenkt, d.h. in diesem Bereich<br />
erfolgte die mächtigste miozäne Sedimentation im Wiener Becken.<br />
PROJEKTWERBER: via donau VERFASSER: Dr. Alfred Paul BLASCHKE<br />
FEBRUAR 2006 SEITE 34