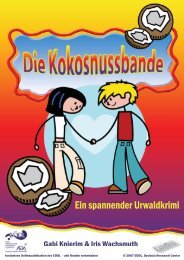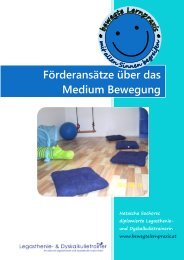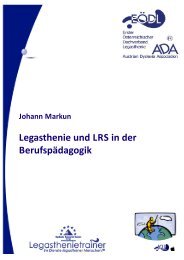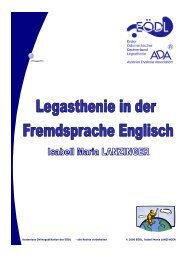Pädagogische Intervention bei Kindern mit Legasthenie - Bücher für ...
Pädagogische Intervention bei Kindern mit Legasthenie - Bücher für ...
Pädagogische Intervention bei Kindern mit Legasthenie - Bücher für ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
2 Zum Verständnis neuropsychologischer Zusammenhänge<br />
die entsprechende Informationsverar<strong>bei</strong>tung durchzuführen, so kann gegebenenfalls ein ande-<br />
res Areal diese Funktion übernehmen, da das Gehirn bemerkenswerte Plastizität aufweist (vgl.<br />
Hofmann 2005, in: Hofmann/Sasse 2005, S. 92).<br />
Der Erwerb einer Schriftsprache ist ein bewusster und nicht angeborener Prozess, der erlernt<br />
werden muss und nur in Verbindung <strong>mit</strong> dem bewussten Umgang <strong>mit</strong> Schrift funktioniert.<br />
Das Erlernen der Schriftsprache ist ein kognitiver Prozess, <strong>bei</strong> dem die Kinder Regeln über<br />
das Verhältnis von Sprache und Schrift entwickeln sowie Strategien zum Erlesen neuer Wör-<br />
ter bilden. Dieser Prozess stellt <strong>für</strong> Kinder zumeist eine große Herausforderung dar. Beim<br />
Erlernen des Lesens und Rechtschreibens bedarf es, anders als <strong>bei</strong> der Aneignung mündlicher<br />
Sprache, die <strong>für</strong> die meisten Kinder relativ mühelos verläuft, einer gezielten Instruktion. Al-<br />
lerdings beginnt der Zugang zur Schrift in den meisten Kulturen nicht erst <strong>mit</strong> dem Schulein-<br />
tritt, da Kinder unentwegt <strong>mit</strong> dem Phänomen graphischer Schriftzeichen konfrontiert sind<br />
und in vielen Familien das Vorlesen eine wichtige Rolle einnimmt. Folglich begegnen Kinder<br />
graphischen Schriftzeichen, die sie erkennen 3 und auf diese Weise deuten können. Sie absol-<br />
vieren einen Lernprozess, <strong>bei</strong> dem sie mehrere Stadien des Schrift- und Leseerwerbsprozesses<br />
durchlaufen müssen (vgl. Dehn 1977, S. 282; Scheerer-Neumann et al. 1986, S. 89). Beim<br />
Schriftspracherwerb steht ein Kind einigen grundlegenden Strukturmerkmalen gegenüber. Die<br />
deutsche Sprache gehört zu den phonographischen Schriften, das bedeutet, dass lautliche Ei-<br />
genschaften der gesprochenen Sprache vorrangig notiert werden. Jedoch wird nicht jeder Laut<br />
von einem Buchstaben abgebildet. Die auf der Ebene der Phoneme und Grapheme bestehende<br />
Korrespondenz ist auch hier nicht eindeutig (vgl. Kirschhock 2004, S. 45). Zum einen wird<br />
die Beziehung zwischen Phonemen und Graphemen <strong>für</strong> einen Leseanfänger durch die phone-<br />
tische Mehrdeutigkeit kompliziert 4 , zum anderen ergeben sich Probleme durch die graphemi-<br />
sche Mehrdeutigkeit 5 . Diese unterschiedliche Schreibweise ist vor allem durch das <strong>für</strong> die<br />
deutsche Sprache konstituierende Prinzip der Stammerhaltung bedingt. Im Wesentlichen dient<br />
es der schnellen Wiedererkennung und da<strong>mit</strong> der Leserfreundlichkeit.<br />
Rechtschreibprozesse hingegen, die eine genaue orthographische Reproduktion erfordern,<br />
unterliegen wesentlich langwierigeren Lernprozessen. Zunächst gab es in der Forschung zum<br />
Schriftspracherwerb relativ willkürliche Vermutungen über die <strong>bei</strong>m Lesen und Schreiben<br />
ablaufenden Prozesse. Bis weit in die 70er Jahre hinein dominierte in der deutschsprachigen<br />
Forschung ein Ansatz, der nach den psychologischen Grundfaktoren vor allem des Lesens<br />
3 zuerst an sehr groben Merkmalen, z.B. dem Schriftzug etc.<br />
4 wenn also ein Graphem <strong>für</strong> mehrere Phoneme steht.<br />
5 wenn ein Phonem <strong>mit</strong> unterschiedlichen Graphemen oder Graphemclustern abgebildet wird.<br />
11