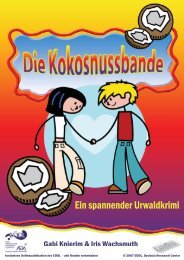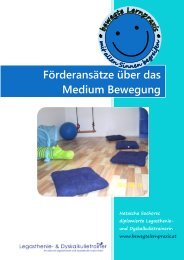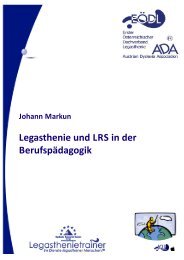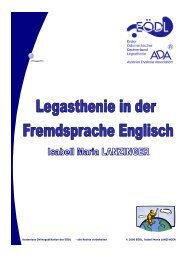Pädagogische Intervention bei Kindern mit Legasthenie - Bücher für ...
Pädagogische Intervention bei Kindern mit Legasthenie - Bücher für ...
Pädagogische Intervention bei Kindern mit Legasthenie - Bücher für ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
4 Kritische Betrachtung der Pathologisierung des Begriffs aus pädagogischer Perspektive<br />
und dem Laut nicht herstellen kann“ (Hartmann 1975, S. 10ff.). Im Falle einer verbalen<br />
<strong>Legasthenie</strong> hingegen bereitet das Wort dem Kind Schwierigkeiten (vgl. a.a.O., S. 11ff.). Wie<br />
Hartmann unterscheiden auch Hägi, Bürli und Mathis zwischen den <strong>bei</strong>den Erscheinungsfor-<br />
men der <strong>Legasthenie</strong>. Bei der literalen <strong>Legasthenie</strong> handelt es sich laut deren Ausführung um<br />
Schwierigkeiten <strong>bei</strong> der Bewältigung der Einzelbuchstaben (vgl. Hägi/Bürli/Mathis 1970, S.<br />
12ff.). Außerdem sind, nach Hägi, Bürli und Mathis, <strong>bei</strong> der <strong>Legasthenie</strong> die akustische und<br />
die optische Wahrnehmung gestört (vgl. a.a.O., S. 21ff.).<br />
Wurde <strong>Legasthenie</strong> in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts als „klassisches<br />
<strong>Legasthenie</strong>konzept“ <strong>mit</strong> charakteristischen visuellen Fehlern und einer Intelligenzdiskrepanz<br />
propagiert, so wird in den 70er Jahren zunächst zwischen „<strong>Legasthenie</strong>“ als Schwäche im<br />
Lesen und Rechtschreiben <strong>bei</strong> mindestens durchschnittlicher Intelligenz und Lese-<br />
Rechtschreibschwäche als Schwäche im Lesen und Rechtschreiben <strong>bei</strong> insgesamt<br />
unterdurchschnittlicher Intelligenz unterschieden und schließlich als „Unfug <strong>mit</strong> der<br />
<strong>Legasthenie</strong>“ gescholten und ad acta gelegt. Die Phänomenologie der <strong>Legasthenie</strong> wurde in<br />
den 70er Jahren um den Terminus „Lernstörung“, zusätzlich zum von Linder eingeführten<br />
Terminus Teilleistungsstörung, erweitert. Schenk-Danzinger, die dieser Problematik ein um-<br />
fassendes „Handbuch der <strong>Legasthenie</strong> im Kindesalter“ (1975) widmete, prägte den Begriff<br />
<strong>Legasthenie</strong> im deutschen Sprachraum. Sie differenziert zwischen zwei Arten der Legasthe-<br />
nie, der literalen <strong>Legasthenie</strong> (einer sehr seltenen Schwerstform der <strong>Legasthenie</strong>) und der ver-<br />
balen <strong>Legasthenie</strong>, von der gemäß neuesten Studien etwa 15% der Gesamtbevölkerung betrof-<br />
fen sind. Eine Einbindung der Ergebnisse von Diplompsychologin Dr. E. Klasen, die gemein-<br />
sam <strong>mit</strong> anderen Autoren Therapiefälle näher untersuchte, war ihr ein wichtiges Anliegen.<br />
Der Hauptschwerpunkt ihrer Forschungsar<strong>bei</strong>ten kann als vorwiegend symptomorientiert an-<br />
gesehen werden. Ferner setzte sie sich <strong>mit</strong> der von Valtin (1970b) aufgeworfenen Frage nach<br />
der Milieuabhängigkeit auseinander. Dies ist ein wesentlich zu beachtender Aspekt, da durch<br />
die Reihenuntersuchungen von unqualifizierten Personen um 1970 der Trugschluss gezogen<br />
wurde, dass Probleme im Erlernen der Rechtschreibung milieuabhängig seien und Legasthe-<br />
nie folglich ein Problem der Unterschicht sei. Die Einteilung in <strong>Legasthenie</strong> (auch spezielle<br />
LRS/Lese-Rechtschreibstörung 43 ) und LRS geht auf Grissemann zurück, der <strong>Legasthenie</strong><br />
gegen Ende der 60er Jahre als eine „global-gnostische Störung“ deutete und so<strong>mit</strong> einen<br />
neuen Beitrag zur Ätiologie leistete. In seinem Buch „<strong>Legasthenie</strong> und Rechenleistungen“<br />
43 Die meisten Autoren empfehlen in diesem Zusammenhang eine Trennung von „Störung“ und „Schwäche“, da<br />
davon ausgegangen wird, dass <strong>bei</strong>de unterschiedliche Gruppen <strong>mit</strong> verschiedener Genese sind (vgl. hierzu auch<br />
Schulte-Körne 2001a).<br />
41