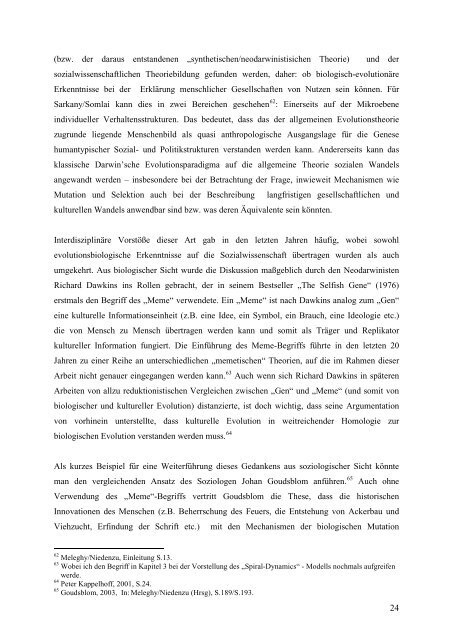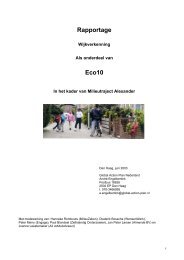David Kriegleder, Die Integral-Theorie Ken Wilbers ... - Integral World
David Kriegleder, Die Integral-Theorie Ken Wilbers ... - Integral World
David Kriegleder, Die Integral-Theorie Ken Wilbers ... - Integral World
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
(bzw. der daraus entstandenen „synthetischen/neodarwinistisichen <strong>Theorie</strong>) und der<br />
sozialwissenschaftlichen <strong>Theorie</strong>bildung gefunden werden, daher: ob biologisch-evolutionäre<br />
Erkenntnisse bei der Erklärung menschlicher Gesellschaften von Nutzen sein können. Für<br />
Sarkany/Somlai kann dies in zwei Bereichen geschehen 62<br />
: Einerseits auf der Mikroebene<br />
individueller Verhaltensstrukturen. Das bedeutet, dass das der allgemeinen Evolutionstheorie<br />
zugrunde liegende Menschenbild als quasi anthropologische Ausgangslage für die Genese<br />
humantypischer Sozial- und Politikstrukturen verstanden werden kann. Andererseits kann das<br />
klassische Darwin’sche Evolutionsparadigma auf die allgemeine <strong>Theorie</strong> sozialen Wandels<br />
angewandt werden – insbesondere bei der Betrachtung der Frage, inwieweit Mechanismen wie<br />
Mutation und Selektion auch bei der Beschreibung langfristigen gesellschaftlichen und<br />
kulturellen Wandels anwendbar sind bzw. was deren Äquivalente sein könnten.<br />
Interdisziplinäre Vorstöße dieser Art gab in den letzten Jahren häufig, wobei sowohl<br />
evolutionsbiologische Erkenntnisse auf die Sozialwissenschaft übertragen wurden als auch<br />
umgekehrt. Aus biologischer Sicht wurde die Diskussion maßgeblich durch den Neodarwinisten<br />
Richard Dawkins ins Rollen gebracht, der in seinem Bestseller „The Selfish Gene“ (1976)<br />
erstmals den Begriff des „Meme“ verwendete. Ein „Meme“ ist nach Dawkins analog zum „Gen“<br />
eine kulturelle Informationseinheit (z.B. eine Idee, ein Symbol, ein Brauch, eine Ideologie etc.)<br />
die von Mensch zu Mensch übertragen werden kann und somit als Träger und Replikator<br />
kultureller Information fungiert. <strong>Die</strong> Einführung des Meme-Begriffs führte in den letzten 20<br />
Jahren zu einer Reihe an unterschiedlichen „memetischen“ <strong>Theorie</strong>n, auf die im Rahmen dieser<br />
Arbeit nicht genauer eingegangen werden kann. 63 Auch wenn sich Richard Dawkins in späteren<br />
Arbeiten von allzu reduktionistischen Vergleichen zwischen „Gen“ und „Meme“ (und somit von<br />
biologischer und kultureller Evolution) distanzierte, ist doch wichtig, dass seine Argumentation<br />
von vorhinein unterstellte, dass kulturelle Evolution in weitreichender Homologie zur<br />
biologischen Evolution verstanden werden muss. 64<br />
Als kurzes Beispiel für eine Weiterführung dieses Gedankens aus soziologischer Sicht könnte<br />
man den vergleichenden Ansatz des Soziologen Johan Goudsblom anführen. 65<br />
Auch ohne<br />
Verwendung des „Meme“-Begriffs vertritt Goudsblom die These, dass die historischen<br />
Innovationen des Menschen (z.B. Beherrschung des Feuers, die Entstehung von Ackerbau und<br />
Viehzucht, Erfindung der Schrift etc.) mit den Mechanismen der biologischen Mutation<br />
62<br />
Meleghy/Niedenzu, Einleitung S.13.<br />
63<br />
Wobei ich den Begriff in Kapitel 3 bei der Vorstellung des „Spiral-Dynamics“ - Modells nochmals aufgreifen<br />
werde.<br />
64<br />
Peter Kappelhoff, 2001, S.24.<br />
65<br />
Goudsblom, 2003, In: Meleghy/Niedenzu (Hrsg), S.189/S.193.<br />
24