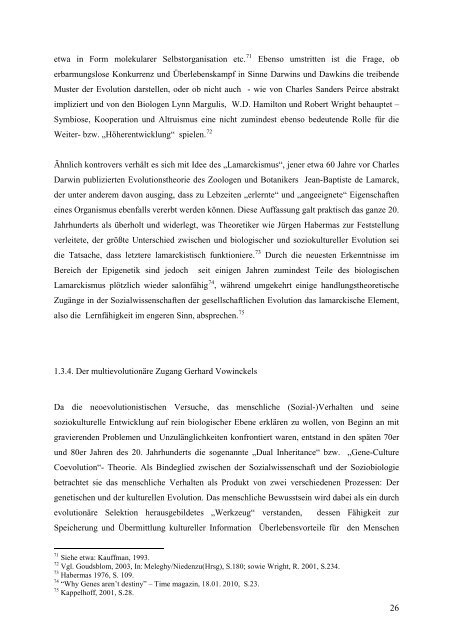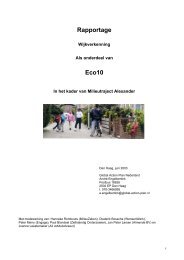David Kriegleder, Die Integral-Theorie Ken Wilbers ... - Integral World
David Kriegleder, Die Integral-Theorie Ken Wilbers ... - Integral World
David Kriegleder, Die Integral-Theorie Ken Wilbers ... - Integral World
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
etwa in Form molekularer Selbstorganisation etc. 71 Ebenso umstritten ist die Frage, ob<br />
erbarmungslose Konkurrenz und Überlebenskampf in Sinne Darwins und Dawkins die treibende<br />
Muster der Evolution darstellen, oder ob nicht auch - wie von Charles Sanders Peirce abstrakt<br />
impliziert und von den Biologen Lynn Margulis, W.D. Hamilton und Robert Wright behauptet –<br />
Symbiose, Kooperation und Altruismus eine nicht zumindest ebenso bedeutende Rolle für die<br />
Weiter- bzw. „Höherentwicklung“ spielen. 72<br />
Ähnlich kontrovers verhält es sich mit Idee des „Lamarckismus“, jener etwa 60 Jahre vor Charles<br />
Darwin publizierten Evolutionstheorie des Zoologen und Botanikers Jean-Baptiste de Lamarck,<br />
der unter anderem davon ausging, dass zu Lebzeiten „erlernte“ und „angeeignete“ Eigenschaften<br />
eines Organismus ebenfalls vererbt werden können. <strong>Die</strong>se Auffassung galt praktisch das ganze 20.<br />
Jahrhunderts als überholt und widerlegt, was Theoretiker wie Jürgen Habermas zur Feststellung<br />
verleitete, der größte Unterschied zwischen und biologischer und soziokultureller Evolution sei<br />
die Tatsache, dass letztere lamarckistisch funktioniere. 73 Durch die neuesten Erkenntnisse im<br />
Bereich der Epigenetik sind jedoch seit einigen Jahren zumindest Teile des biologischen<br />
Lamarckismus plötzlich wieder salonfähig 74 , während umgekehrt einige handlungstheoretische<br />
Zugänge in der Sozialwissenschaften der gesellschaftlichen Evolution das lamarckische Element,<br />
also die Lernfähigkeit im engeren Sinn, absprechen. 75<br />
1.3.4. Der multievolutionäre Zugang Gerhard Vowinckels<br />
Da die neoevolutionistischen Versuche, das menschliche (Sozial-)Verhalten und seine<br />
soziokulturelle Entwicklung auf rein biologischer Ebene erklären zu wollen, von Beginn an mit<br />
gravierenden Problemen und Unzulänglichkeiten konfrontiert waren, entstand in den späten 70er<br />
und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts die sogenannte „Dual Inheritance“ bzw. „Gene-Culture<br />
Coevolution“- <strong>Theorie</strong>. Als Bindeglied zwischen der Sozialwissenschaft und der Soziobiologie<br />
betrachtet sie das menschliche Verhalten als Produkt von zwei verschiedenen Prozessen: Der<br />
genetischen und der kulturellen Evolution. Das menschliche Bewusstsein wird dabei als ein durch<br />
evolutionäre Selektion herausgebildetes „Werkzeug“ verstanden, dessen Fähigkeit zur<br />
Speicherung und Übermittlung kultureller Information Überlebensvorteile für den Menschen<br />
71<br />
Siehe etwa: Kauffman, 1993.<br />
72<br />
Vgl. Goudsblom, 2003, In: Meleghy/Niedenzu(Hrsg), S.180; sowie Wright, R. 2001, S.234.<br />
73<br />
Habermas 1976, S. 109.<br />
74<br />
“Why Genes aren’t destiny” – Time magazin, 18.01. 2010, S.23.<br />
75<br />
Kappelhoff, 2001, S.28.<br />
26