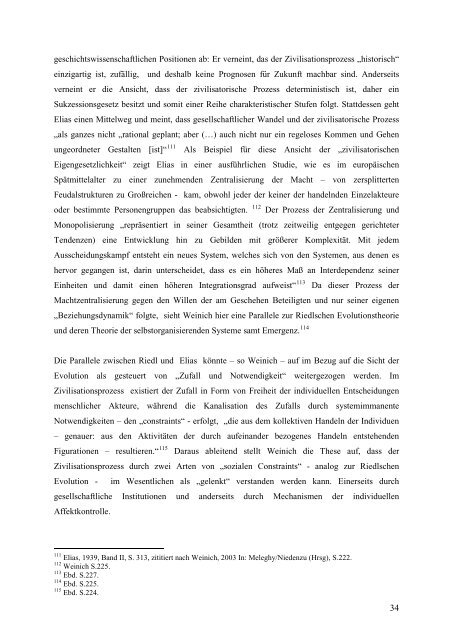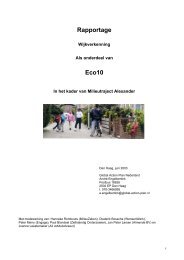David Kriegleder, Die Integral-Theorie Ken Wilbers ... - Integral World
David Kriegleder, Die Integral-Theorie Ken Wilbers ... - Integral World
David Kriegleder, Die Integral-Theorie Ken Wilbers ... - Integral World
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
geschichtswissenschaftlichen Positionen ab: Er verneint, das der Zivilisationsprozess „historisch“<br />
einzigartig ist, zufällig, und deshalb keine Prognosen für Zukunft machbar sind. Anderseits<br />
verneint er die Ansicht, dass der zivilisatorische Prozess deterministisch ist, daher ein<br />
Sukzessionsgesetz besitzt und somit einer Reihe charakteristischer Stufen folgt. Stattdessen geht<br />
Elias einen Mittelweg und meint, dass gesellschaftlicher Wandel und der zivilisatorische Prozess<br />
„als ganzes nicht „rational geplant; aber (…) auch nicht nur ein regeloses Kommen und Gehen<br />
ungeordneter Gestalten [ist]“ 111 Als Beispiel für diese Ansicht der „zivilisatorischen<br />
Eigengesetzlichkeit“ zeigt Elias in einer ausführlichen Studie, wie es im europäischen<br />
Spätmittelalter zu einer zunehmenden Zentralisierung der Macht – von zersplitterten<br />
Feudalstrukturen zu Großreichen - kam, obwohl jeder der keiner der handelnden Einzelakteure<br />
oder bestimmte Personengruppen das beabsichtigten. 112 Der Prozess der Zentralisierung und<br />
Monopolisierung „repräsentiert in seiner Gesamtheit (trotz zeitweilig entgegen gerichteter<br />
Tendenzen) eine Entwicklung hin zu Gebilden mit größerer Komplexität. Mit jedem<br />
Ausscheidungskampf entsteht ein neues System, welches sich von den Systemen, aus denen es<br />
hervor gegangen ist, darin unterscheidet, dass es ein höheres Maß an Interdependenz seiner<br />
Einheiten und damit einen höheren Integrationsgrad aufweist“ 113 Da dieser Prozess der<br />
Machtzentralisierung gegen den Willen der am Geschehen Beteiligten und nur seiner eigenen<br />
„Beziehungsdynamik“ folgte, sieht Weinich hier eine Parallele zur Riedlschen Evolutionstheorie<br />
und deren <strong>Theorie</strong> der selbstorganisierenden Systeme samt Emergenz. 114<br />
<strong>Die</strong> Parallele zwischen Riedl und Elias könnte – so Weinich – auf im Bezug auf die Sicht der<br />
Evolution als gesteuert von „Zufall und Notwendigkeit“ weitergezogen werden. Im<br />
Zivilisationsprozess existiert der Zufall in Form von Freiheit der individuellen Entscheidungen<br />
menschlicher Akteure, während die Kanalisation des Zufalls durch systemimmanente<br />
Notwendigkeiten – den „constraints“ - erfolgt, „die aus dem kollektiven Handeln der Individuen<br />
– genauer: aus den Aktivitäten der durch aufeinander bezogenes Handeln entstehenden<br />
Figurationen – resultieren.“ 115<br />
Daraus ableitend stellt Weinich die These auf, dass der<br />
Zivilisationsprozess durch zwei Arten von „sozialen Constraints“ - analog zur Riedlschen<br />
Evolution - im Wesentlichen als „gelenkt“ verstanden werden kann. Einerseits durch<br />
gesellschaftliche Institutionen und anderseits durch Mechanismen der individuellen<br />
Affektkontrolle.<br />
111<br />
Elias, 1939, Band II, S. 313, zititiert nach Weinich, 2003 In: Meleghy/Niedenzu (Hrsg), S.222.<br />
112<br />
Weinich S.225.<br />
113<br />
Ebd. S.227.<br />
114<br />
Ebd. S.225.<br />
115<br />
Ebd. S.224.<br />
34