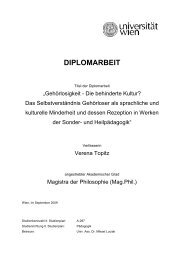Lesekompetenz gehörloser und schwerhöriger ... - Sonos
Lesekompetenz gehörloser und schwerhöriger ... - Sonos
Lesekompetenz gehörloser und schwerhöriger ... - Sonos
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Folgenden eingehender berücksichtigten IGLU 10 -Studie ist es erlaubt, „Schulen mit geistig,<br />
körperlich oder mehrfachbehinderten Schülerinnen <strong>und</strong> Schülern sowie sehr kleine Schulen<br />
(...) auszuschließen“ (Lankes et al. 2003, 11). Auch in IGLU werden Hörgeschädigtenschulen<br />
nicht einbezogen, wobei sie zu den „Sonderschulen, deren Kinder aus körperlichen oder<br />
geistigen Gründen den Test nicht durchführen konnten“ (Lankes et al. 2003, 12), gezählt<br />
werden. Da hörgeschädigte SchülerInnen jedoch zumeist über die körperlichen <strong>und</strong> geistigen<br />
Voraussetzungen verfügen, an solchen Testverfahren teilzunehmen, <strong>und</strong> während der<br />
gesamten Schulzeit in der Zielsprache „Deutsch“ unterrichtet werden, sind sie von beiden<br />
Studien aufgr<strong>und</strong> unzutreffender Kriterien ausgeschlossen worden. Weil diese Studien aber<br />
nach den internationalen Vorgaben bis zu 5% der SchülerInnenpopulation mit den<br />
aufgeführten Begründungen ausschließen können (Baumert & Artelt 2003, 21; Lankes et al.<br />
2003, 11), stellt es für sie kein entscheidendes methodisches Problem dar, dass die kleine<br />
Teilpopulation von SchülerInnen in Hörgeschädigtenschulen nicht berücksichtigt wird.<br />
Problematischer ist die fehlende Berücksichtigung für die Hörgeschädigtenpädagogik, weil<br />
die internationalen Studien in ein nationales Programm zur Etablierung von<br />
Bildungsstandards <strong>und</strong> dazugehörigen Evaluationsverfahren eingeb<strong>und</strong>en sind (KMK 2005a),<br />
das auch die Hörgeschädigtenschulen betrifft. Diese Entwicklung ist in der<br />
Hörgeschädigtenpädagogik nicht antizipiert worden: Weder sind die alarmierenden<br />
Ergebnisse derjenigen SonderschülerInnen, die an der PISA-Studie teilgenommen haben, 11 in<br />
der Hörgeschädigtenpädagogik diskutiert, noch sind die empirischen Verfahren auf die<br />
eigenen Schulen übertragen worden: So diskutiert etwa Müller (2002) die PISA-Studie aus<br />
Sicht der Hörgeschädigtenpädagogik, indem er die schwachen Ergebnisse im Leseverständnis<br />
hörender SchülerInnen in Deutschland <strong>und</strong> in der Schweiz in einen Zusammenhang mit „der<br />
vielerorts unbefriedigenden Klassenraumakustik“ bringt <strong>und</strong> der Sanierung der Klassenräume<br />
ein „großes Potenzial für eine Verbesserung der frustrierenden Ergebnisse, wie sie die PISA-<br />
10 „Internationale Gr<strong>und</strong>schul-Lese-Untersuchung“, deren internationaler Name PIRLS („Progress in<br />
International Reading Literacy Study“) lautet <strong>und</strong> die von der IEA (International Association for the Evaluation<br />
of Educational Achievement) organisiert wird.<br />
11 Diese SchülerInnen mit einem Förderschwerpunkt „Lernen“ <strong>und</strong> „emotionale <strong>und</strong> soziale Entwicklung“ bilden<br />
zu 34% die Gruppe der 10% „Risikoschülerinnen <strong>und</strong> –schüler“, die im Lesen bei PISA 2000 nicht die unterste<br />
Kompetenzstufe erreichen (Artelt et al. 2001, 116f.), die also 3,4% der gesamten Stichprobe entsprechen.<br />
Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass der Anteil der SonderschülerInnen mit einem Förderschwerpunkt<br />
„Lernen“ <strong>und</strong> „emotionale <strong>und</strong> soziale Entwicklung“ an der gesamten deutschen Schülerpopulation in diesem<br />
Schuljahr nur 2,6 %, der Gesamtanteil der SonderschülerInnen jedoch 4,2% ausmacht (Statistisches B<strong>und</strong>esamt<br />
2001a; Statistisches B<strong>und</strong>esamt 2007, Tabelle 3.1). Im Hinblick auf die PISA-Stichprobe werden also bestimmte<br />
Förderschwerpunkte nicht berücksichtigt, SonderschülerInnen sind als Ganzes gesehen aber vermutlich<br />
statistisch adäquat vertreten. Dass deren Ergebnis nicht breiter diskutiert wird, liegt auch daran, dass es in der<br />
PISA-Studie nicht deutlich genug ausgeführt wird <strong>und</strong> die SonderschülerInnen in weiterführenden<br />
Untersuchungen zu den schwachen LeserInnen in der PISA-Studie nicht berücksichtigt werden (Stanat &<br />
Schneider 2004, 254).<br />
10