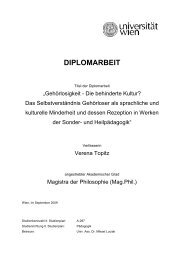- Seite 1 und 2: Lesekompetenz gehörloser und schwe
- Seite 3 und 4: 3 Lesekompetenz....................
- Seite 5 und 6: 0 Vorbemerkungen Die vorliegende Ar
- Seite 7 und 8: Ausdruck „Hörschädigung“ 3 ve
- Seite 9 und 10: Jahrhunderts in deutschen Taubstumm
- Seite 11 und 12: Studie ans Licht brachte“, zutrau
- Seite 13 und 14: Taubstummenklasse durchgeführt und
- Seite 15 und 16: Angesichts der fehlenden Berücksic
- Seite 17 und 18: schriftsprachliche Kompetenzen zeig
- Seite 19 und 20: c) Wenn der Unterricht nicht monoli
- Seite 21 und 22: dass deren Ergebnisse aus beiden Ve
- Seite 23 und 24: 6). Sieben von neun Hörgeschädigt
- Seite 25 und 26: vergleichen. Dadurch kann über den
- Seite 27: entsprechende Korrelation mit der L
- Seite 31 und 32: Förderschwerpunkt „Sehen“ oder
- Seite 33 und 34: dass sie von Geburt an eine Gebärd
- Seite 35 und 36: 1.8.1 Sonderpädagogische Förderbi
- Seite 37 und 38: ilinguale Unterricht mit dem gleich
- Seite 39 und 40: verläuft die Hör- und Sprachentwi
- Seite 41 und 42: Abb. 7 zeigt die Anzahl der Schüle
- Seite 43 und 44: ist unklar, wodurch diese Unterschi
- Seite 45 und 46: stattgefunden zu haben. Aufgrund de
- Seite 47 und 48: Schuljahr 16% „ausländische Sch
- Seite 49 und 50: 2.9 Einordnung in das Bildungssyste
- Seite 51 und 52: wenigen Jahren von der Indikation f
- Seite 53 und 54: und hörender Lehrkraft und fünf S
- Seite 55 und 56: Bezüglich Mehrfachbehinderungen un
- Seite 57 und 58: Die Schriftsprache ist dieser Aufst
- Seite 59 und 60: Deshalb ist es ein Desiderat, im Ra
- Seite 61 und 62: analysieren zu können“ (Schnotz
- Seite 63 und 64: literarischen Texten als ein separa
- Seite 65 und 66: dient die propositionale Textreprä
- Seite 67 und 68: Prozesses der Lesekompetenz, also d
- Seite 69 und 70: Subsklalen des Lesens (Kompetenzber
- Seite 71 und 72: eitragen, könnte auch auf den oben
- Seite 73 und 74: Teilkompetenzen der aufgeführten S
- Seite 75 und 76: eher von Schulen mit einer leistung
- Seite 77 und 78: SchülerInnen bisher z.T. nach eige
- Seite 79 und 80:
wird zurückgegriffen (siehe 4.3).
- Seite 81 und 82:
In derselben Stichprobe werden die
- Seite 83 und 84:
diesen Kategorien, Hörende dagegen
- Seite 85 und 86:
4.3 Schriftsprachkompetenz hörgesc
- Seite 87 und 88:
Bilingualen Schulversuch wird zum e
- Seite 89 und 90:
Das Verständnis der Geschichte hä
- Seite 91 und 92:
4.4 Methodische Reflexion Evaluatio
- Seite 93 und 94:
Eine Ausnahme stellen die Arbeiten
- Seite 95 und 96:
Geschichtenschema folgt, kann das V
- Seite 97 und 98:
Bezeichnung n= Anteil dysauditiv un
- Seite 99 und 100:
des Interviews: 18% (n=9) verwenden
- Seite 101 und 102:
allein ein Lexem, und 33% (n=16), d
- Seite 103 und 104:
- Evaluation: Die „[e]valuative[n
- Seite 105 und 106:
„Schriftsteller“ identifizieren
- Seite 107 und 108:
Die bilingualen SchülerInnen verf
- Seite 109 und 110:
des Lesens (Gonzalez & Kennedy 2001
- Seite 111 und 112:
dass sie alle Kinder deutschsprachi
- Seite 113 und 114:
sind. Die mittel- bis hochgradig sc
- Seite 115 und 116:
SchülerInnen gibt, die von ihrem C
- Seite 117 und 118:
Nachdem sich bereits gezeigt hat, d
- Seite 119 und 120:
Die Aufgabe „Mäuse 10“ hat kei
- Seite 121 und 122:
schwerhörige Schülerin kann sie g
- Seite 123 und 124:
„*Weill er den Käse *bealten wol
- Seite 125 und 126:
Die Aufgabe „Mäuse 6“ besteht
- Seite 127 und 128:
SchülerInnen, die in den diskursst
- Seite 129 und 130:
„Maus will suchen auf Käse“ (S
- Seite 131 und 132:
„haben einen Kopfstand gemacht“
- Seite 133 und 134:
„problem“ (Christos, 10;11, geh
- Seite 135 und 136:
5.7.5 Zusammenfassung der qualitati
- Seite 137 und 138:
hörenden SchülerInnen von 27,7% (
- Seite 139 und 140:
sein, da die hörgeschädigten im G
- Seite 141 und 142:
„Die Wilden *Kele“ („Die Wild
- Seite 143 und 144:
„Soldaten“ (Václav, 10;8, mitt
- Seite 145 und 146:
Unbedeutend sind hingegen die Unter
- Seite 147 und 148:
6 VERA-Deutscharbeit 2005 Im Herbst
- Seite 149 und 150:
- Fähigkeitsniveau II: „Verknüp
- Seite 151 und 152:
Fragen zur Verfügung, um die hinre
- Seite 153 und 154:
- Ersatz von Höraufgaben (z.B. bei
- Seite 155 und 156:
einführende Zusammenfassung der Te
- Seite 157 und 158:
einem Förderschwerpunkt „Lernen
- Seite 159 und 160:
methodische Unwägbarkeit im Verhä
- Seite 161 und 162:
Gestaltung des Nachteilsausgleichs
- Seite 163 und 164:
Untersuchung (siehe 5.1 & 6.2.2) we
- Seite 165 und 166:
signifikant; insbesondere zwischen
- Seite 167 und 168:
schwerhörigen (*, d=0,57) und die
- Seite 169 und 170:
Bis auf die Klasse 6.3 ist keine Kl
- Seite 171 und 172:
Die Klasse 4.1 ist signifikant schw
- Seite 173 und 174:
Gruppen dargelegt, d.h. der gesamte
- Seite 175 und 176:
Die Verteilung in den beiden andere
- Seite 177 und 178:
6.5.1 Text 1: „Die Eisenbahn-Oma
- Seite 179 und 180:
VERA 1.2 Die Aufgabe 1.2 lautet:
- Seite 181 und 182:
„weil die junge Frau und *den jun
- Seite 183 und 184:
„Nein wir fahren nur bis Ulm', an
- Seite 185 und 186:
„Nein', *flüstern Uli zurück.'
- Seite 187 und 188:
„sie *sage, ob er muss schnell *d
- Seite 189 und 190:
Hier geht es um einen impliziten Bi
- Seite 191 und 192:
Es gibt eine Reihe von SchülerInne
- Seite 193 und 194:
„Mutter und Uli Sie fahren vielle
- Seite 195 und 196:
Nur wenigen SchülerInnen gelingt e
- Seite 197 und 198:
dass die alte Frau im ersten Text n
- Seite 199 und 200:
„Die *Kate hat 96,20 € gekostet
- Seite 201 und 202:
6.5.3 Text 3: „Kids-on-Tour“ De
- Seite 203 und 204:
„Ausweis“ (Hakan, 10;2, gehörl
- Seite 205 und 206:
„Wichtig mit Ausweis / dann *mein
- Seite 207 und 208:
„Manchmal die Opas oder Oma. / Ma
- Seite 209 und 210:
„Mitarbeiter der Bahnhofsmission
- Seite 211 und 212:
oder ‚Nein’ geantwortet und daz
- Seite 213 und 214:
Angst hat, „beklaut“ zu werden.
- Seite 215 und 216:
„Ich kann das ich bei Kids / on T
- Seite 217 und 218:
hinter ihnen ein Gedankengang, für
- Seite 219 und 220:
„Eltern und Großeltern können K
- Seite 221 und 222:
VERA 4.2 Auf die einfachste Frage f
- Seite 223 und 224:
„Leider hat nicht es geklappt, we
- Seite 225 und 226:
„Ja sie können *die Sparpreis be
- Seite 227 und 228:
„Sparpreis“ (Laura, 10;8, mitte
- Seite 229 und 230:
erfüllbar sind oder nicht.“ Es w
- Seite 231 und 232:
„*Das man *essen *bekomt.“ (Lut
- Seite 233 und 234:
Die übrigen richtigen Antworten be
- Seite 235 und 236:
Einige der Antworten sind offensich
- Seite 237 und 238:
In den richtigen Antworten wird typ
- Seite 239 und 240:
„Busausflug zum Falkenhof / Wrede
- Seite 241 und 242:
eiden Gruppen darüber hinaus eines
- Seite 243 und 244:
„Wann ist *Nachtruhre“ (Christo
- Seite 245 und 246:
„Schwimmen, Bowling, Reiten, / Ha
- Seite 247 und 248:
Die Aufgabe gehört zum Fähigkeits
- Seite 249 und 250:
Bei den folgenden SchülerInnen lä
- Seite 251 und 252:
„Ja“ (Mehmet, 11;8, gehörlos,
- Seite 253 und 254:
„Baden im Rheinsberger See, *Voll
- Seite 255 und 256:
ilingualen Schulversuchs ist sie so
- Seite 257 und 258:
Die Ergebnisse der Zweitevaluation
- Seite 259 und 260:
7 Vergleich der IGLU- und VERA-Erge
- Seite 261 und 262:
Selbst die beiden leichtgradig schw
- Seite 263 und 264:
von einem merklichen Einfluss ausge
- Seite 265 und 266:
8.1 Generalisierbarkeit der Ergebni
- Seite 267 und 268:
Hörgeschädigtenpädagogik zugelas
- Seite 269 und 270:
haben die beiden Schüler mit einem
- Seite 271 und 272:
Kompetenzentwicklung vor der Einsch
- Seite 273 und 274:
Im Folgenden werden die beiden Lese
- Seite 275 und 276:
Klassendurchschnitt liegt, lässt d
- Seite 277 und 278:
vorgestellt, weil er mit den Verfah
- Seite 279 und 280:
Die Zuordnung des Leseverständniss
- Seite 281 und 282:
Lexem „Decke“ fälschlicherweis
- Seite 283 und 284:
und die Gesamtstichprobe (Altersdur
- Seite 285 und 286:
Sprachaudiometrie im Freifeld unter
- Seite 287 und 288:
meisten SchülerInnen ihr Lexikon i
- Seite 289 und 290:
Plaza Pust (2007) untersucht danebe
- Seite 291 und 292:
9 Schlussbemerkung SchülerInnen mi
- Seite 293 und 294:
Einige internationale Studien zur L
- Seite 295 und 296:
verdeutlicht die Notwendigkeit, Nac
- Seite 297 und 298:
10 Ergänzende statistische Angaben
- Seite 299 und 300:
Avenarius, Hermann; Hartmut Ditton;
- Seite 301 und 302:
Dietrich (Hg.): Hörbehinderte Sch
- Seite 303 und 304:
Günther, Klaus-B. & Johannes Henni
- Seite 305 und 306:
Gebärden-, Laut- und Schriftsprach
- Seite 307 und 308:
Bildung und Forschung (BMBF) Refera
- Seite 309 und 310:
Leonhardt, Anette (2001): „Gemein
- Seite 311 und 312:
Paul, Peter V. (1998): Literacy and
- Seite 313 und 314:
Förderung von Lesekompetenz: Verti
- Seite 315 und 316:
Strong, Michael & Philip Prinz (200