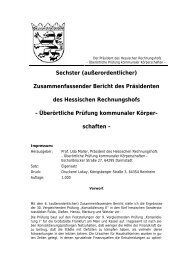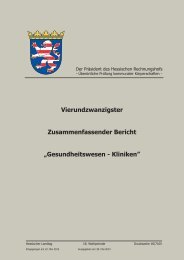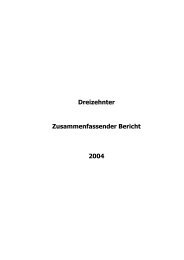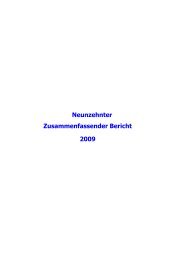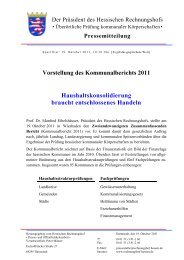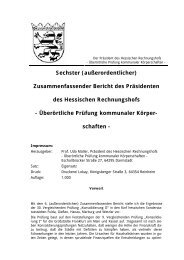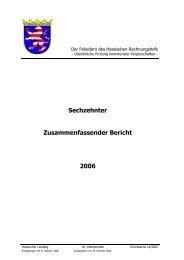Fünfter Zusammenfassender Bericht 1997 - Hessischer Rechnungshof
Fünfter Zusammenfassender Bericht 1997 - Hessischer Rechnungshof
Fünfter Zusammenfassender Bericht 1997 - Hessischer Rechnungshof
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Fünfundzwanzigste Vergleichende Prüfung „Grundstücke“<br />
Einheimischenmodelle<br />
selbst können am Grundstücksgeschäft Beteiligte nicht auf eine verbindliche<br />
Grundlage zurückgreifen, und zudem entzieht sich das Verwaltungshandeln in<br />
bezug auf seine Zielorientierung einer Überprüfung. Die Überörtliche Prüfung<br />
empfiehlt daher, die programmatischen Zielsetzungen und Vergaberichtlinien<br />
von der Gemeindevertretung nach § 51 Absatz 1 HGO beschließen zu lassen.<br />
Daß eine schriftliche Fixierung allein nicht automatisch zu mehr Klarheit und<br />
Sicherheit führen muß, zeigt indes die Realität niedergelegter Richtlinien zur<br />
Vergabe gemeindlicher Grundstücke.<br />
Die Bandbreite der vorgefundenen, von den gemeindlichen Organen beschlossenen<br />
Kriterien war beachtlich: So besaßen alle geprüften Kommunen das<br />
Vergabekriterium „Ortsansässigkeit“, wobei Aspekte wie etwa Ortsteilansässigkeit,<br />
soziale Bindungen oder Familienstand bei einzelnen Kommunen auch<br />
als Auswahlkriterien herangezogen wurden. Hinsichtlich der familiären Situation<br />
spielte bei neun geprüften Kommunen das Kriterium „Kinder“ eine wichtige<br />
Rolle. Für fünf Kommunen ist es bedeutsam, daß der potentielle Erwerber<br />
seiner beruflichen Tätigkeit in der jeweiligen Gemeinde nachgeht.<br />
Einzelne Kommunen verlangen auch die Baufertigstellung innerhalb einer bestimmten<br />
Frist oder knüpfen die Erwartung einer Schaffung von Arbeitsplätzen<br />
an die Vergaben. Festzuhalten bleibt, daß die Vergabekriterien der Gemeinden<br />
individuell und damit sehr unterschiedlich sind und daß es den Gemeinden in<br />
unterschiedlichem Maße gelingt, ihre Zielsetzungen in konkrete - meß- und<br />
überprüfbare - Kriterien umzusetzen. Zur Gewährleistung von Rechtssicherheit<br />
für alle am Grundstücksgeschäft Beteiligten und klare Handlungsgrundlage für<br />
die Verwaltung sollten die Kommunen zunächst ihre Ziele klären. Sodann sind<br />
sie eindeutig zu formulieren und schließlich in einem dritten Schritt in Kriterienkatalogen<br />
zusammenzustellen.<br />
Zwei Gruppen sind hier besonders interessant: Die Regelungen zur Deckung<br />
des örtlichen Bedarfs („Einheimischenmodelle“) und die Kriterien zur wirtschaftlichen<br />
Leistungsfähigkeit des Bewerbers:<br />
3.8 Einheimischenmodelle<br />
Die meisten der Kommunen verfügten in ihren Vergaberichtlinien über eine<br />
Einheimischenklausel, nach welcher ortsansässige Bewerber bevorzugt zu berücksichtigen<br />
waren. Die Definitionen der ortsansässigen Bewerber waren<br />
unterschiedlich und häufig nicht eindeutig. Sie fanden ihre Ausgestaltung in<br />
der Bandbreite vom aktuellen Hauptwohnsitz bis zum nicht näher bestimmten<br />
ehemaligen Einwohner. Vier Gemeinden gingen noch einen Schritt weiter und<br />
forderten für die Vergabe von Grundstücken in bestimmten Ortsteilen, daß der<br />
Bewerber aus demselben Ortsteil stammen müsse. Gleichwohl war auch in<br />
diesen Fällen die Ortsansässigkeit nicht zweifelsfrei bestimmt. Mit unklaren<br />
Begriffen schaffen die Gemeinden Rechtsunsicherheit.<br />
Fraglich ist die Rechtmäßigkeit von Einheimischenmodellen. Nach Auffassung<br />
der Überörtlichen Prüfung bestehen Bedenken gegen Einheimischenmodelle,<br />
sofern sie Auswärtige de facto vom Zuzug in die Gemeinde ausschließen. Dies<br />
trifft dann zu, wenn sich der Wirkungsbereich der Einheimischenmodelle auf<br />
das gesamte Gemeindegebiet oder auf sämtliche Bauplätze erstreckt.<br />
Anhand der zweiten, näher zu betrachtenden Gruppe, der Kriterien zur wirtschaftlichen<br />
Leistungsfähigkeit der Grundstücksbewerber, wird ein Grundproblem<br />
bei der Kriterienformulierung offenbar. Längst nicht alle in den Vergaberichtlinien<br />
enthaltenen Merkmale sind zweifelsfrei handhabbar. Formulierungen<br />
wie „sozial schwach“, „Art der Unterbringung zum Zeitpunkt der Vergabe“<br />
und „hat in absehbarer Zeit kein Wohn- oder Grundeigentum aus Erbschaft zu<br />
35<br />
Unklar definierte<br />
Kriterien schaffen<br />
Interpretationsspielräume<br />
Kriterien zur<br />
wirtschaftlichen<br />
Leistungsfähigkeit<br />
oft ungeeignet