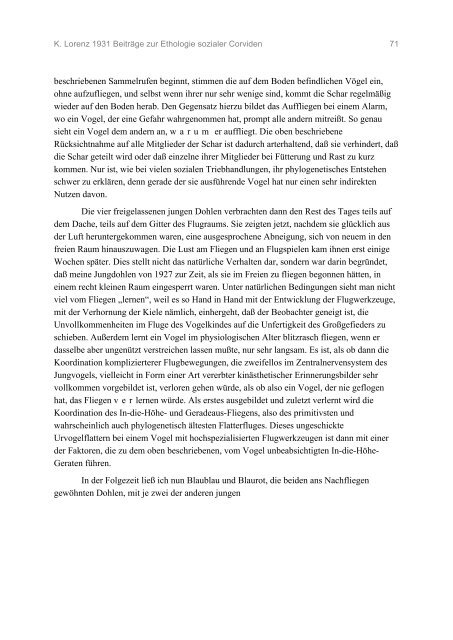Konrad Lorenz 1931 Beiträge zur Ethologie sozialer Corviden ...
Konrad Lorenz 1931 Beiträge zur Ethologie sozialer Corviden ...
Konrad Lorenz 1931 Beiträge zur Ethologie sozialer Corviden ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
K. <strong>Lorenz</strong> <strong>1931</strong> <strong>Beiträge</strong> <strong>zur</strong> <strong>Ethologie</strong> <strong>sozialer</strong> <strong>Corviden</strong> 71<br />
beschriebenen Sammelrufen beginnt, stimmen die auf dem Boden befindlichen Vögel ein,<br />
ohne aufzufliegen, und selbst wenn ihrer nur sehr wenige sind, kommt die Schar regelmäßig<br />
wieder auf den Boden herab. Den Gegensatz hierzu bildet das Auffliegen bei einem Alarm,<br />
wo ein Vogel, der eine Gefahr wahrgenommen hat, prompt alle andern mitreißt. So genau<br />
sieht ein Vogel dem andern an, w arum er auffliegt. Die oben beschriebene<br />
Rücksichtnahme auf alle Mitglieder der Schar ist dadurch arterhaltend, daß sie verhindert, daß<br />
die Schar geteilt wird oder daß einzelne ihrer Mitglieder bei Fütterung und Rast zu kurz<br />
kommen. Nur ist, wie bei vielen sozialen Triebhandlungen, ihr phylogenetisches Entstehen<br />
schwer zu erklären, denn gerade der sie ausführende Vogel hat nur einen sehr indirekten<br />
Nutzen davon.<br />
Die vier freigelassenen jungen Dohlen verbrachten dann den Rest des Tages teils auf<br />
dem Dache, teils auf dem Gitter des Flugraums. Sie zeigten jetzt, nachdem sie glücklich aus<br />
der Luft heruntergekommen waren, eine ausgesprochene Abneigung, sich von neuem in den<br />
freien Raum hinauszuwagen. Die Lust am Fliegen und an Flugspielen kam ihnen erst einige<br />
Wochen später. Dies stellt nicht das natürliche Verhalten dar, sondern war darin begründet,<br />
daß meine Jungdohlen von 1927 <strong>zur</strong> Zeit, als sie im Freien zu fliegen begonnen hätten, in<br />
einem recht kleinen Raum eingesperrt waren. Unter natürlichen Bedingungen sieht man nicht<br />
viel vom Fliegen „lernen“, weil es so Hand in Hand mit der Entwicklung der Flugwerkzeuge,<br />
mit der Verhornung der Kiele nämlich, einhergeht, daß der Beobachter geneigt ist, die<br />
Unvollkommenheiten im Fluge des Vogelkindes auf die Unfertigkeit des Großgefieders zu<br />
schieben. Außerdem lernt ein Vogel im physiologischen Alter blitzrasch fliegen, wenn er<br />
dasselbe aber ungenützt verstreichen lassen mußte, nur sehr langsam. Es ist, als ob dann die<br />
Koordination komplizierterer Flugbewegungen, die zweifellos im Zentralnervensystem des<br />
Jungvogels, vielleicht in Form einer Art vererbter kinästhetischer Erinnerungsbilder sehr<br />
vollkommen vorgebildet ist, verloren gehen würde, als ob also ein Vogel, der nie geflogen<br />
hat, das Fliegen v erlernen würde. Als erstes ausgebildet und zuletzt verlernt wird die<br />
Koordination des In-die-Höhe- und Geradeaus-Fliegens, also des primitivsten und<br />
wahrscheinlich auch phylogenetisch ältesten Flatterfluges. Dieses ungeschickte<br />
Urvogelflattern bei einem Vogel mit hochspezialisierten Flugwerkzeugen ist dann mit einer<br />
der Faktoren, die zu dem oben beschriebenen, vom Vogel unbeabsichtigten In-die-Höhe-<br />
Geraten führen.<br />
In der Folgezeit ließ ich nun Blaublau und Blaurot, die beiden ans Nachfliegen<br />
gewöhnten Dohlen, mit je zwei der anderen jungen