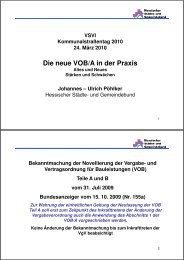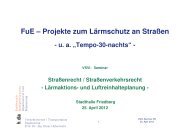SEMINAR TAGUNGSBAND Instandsetzung massiver ... - VSVI Hessen
SEMINAR TAGUNGSBAND Instandsetzung massiver ... - VSVI Hessen
SEMINAR TAGUNGSBAND Instandsetzung massiver ... - VSVI Hessen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Seminar der <strong>VSVI</strong> <strong>Hessen</strong> am 25. April 2007 in Friedberg/<strong>Hessen</strong><br />
Die Existenz von Rissen in Koppelfugen von Spannbetonbrücken ist eine auch ausgiebig in<br />
den öffentlichen Medien behandelte Tatsache. Unter Koppelfugen werden Arbeitsfugen<br />
verstanden, in denen ein oder mehrere – im Grenzfall alle – Spannglieder gekoppelt werden.<br />
Durch die Rissbildung geht der Querschnitt in den Zustand II über, so dass zusätzliche<br />
Biegebeanspruchungen im Querschnitt auf der Zugseite allein von der die Fuge kreuzenden<br />
Bewehrung aufgenommen werden müssen. Dadurch erfahren die Spanngliedkopplungen<br />
auch hohe Spannungsschwingbreiten infolge der wechselnden Verkehrslasten, gegenüber<br />
denen die Koppelanker äußerst empfindlich sind.<br />
Mit dem Einsatz von feldweise selbsttragenden Vorschubrüstungen, in Deutschland erstmals<br />
1959 bei der Kettiger Hangbrücke bei Andernach/Weißenthurm angewendet, wurden<br />
einzelne Felder der Brücke getrennt vorgespannt. In den Abschnittsfugen wurden zunächst<br />
häufig alle Spannglieder endverankert oder gekoppelt. Eine Mindestbewehrung war nach<br />
DIN 4227/1953 nicht gefordert.<br />
Nach den Spannverfahren-Zulassungen wurde anfangs in den Koppelfugen volle Vorspannung<br />
gefordert. In den Verlängerungen Mitte der 70er Jahre wurde stattdessen der<br />
Nachweis der Dauerschwingfestigkeit unter Gebrauchslast gefordert. Bis zu diesem<br />
Zeitpunkt wurde jedoch bei keinem der Nachweise ein Lastfall Temperaturunterschied<br />
berücksichtigt. Erst - Anlass war unter anderem der Schadensfall an der Hochstraße<br />
Prinzenallee, bei dem in mehreren Koppelfugen Spannstahlbrüche aufgetreten waren – mit<br />
den für alle Spannverfahren ausgesprochenen Änderungsbescheiden vom Februar 1977<br />
musste der Dauerschwingnachweis unter Ansatz eines Lastfalls Temperaturunterschied ∆T<br />
= 10 K nachgewiesen werden. Zusätzlich wurde eine erhöhte Mindestlängsbewehrung<br />
vorgeschrieben.<br />
Mit DIN 4227 von 1979 wurde noch ein zusätzlicher Temperaturlastfall ∆T = 5 K eingeführt.<br />
2 Biegetragfähigkeit<br />
Überwiegend handelt es sich bei Spannbetonbrücken um schwach bewehrte Querschnitte,<br />
bei denen die Zugbewehrung (Betonstahl und Spannstahl) die Tragfähigkeit bestimmen.<br />
Ausnahmen können z.B. bei Plattenbalkenquerschnitten im Stützbereich auftreten, bei denen<br />
dann als erstes die Druckzone versagt.<br />
Nach Aufreißen des Querschnittes – eine Betonzugfestigkeit wird nicht unterstellt – steigt die<br />
Stahlzugspannung zunächst bei zunehmendem äußeren Moment unterproportional an, da<br />
sich der innere Hebelarm zunächst durch weiteres Aufreißen des Querschnitts noch<br />
vergrößern kann. Erst wenn sich praktisch ein Zwei-Punkt-Querschnitt gebildet hat, ergibt<br />
sich eine lineare Beziehung zwischen Spannungs- und Momentenzuwachs (ausgeprägter<br />
Zustand II), bis die Fließgrenze der untersten Spanngliedlage erreicht ist (Bild 1).<br />
42