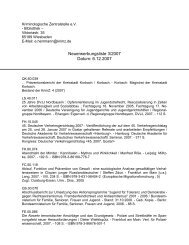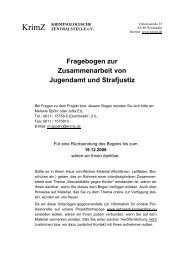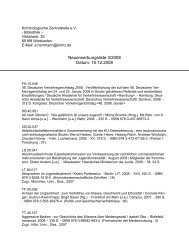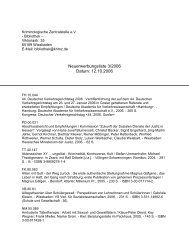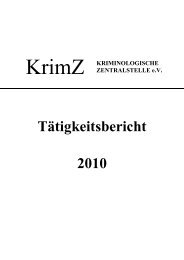- Seite 1 und 2: KrimZ KRIMINOLOGISCHE ZENTRALSTELLE
- Seite 3 und 4: Kriminologie und Praxis (KUP) Schri
- Seite 5 und 6: Bibliografische Information Der Deu
- Seite 7 und 8: 6 zur Projektentwicklung bei. Begle
- Seite 9 und 10: 8 B.2.4 Aktenanalyse von alkoholabh
- Seite 11 und 12: 10 C.4 Praktischer Anwendungsbereic
- Seite 14 und 15: A. Allgemeiner Teil A.1 Einleitung
- Seite 18 und 19: A. Allgemeiner Teil ben, die er nac
- Seite 20 und 21: A. Allgemeiner Teil und andererseit
- Seite 22 und 23: A. Allgemeiner Teil • Starker Wun
- Seite 24 und 25: A. Allgemeiner Teil bzw. Missbrauch
- Seite 26 und 27: A.2.4.1 Kulturelle Traditionen A. A
- Seite 28 und 29: A. Allgemeiner Teil einen stationä
- Seite 30 und 31: A. Allgemeiner Teil Aber auch unter
- Seite 32 und 33: A. Allgemeiner Teil Abb. 1: Entwick
- Seite 34 und 35: A. Allgemeiner Teil A.2.5 Theorien
- Seite 36 und 37: A. Allgemeiner Teil Kerner gliedert
- Seite 38 und 39: B. Projektbeschreibung B. Projektbe
- Seite 40 und 41: B. Projektbeschreibung nisse nicht
- Seite 42 und 43: B. Projektbeschreibung tigen Voraus
- Seite 44 und 45: B. Projektbeschreibung Darüber hin
- Seite 46 und 47: B. Projektbeschreibung B.2.2.1 Merk
- Seite 48 und 49: B. Projektbeschreibung chen nicht i
- Seite 50 und 51: B. Projektbeschreibung kung seitens
- Seite 52 und 53: B. Projektbeschreibung Überhang de
- Seite 54 und 55: g) Vorstrafen B. Projektbeschreibun
- Seite 56 und 57: B. Projektbeschreibung wenigen Fäl
- Seite 58 und 59: B. Projektbeschreibung • Merkmale
- Seite 60 und 61: B. Projektbeschreibung B.2.5.1 Merk
- Seite 62 und 63: B. Projektbeschreibung Tabelle 6: D
- Seite 64 und 65: C. Ergebnisse des Projektes C.1 Pr
- Seite 66 und 67:
C. Ergebnisse des Projekts 65 gen T
- Seite 68 und 69:
C. Ergebnisse des Projekts 67 Als Z
- Seite 70 und 71:
C. Ergebnisse des Projekts 69 öffe
- Seite 72 und 73:
C. Ergebnisse des Projekts 71 Abb.
- Seite 74 und 75:
C. Ergebnisse des Projekts 73 Von d
- Seite 76 und 77:
C. Ergebnisse des Projekts 75 alkoh
- Seite 78 und 79:
C. Ergebnisse des Projekts 77 schei
- Seite 80 und 81:
C. Ergebnisse des Projekts 79 Abb.
- Seite 82 und 83:
C. Ergebnisse des Projekts 81 Abb.
- Seite 84 und 85:
C. Ergebnisse des Projekts 83 Abb.
- Seite 86 und 87:
C. Ergebnisse des Projekts 85 Tabel
- Seite 88 und 89:
C. Ergebnisse des Projekts 87 1. Ha
- Seite 90 und 91:
C. Ergebnisse des Projekts 89 Abb.
- Seite 92 und 93:
C. Ergebnisse des Projekts 91 ger b
- Seite 94 und 95:
C. Ergebnisse des Projekts 93 tung
- Seite 96 und 97:
C. Ergebnisse des Projekts 95 nen f
- Seite 98 und 99:
C. Ergebnisse des Projekts 97 strec
- Seite 100 und 101:
C. Ergebnisse des Projekts 99 Das P
- Seite 102 und 103:
C.2.3.2 Behandlung C. Ergebnisse de
- Seite 104 und 105:
C. Ergebnisse des Projekts 103 Eine
- Seite 106 und 107:
C. Ergebnisse des Projekts 105 werd
- Seite 108 und 109:
C. Ergebnisse des Projekts 107 Auss
- Seite 110 und 111:
C. Ergebnisse des Projekts 109 C.3
- Seite 112 und 113:
C. Ergebnisse des Projekts 111 Beur
- Seite 114 und 115:
C. Ergebnisse des Projekts 113 Dies
- Seite 116 und 117:
C. Ergebnisse des Projekts 115 Abb.
- Seite 118 und 119:
C. Ergebnisse des Projekts 117 Es z
- Seite 120 und 121:
C. Ergebnisse des Projekts 119 Sowo
- Seite 122 und 123:
C. Ergebnisse des Projekts 121 auch
- Seite 124 und 125:
C. Ergebnisse des Projekts 123 komm
- Seite 126 und 127:
C. Ergebnisse des Projekts 125 rung
- Seite 128 und 129:
C. Ergebnisse des Projekts 127 wege
- Seite 130 und 131:
C. Ergebnisse des Projekts 129 Abb.
- Seite 132 und 133:
C. Ergebnisse des Projekts 131 Tats
- Seite 134 und 135:
C. Ergebnisse des Projekts 133 Ob s
- Seite 136 und 137:
C. Ergebnisse des Projekts 135 Bei
- Seite 138 und 139:
C. Ergebnisse des Projekts 137 Gese
- Seite 140 und 141:
C. Ergebnisse des Projekts 139 aus
- Seite 142 und 143:
C. Ergebnisse des Projekts 141 gung
- Seite 144 und 145:
C. Ergebnisse des Projekts 143 Tab.
- Seite 146 und 147:
C. Ergebnisse des Projekts 145 3. f
- Seite 148 und 149:
C. Ergebnisse des Projekts 147 Schl
- Seite 150 und 151:
C. Ergebnisse des Projekts 149 Abb.
- Seite 152 und 153:
C. Ergebnisse des Projekts 151 heit
- Seite 154 und 155:
C. Ergebnisse des Projekts 153 •
- Seite 156 und 157:
C. Ergebnisse des Projekts 155 Abb.
- Seite 158 und 159:
C. Ergebnisse des Projekts 157 Rich
- Seite 160 und 161:
C. Ergebnisse des Projekts 159 Vert
- Seite 162 und 163:
C. Ergebnisse des Projekts 161 C.5
- Seite 164 und 165:
C. Ergebnisse des Projekts 163 auf.
- Seite 166 und 167:
C. Ergebnisse des Projekts 165 Entw
- Seite 168 und 169:
C. Ergebnisse des Projekts 167 beli
- Seite 170 und 171:
C. Ergebnisse des Projekts 169 der
- Seite 172 und 173:
C. Ergebnisse des Projekts 171 Abb.
- Seite 174 und 175:
C.5.3 Therapieeinrichtungen C. Erge
- Seite 176 und 177:
C. Ergebnisse des Projekts 175 Abb.
- Seite 178 und 179:
C. Ergebnisse des Projekts 177 ten.
- Seite 180 und 181:
C. Ergebnisse des Projekts 179 grun
- Seite 182 und 183:
C.5.4.3 Einsparpotential C. Ergebni
- Seite 184 und 185:
C. Ergebnisse des Projekts 183 Abb.
- Seite 186 und 187:
C. Ergebnisse des Projekts 185 Pers
- Seite 188 und 189:
C. Ergebnisse des Projekts 187 dass
- Seite 190 und 191:
C. Ergebnisse des Projekts 189 C.6.
- Seite 192 und 193:
C. Ergebnisse des Projekts 191 Ein
- Seite 194 und 195:
C.7 Zusammenfassung und Ausblick C.
- Seite 196 und 197:
C. Ergebnisse des Projekts 195 unte
- Seite 198 und 199:
C. Ergebnisse des Projekts 197 Bei
- Seite 200 und 201:
C. Ergebnisse des Projekts 199 Die
- Seite 202 und 203:
C. Ergebnisse des Projekts 201 Stra
- Seite 204:
C. Ergebnisse des Projekts 203 gige
- Seite 207 und 208:
206 D.1 Literaturverzeichnis Callie
- Seite 209 und 210:
208 D.1 Literaturverzeichnis Feest,
- Seite 211 und 212:
210 D.1 Literaturverzeichnis Körke
- Seite 213 und 214:
212 D.1 Literaturverzeichnis Preusk
- Seite 215 und 216:
214 D.1 Literaturverzeichnis Süß,
- Seite 217 und 218:
216 D.2 Tabellen Item Faktor 1 Fakt
- Seite 219 und 220:
218 D.2 Tabellen Tab. B : Regressio
- Seite 221 und 222:
220 D.2 Tabellen Tab. D: Tabelle de
- Seite 224 und 225:
D.3 Materialien D. Anhang D.3.1 Fra
- Seite 226 und 227:
D. Anhang 2. Welche Entlastungseffe
- Seite 228 und 229:
D. Anhang 227 D.3.2 Alkoholproblema
- Seite 230 und 231:
D. Anhang 229 B.1 Einschätzung der
- Seite 232 und 233:
12. → Ergibt sich das aus D. Anha
- Seite 234 und 235:
D. Anhang Zur Information!!! 233 in
- Seite 236 und 237:
D.3.3 Erhebungsbogen zur Alkoholpro
- Seite 238 und 239:
A. Angaben der Vollzugsleitung D. A
- Seite 240 und 241:
D. Anhang 239 B.1 Einschätzung der
- Seite 242 und 243:
D. Anhang 241 Zur Information!!! in
- Seite 244 und 245:
D.3 Anhang 243 D.3.4 Erhebungsbogen
- Seite 246 und 247:
D.3.5 Erhebungsbogen zur Aktenanaly
- Seite 248 und 249:
D.3 Materialien 1070 Anzahl der Ver
- Seite 250 und 251:
1106 Weitere Hinweise? D. Anhang [0
- Seite 252 und 253:
D. Anhang 4. Hat sich der Alkoholko
- Seite 254 und 255:
Falls 1600 = 1 oder 2: a) freiwilli
- Seite 256 und 257:
D.3 Materialien 2011 Angewendete Vo
- Seite 258 und 259:
D. Anhang 2050 Schwerstes nicht-sex
- Seite 260 und 261:
2092 Falls 2091 = 1/2/3 oder 4: Wes
- Seite 262 und 263:
C. Die Hauptverhandlung I. Alkohol
- Seite 264 und 265:
D. Anhang 3037 § 63 StGB [___] ...
- Seite 266 und 267:
D.3 Materialien 3092 Falls der Tät
- Seite 268 und 269:
D. Anhang 4120 Durchführung einer
- Seite 270 und 271:
D. Anhang _________________________
- Seite 272 und 273:
D. Anhang _________________________
- Seite 274 und 275:
D.3.6 Erhebungsbogen zur Befragung
- Seite 276 und 277:
D. Anhang 275 a) Erwachsene und Her
- Seite 278 und 279:
D. Anhang 277 16. Die Alkoholabhän
- Seite 280 und 281:
IV. Bedarfsschätzung D. Anhang 279
- Seite 282:
D. Anhang 281 Abschließend bitten
- Seite 285 und 286:
284 D.3 Materialien 2. Einstiegsfra
- Seite 287 und 288:
286 D.3 Materialien 8.2 Wie viele v
- Seite 289 und 290:
288 D.3 Materialien 17. Einer geset
- Seite 292 und 293:
D.3.8 Erhebungsbogen zur Befragung
- Seite 294 und 295:
D. Anhang 293 2. Nun einige wenige
- Seite 296 und 297:
Befragung von Angehörigen station