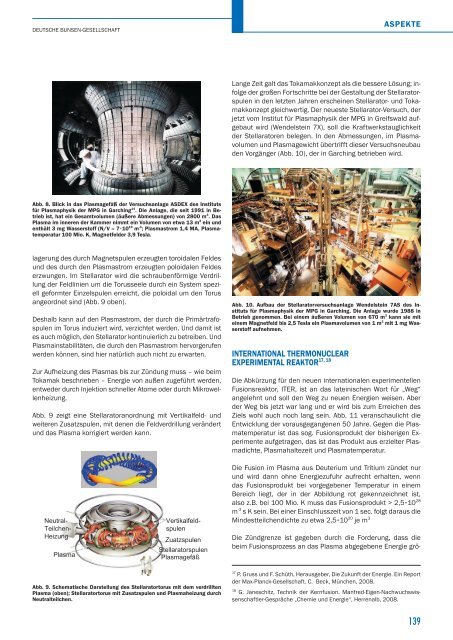BuMa_2010_04 - Deutsche Bunsengesellschaft für Physikalische ...
BuMa_2010_04 - Deutsche Bunsengesellschaft für Physikalische ...
BuMa_2010_04 - Deutsche Bunsengesellschaft für Physikalische ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
DEUTSCHE BUNSEN-GESELLSCHAFT<br />
Abb. 8. Blick in das Plasmagefäß der Versuchsanlage ASDEX des Instituts<br />
<strong>für</strong> Plasmaphysik der MPG in Garching 14 . Die Anlage, die seit 1991 in Betrieb<br />
ist, hat ein Gesamtvolumen (äußere Abmessungen) von 2800 m 3 . Das<br />
Plasma im inneren der Kammer nimmt ein Volumen von etwa 13 m 3 ein und<br />
enthält 3 mg Wasserstoff (N/V ≈ 7 10 19 m -3 ; Plasmastrom 1,4 MA, Plasmatemperatur<br />
100 Mio. K, Magnetfelder 3,9 Tesla.<br />
lagerung des durch Magnetspulen erzeugten toroidalen Feldes<br />
und des durch den Plasmastrom erzeugten poloidalen Feldes<br />
erzwungen. Im Stellarator wird die schraubenförmige Verdrillung<br />
der Feldlinien um die Torusseele durch ein System speziell<br />
geformter Einzelspulen erreicht, die poloidal um den Torus<br />
angeordnet sind (Abb. 9 oben).<br />
Deshalb kann auf den Plasmastrom, der durch die Primärtrafospulen<br />
im Torus induziert wird, verzichtet werden. Und damit ist<br />
es auch möglich, den Stellarator kontinuierlich zu betreiben. Und<br />
Plasmainstabilitäten, die durch den Plasmastrom hervorgerufen<br />
werden können, sind hier natürlich auch nicht zu erwarten.<br />
Zur Aufheizung des Plasmas bis zur Zündung muss – wie beim<br />
Tokamak beschrieben – Energie von außen zugeführt werden,<br />
entweder durch Injektion schneller Atome oder durch Mikrowellenheizung.<br />
Abb. 9 zeigt eine Stellaratoranordnung mit Vertikalfeld- und<br />
weiteren Zusatzspulen, mit denen die Feldverdrillung verändert<br />
und das Plasma korrigiert werden kann.<br />
Neutral-<br />
Teilchen-<br />
Heizung<br />
Plasma<br />
Vertikalfeldspulen<br />
Zuatzspulen<br />
Stellaratorspulen<br />
Plasmagefäß<br />
Abb. 9. Schematische Darstellung des Stellaratortorus mit dem verdrillten<br />
Plasma (oben); Stellaratortorus mit Zusatzspulen und Plasmaheizung durch<br />
Neutralteilchen.<br />
ASPEKTE<br />
Lange Zeit galt das Tokamakkonzept als die bessere Lösung; infolge<br />
der großen Fortschritte bei der Gestaltung der Stellaratorspulen<br />
in den letzten Jahren erscheinen Stellarator- und Tokamakkonzept<br />
gleichwertig. Der neueste Stellarator-Versuch, der<br />
jetzt vom Institut <strong>für</strong> Plasmaphysik der MPG in Greifswald aufgebaut<br />
wird (Wendelstein 7X), soll die Kraftwerkstauglichkeit<br />
der Stellaratoren belegen. In den Abmessungen, im Plasmavolumen<br />
und Plasmagewicht übertrifft dieser Versuchsneubau<br />
den Vorgänger (Abb. 10), der in Garching betrieben wird.<br />
Abb. 10. Aufbau der Stellaratorversuchsanlage Wendelstein 7AS des Instituts<br />
<strong>für</strong> Plasmaphysik der MPG in Garching. Die Anlage wurde 1988 in<br />
Betrieb genommen. Bei einem äußeren Volumen von 670 m 3 kann sie mit<br />
einem Magnetfeld bis 2,5 Tesla ein Plasmavolumen von 1 m 3 mit 1 mg Wasserstoff<br />
aufnehmen.<br />
INTERNATIONAL THERMONUCLEAR<br />
17, 18<br />
EXPERIMENTAL REAKTOR<br />
Die Abkürzung <strong>für</strong> den neuen internationalen experimentellen<br />
Fusionsreaktor, ITER, ist an das lateinischen Wort <strong>für</strong> „Weg“<br />
angelehnt und soll den Weg zu neuen Energien weisen. Aber<br />
der Weg bis jetzt war lang und er wird bis zum Erreichen des<br />
Ziels wohl auch noch lang sein. Abb. 11 veranschaulicht die<br />
Entwicklung der vorausgegangenen 50 Jahre. Gegen die Plasmatemperatur<br />
ist das sog. Fusionsprodukt der bisherigen Experimente<br />
aufgetragen, das ist das Produkt aus erzielter Plasmadichte,<br />
Plasmahaltezeit und Plasmatemperatur.<br />
Die Fusion im Plasma aus Deuterium und Tritium zündet nur<br />
und wird dann ohne Energiezufuhr aufrecht erhalten, wenn<br />
das Fusionsprodukt bei vorgegebener Temperatur in einem<br />
Bereich liegt, der in der Abbildung rot gekennzeichnet ist,<br />
also z.B. bei 100 Mio. K muss das Fusionsprodukt > 2,5•10 28<br />
m -3 s K sein. Bei einer Einschlusszeit von 1 sec. folgt daraus die<br />
Mindestteilchendichte zu etwa 2,5•10 20 je m 3<br />
Die Zündgrenze ist gegeben durch die Forderung, dass die<br />
beim Fusionsprozess an das Plasma abgegebene Energie grö-<br />
17 P. Gruss und F. Schüth, Herausgeber, Die Zukunft der Energie. Ein Report<br />
der Max-Planck-Gesellschaft. C. Beck, München, 2008.<br />
18<br />
G. Janeschitz, Technik der Kernfusion. Manfred-Eigen-Nachwuchswissenschaftler-Gespräche<br />
„Chemie und Energie“, Herrenalb, 2008.<br />
139