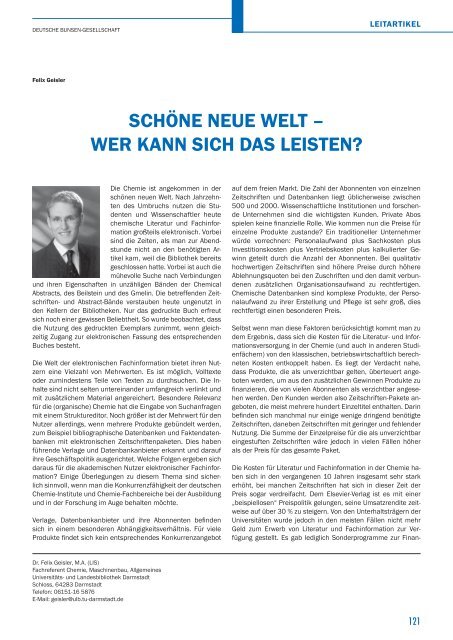BuMa_2010_04 - Deutsche Bunsengesellschaft für Physikalische ...
BuMa_2010_04 - Deutsche Bunsengesellschaft für Physikalische ...
BuMa_2010_04 - Deutsche Bunsengesellschaft für Physikalische ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
DEUTSCHE BUNSEN-GESELLSCHAFT<br />
Felix Geisler<br />
SCHÖNE NEUE WELT –<br />
WER KANN SICH DAS LEISTEN?<br />
Die Chemie ist angekommen in der<br />
schönen neuen Welt. Nach Jahrzehnten<br />
des Umbruchs nutzen die Studenten<br />
und Wissenschaftler heute<br />
chemische Literatur und Fachinformation<br />
großteils elektronisch. Vorbei<br />
sind die Zeiten, als man zur Abendstunde<br />
nicht an den benötigten Artikel<br />
kam, weil die Bibliothek bereits<br />
geschlossen hatte. Vorbei ist auch die<br />
mühevolle Suche nach Verbindungen<br />
und ihren Eigenschaften in unzähligen Bänden der Chemical<br />
Abstracts, des Beilstein und des Gmelin. Die betreffenden Zeitschriften-<br />
und Abstract-Bände verstauben heute ungenutzt in<br />
den Kellern der Bibliotheken. Nur das gedruckte Buch erfreut<br />
sich noch einer gewissen Beliebtheit. So wurde beobachtet, dass<br />
die Nutzung des gedruckten Exemplars zunimmt, wenn gleichzeitig<br />
Zugang zur elektronischen Fassung des entsprechenden<br />
Buches besteht.<br />
Die Welt der elektronischen Fachinformation bietet ihren Nutzern<br />
eine Vielzahl von Mehrwerten. Es ist möglich, Volltexte<br />
oder zumindestens Teile von Texten zu durchsuchen. Die Inhalte<br />
sind nicht selten untereinander umfangreich verlinkt und<br />
mit zusätzlichem Material angereichert. Besondere Relevanz<br />
<strong>für</strong> die (organische) Chemie hat die Eingabe von Suchanfragen<br />
mit einem Struktureditor. Noch größer ist der Mehrwert <strong>für</strong> den<br />
Nutzer allerdings, wenn mehrere Produkte gebündelt werden,<br />
zum Beispiel bibliographische Datenbanken und Faktendatenbanken<br />
mit elektronischen Zeitschriftenpaketen. Dies haben<br />
führende Verlage und Datenbankanbieter erkannt und darauf<br />
ihre Geschäftspolitik ausgerichtet. Welche Folgen ergeben sich<br />
daraus <strong>für</strong> die akademischen Nutzer elektronischer Fachinformation?<br />
Einige Überlegungen zu diesem Thema sind sicherlich<br />
sinnvoll, wenn man die Konkurrenzfähigkeit der deutschen<br />
Chemie-Institute und Chemie-Fachbereiche bei der Ausbildung<br />
und in der Forschung im Auge behalten möchte.<br />
Verlage, Datenbankanbieter und ihre Abonnenten befi nden<br />
sich in einem besonderen Abhängigkeitsverhältnis. Für viele<br />
Produkte fi ndet sich kein entsprechendes Konkurrenzangebot<br />
Dr. Felix Geisler, M.A. (LIS)<br />
Fachreferent Chemie, Maschinenbau, Allgemeines<br />
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt<br />
Schloss, 64283 Darmstadt<br />
Telefon: 06151-16 5876<br />
E-Mail: geisler@ulb.tu-darmstadt.de<br />
LEITARTIKEL<br />
auf dem freien Markt. Die Zahl der Abonnenten von einzelnen<br />
Zeitschriften und Datenbanken liegt üblicherweise zwischen<br />
500 und 2000. Wissenschaftliche Institutionen und forschende<br />
Unternehmen sind die wichtigsten Kunden. Private Abos<br />
spielen keine fi nanzielle Rolle. Wie kommen nun die Preise <strong>für</strong><br />
einzelne Produkte zustande? Ein traditioneller Unternehmer<br />
würde vorrechnen: Personalaufwand plus Sachkosten plus<br />
Investitionskosten plus Vertriebskosten plus kalkulierter Gewinn<br />
geteilt durch die Anzahl der Abonnenten. Bei qualitativ<br />
hochwertigen Zeitschriften sind höhere Preise durch höhere<br />
Ablehnungsquoten bei den Zuschriften und den damit verbundenen<br />
zusätzlichen Organisationsaufwand zu rechtfertigen.<br />
Chemische Datenbanken sind komplexe Produkte, der Personalaufwand<br />
zu ihrer Erstellung und Pfl ege ist sehr groß, dies<br />
rechtfertigt einen besonderen Preis.<br />
Selbst wenn man diese Faktoren berücksichtigt kommt man zu<br />
dem Ergebnis, dass sich die Kosten <strong>für</strong> die Literatur- und Informationsversorgung<br />
in der Chemie (und auch in anderen Studienfächern)<br />
von den klassischen, betriebswirtschaftlich berechneten<br />
Kosten entkoppelt haben. Es liegt der Verdacht nahe,<br />
dass Produkte, die als unverzichtbar gelten, überteuert angeboten<br />
werden, um aus den zusätzlichen Gewinnen Produkte zu<br />
fi nanzieren, die von vielen Abonnenten als verzichtbar angesehen<br />
werden. Den Kunden werden also Zeitschriften-Pakete angeboten,<br />
die meist mehrere hundert Einzeltitel enthalten. Darin<br />
befi nden sich manchmal nur einige wenige dringend benötigte<br />
Zeitschriften, daneben Zeitschriften mit geringer und fehlender<br />
Nutzung. Die Summe der Einzelpreise <strong>für</strong> die als unverzichtbar<br />
eingestuften Zeitschriften wäre jedoch in vielen Fällen höher<br />
als der Preis <strong>für</strong> das gesamte Paket.<br />
Die Kosten <strong>für</strong> Literatur und Fachinformation in der Chemie haben<br />
sich in den vergangenen 10 Jahren insgesamt sehr stark<br />
erhöht, bei manchen Zeitschriften hat sich in dieser Zeit der<br />
Preis sogar verdreifacht. Dem Elsevier-Verlag ist es mit einer<br />
„beispiellosen“ Preispolitik gelungen, seine Umsatzrendite zeitweise<br />
auf über 30 % zu steigern. Von den Unterhaltsträgern der<br />
Universitäten wurde jedoch in den meisten Fällen nicht mehr<br />
Geld zum Erwerb von Literatur und Fachinformation zur Verfügung<br />
gestellt. Es gab lediglich Sonderprogramme zur Finan-<br />
121