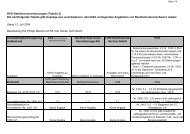Januar - Anwaltsblatt
Januar - Anwaltsblatt
Januar - Anwaltsblatt
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
MN Aufsätze<br />
tung zielende Modelle waren, die Union und SPD in den<br />
Koalitionsverhandlungen bewogen haben, zunächst einmal<br />
die politische Notbremse zu ziehen.<br />
2. Schwerwiegende rechtspolitische Bedenken<br />
Der standespolitische und fiskalische Charme und damit<br />
die rechtspolitische Sprengkraft dieses Ansatzes liegen<br />
nämlich auf der Hand: Nimmt man das Postulat des Bologna-Konzepts<br />
ernst, dass nur ein begrenzter Anteil der erfolgreichen<br />
Absolventen eines Bachelor-Studiums sofort<br />
zum Master-Studium zugelassen wird, dann kann auf diesem<br />
Weg ein recht enger Flaschenhals installiert werden,<br />
der den so lästigen Massenansturm auf die reglementierten<br />
Berufe bereits sehr früh im Vorfeld abfängt. Ob die „Masterquote“<br />
auf 20 % oder 30 % festgelegt würde, wäre fast nebensächlich.<br />
Die drängendsten Probleme wären gebannt –<br />
jedenfalls kurzfristig. Schon mittelfristig müsste man freilich<br />
mit noch größeren Problemen rechnen. Es erscheint<br />
durchaus zweifelhaft, ob es politisch tatsächlich durchsetzbar<br />
wäre, das frühzeitig aus der juristischen Ausbildung gedrängte<br />
Bachelor-Proletariat endgültig großflächig von der<br />
Rechtsberatung fernzuhalten. Eine Öffnung könnte allerdings<br />
dann wirklich eine Gefahr für die Qualität der Rechtspflege<br />
bedeuten. Andere Berufsperspektiven sind derzeit<br />
nicht ersichtlich. Eine für die Praxis brauchbare Spezialisierung,<br />
wie sie etwa die sehr erfolgreichen Rechtspflegerschulen<br />
bieten, lässt sich in der Universität innerhalb der<br />
normalen Studiengänge in drei Jahren nicht erreichen, weil<br />
hier ja zunächst einmal eine Grundlegung in der Methodenlehre<br />
und in den Pflichtfächern erfolgen muss, die für sich<br />
genommen im Regelfall eben noch nicht berufsqualifizierend<br />
wäre.<br />
3. Unvereinbarkeit mit dem Bologna-Konzept<br />
Damit erweist sich dieses Modell auch aus Bologna-<br />
Sicht als wenig tauglich: Der Bachelor, der eine Berufstauglichkeit<br />
vermitteln soll, hätte die Qualität einer besseren<br />
Zwischenprüfung, mit einer vorgegebenen, letztlich sehr hohen<br />
Misserfolgsquote. Eine fachübergreifende Erweiterung<br />
des Studiums in den Masterstudiengängen wäre auch<br />
schwer denkbar, hätte der Master doch zwangsläufig zunächst<br />
einmal die Aufgabe, auf die Zugangsprüfungen zu<br />
den einzelnen Berufssparten vorzubereiten.<br />
IV. Ein gangbarer Weg: 4:1, Staatsexamen nach<br />
dem Bachelor<br />
1. Grundstrukturen<br />
Inzwischen werden aber auch bereits sehr gründlich<br />
4:1-Modelle unter Beibehaltung des Staatsexamens als Eingangsprüfung<br />
für die reglementierten juristischen Berufe<br />
vorgeschlagen. 32 Dass solche Modelle mit dem Bologna-<br />
Konzept in Einklang zu bringen sind, wurde bereits dargelegt.<br />
Ein gangbarer Weg könnte damit wie folgt aussehen<br />
(eine schematische Darstellung findet sich auf der folgenden<br />
Seite):<br />
Den Grundstock der typischen Juristenausbildung würde<br />
ein 4-jähriges, universitäres Bachelor-Studium bilden, das<br />
Zugangsvoraussetzung für alle weiteren Qualifikationsstufen<br />
wäre. Nach dem Bachelor würde sich die Ausbildung<br />
gabeln: Wer einen reglementierten juristischen Beruf einschlagen<br />
möchte, müsste nach dem Bachelor zunächst eine<br />
staatliche Eingangsprüfung bestehen. Mit überdurchschnitt-<br />
8 AnwBl 1 / 2006<br />
lich erfolgreichem Bachelor könnte aber auch entsprechend<br />
einer bestimmten Quote ein einjähriges Master-Studium angeschlossen<br />
werden. Die Masterstudiengänge würden sich<br />
in anwendungsorientierte und forschungsorientierte Studiengänge<br />
gliedern, entsprechend der Forderung der Kultusministerkonferenz<br />
(KMK) vom 12.6.2003. 33 Die weitere<br />
Ausbildung für die reglementierten Berufe könnte so bleiben<br />
wie sie ist. Die Absolventen des Zweiten Staatsexamens<br />
wären klassische Volljuristen im Sinne eines Einheitsjuristen,<br />
hätten jedoch zusätzlich den Titel Bachelor und könnten<br />
nach dem Zweiten Staatsexamen wiederum noch eine Promotion<br />
oder ein Master-Studium anschließen. Größere Lösungen<br />
wie eine Abschaffung des Zweiten Staatsexamens,<br />
eine Verkürzung der Vorbereitungszeit etc. wären denkbar,<br />
könnten aber isoliert diskutiert oder auch zunächst einmal<br />
auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden 34 .<br />
Das somit 4-jährige universitäre Bachelor-Studium<br />
könnte einen mit dem Status quo vergleichbaren Ausbildungsstand<br />
gewährleisten; das System der Credit-Points<br />
würde Leistungen bereits während des Studiums honorieren,<br />
um die Studierenden zu gleichmäßiger Arbeit anzuspornen.<br />
Die Juristischen Fakultäten die – wie etwa die Kölner<br />
Fakultät – ohnehin bereits für jede Veranstaltung einen Abschlusstest<br />
vorsehen, hätten nur ganz wenig Umstellungsaufwand.<br />
Allerdings müssten für die letzte Phase des Studiums<br />
Module zur Wiederholung und Vertiefung des Stoffes<br />
eingeführt werden, für deren Bewältigung ebenfalls Credits<br />
zu vergeben wären. Ein entsprechender Umbau bereits –<br />
etwa in Köln – vorhandener flächendeckender Universitätsrepetitorien<br />
wäre freilich unschwer zu leisten. Diejenigen<br />
Studierenden, die es ohnehin nicht in die klassischen Berufe<br />
zieht, wären nicht mehr gezwungen, das Examen zu machen;<br />
dies könnte zu einer nicht ganz unerheblichen Reduktion<br />
der Zulassungszahlen zum Staatsexamen führen.<br />
Da die Masterstudiengänge nicht mehr die Aufgabe hätten,<br />
auf die reglementierten juristischen Berufe vorzubereiten,<br />
wären sie von einer Vertiefung und Wiederholung des<br />
Pflichtfachstoffes entlastet. Sie könnten sich daher – nur<br />
dies wäre bolognakonform – auf wissenschaftliche Vertiefung<br />
oder interdisziplinäre Inhalte konzentrieren. Damit wären<br />
sie auch für ausländische Studierende interessant. Vor<br />
allem könnten ökonomisch orientierte Studenten einen juristischen<br />
Bachelor mit einem Master aus den Wirtschaftswissenschaften<br />
kombinieren. Dies könnte möglicherweise<br />
Chancen eröffnen, für Juristen verloren gegangene Berufsfelder<br />
(Steuerberater, Wirtschaftsprüfung, Manager) zurückzugewinnen.<br />
2. Kritische Würdigung<br />
Auch dieses Modell wirft die Frage auf, ob der Bachelor<br />
tatsächlich als berufsqualifizierend im Sinne des Bologna-<br />
Konzeptes zu akzeptieren ist, wenn nach wie vor der Weg<br />
zu den Berufsqualifikationen nur über eine weitere Prüfung<br />
führt. Dies lässt sich aber im Hinblick auf ein 4-jähriges Bachelor-Studium<br />
deutlich eher vertreten als im Modell eines<br />
3-jährigen, universitären Bachelors: Nach einem erfolgreichen<br />
4-jährigen Universitätsstudium verfügt der junge Jurist<br />
32 Jeep, NJW 2005, 2283; sowie ausführlich http://www.neue-juristenausbil<br />
dung.de.<br />
33 10 Thesen zur Bachelor- und Masterstruktur in Deutschland. Beschluss der<br />
Kultusministerkonferenz vom 12.6.2003, vgl. http://www.kmk.org/doc/beschl/<br />
bmthesen.pdf.<br />
34 Vorschläge zu „größeren Lösungen“ bei Jeep, NJW 2005, 2283, 2284.