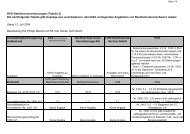Januar - Anwaltsblatt
Januar - Anwaltsblatt
Januar - Anwaltsblatt
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
MN Aufsätze<br />
z. B. das OLG Düsseldorf 11 oder das OLG Frankfurt 12 . Allein<br />
die abstrakte Möglichkeit eines Interessenwiderstreits stellt<br />
keinen Hinderungsgrund für eine Bestellung dar 13 .<br />
III. Neue Satzungsbestimmung<br />
Die Satzungsversammlung hat auf ihrer letzten Sitzung<br />
im November 2005 nunmehr einen neuen Anlauf unternommen,<br />
um das berufsrechtliche Verbot der Vertretung widerstreitender<br />
Interessen auf Sozietäten zu erstrecken. Die<br />
fragliche Vorschrift des § 3 BORA n. F. soll in der Zukunft<br />
lauten:<br />
„§ 3 Widerstreitende Interessen, Versagung der Berufstätigkeit<br />
(1) Der Rechtsanwalt darf nicht tätig werden, wenn er<br />
eine andere Partei in derselben Rechtssache im widerstreitenden<br />
Interesse bereits beraten oder vertreten hat oder mit<br />
dieser Rechtssache in sonstiger Weise im Sinne der §§ 45,<br />
46 Bundesrechtsanwaltsordnung beruflich befasst war.<br />
(2) Das Verbot des Abs. 1 gilt auch für alle mit ihm in<br />
derselben Berufsausübungs- oder Bürogemeinschaft gleich<br />
welcher Rechts- oder Organisationsform verbundenen<br />
Rechtsanwälte. Satz 1 gilt nicht, wenn sich im Einzelfall die<br />
betroffenen Mandanten in den widerstreitenden Mandaten<br />
nach umfassender Information mit der Vertretung ausdrücklich<br />
einverstanden erklärt haben und Belange der<br />
Rechtspflege nicht entgegenstehen. Information und Einverständniserklärung<br />
sollen in Textform erfolgen.<br />
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für den Fall, dass<br />
der Rechtsanwalt von einer Berufsausübungs- oder Bürogemeinschaft<br />
zu einer anderen Berufsausübungs- oder Bürogemeinschaft<br />
wechselt.<br />
(4) Wer erkennt, dass er entgegen den Absätzen 1 bis 3<br />
tätig ist, hat unverzüglich seinen Mandanten davon zu unterrichten<br />
und alle Mandate in derselben Rechtssache zu<br />
beenden.<br />
(5) Die vorstehenden Regelungen lassen die Verpflichtung<br />
zur Verschwiegenheit unberührt.“<br />
Mit einem Inkrafttreten dieser neuen Reglung ist nicht<br />
vor dem 1. Juli 2006 zu rechnen. Voraussetzung ist jedoch,<br />
dass das Bundesjustizministerium keine Beanstandung –<br />
wie erst kürzlich zum wiederholten Male bei der Neufassung<br />
des § 7 BORA – ausspricht. Dies ist auch diesmal<br />
nicht völlig auszuschließen, da die Vorschrift erhebliche<br />
Probleme aufwirft und gravierende verfassungsrechtliche<br />
Bedenken gegen die Kompetenz der Satzungsversammlung<br />
zum Erlass einer derart weitreichenden Regelung bestehen.<br />
IV. Allgemeine Kritik<br />
Die Neuregelung des § 3 BORA n. F. ist alles andere als<br />
ein Meisterwerk der anwaltlicher Satzungsautonomie. Dies<br />
gilt einmal unter dem Aspekt der Wiederholung. Teile der<br />
Norm sind entweder völlig überflüssig oder sie führen zu<br />
Problemen. Der erste Kritikpunkt betrifft den Absatz 1.<br />
Hier wird einmal völlig unnötig der § 43 a IV BRAO wiedergegeben;<br />
soweit darin die in der gesetzlichen Bestimmung<br />
sich nicht findenden Worte „in derselben Rechtssache“<br />
enthalten sind, ist damit keine konstitutive<br />
Neuregelung verbunden, weil die entsprechende Beschränkung<br />
schon immer bei § 43 a IV BRAO nach h. A. gegolten<br />
hat. 14 Nicht erforderlich ist auch die Niederlegungspflicht in<br />
Abs. 4; sie ist schließlich selbstverständliche Folge des Vertretungsverbots.<br />
Überflüssig ist schließlich auch die Rege-<br />
14 AnwBl 1 / 2006<br />
lung des Absatzes 5, wonach die Neuregelung die Verschwiegenheitspflicht<br />
unberührt lässt; insoweit besteht<br />
zudem ohnehin keine nennenswerte Satzungskompetenz<br />
nach § 59 b BRAO angesichts des Vorrangs der strafrechtlichen<br />
Normierung der Verschwiegenheitspflicht in § 203<br />
StGB.<br />
Nichtssagend ist weiter der Absatz 3, nach dem die Sozietätserstreckung<br />
des Absatz zwei auch im Falle des Sozietätswechsels<br />
gelten soll. Ursprünglich war speziell für diese<br />
Fallkonstellation bei dem Versuch der Umsetzung der Sozietätswechslerentscheidung<br />
des BVerfG 15 mit ihren Hinweisen<br />
auf eine mögliche Neuregelung eine „bandwurmartige“ Bestimmung<br />
mit zahlreichen Verfahrens- und Aufklärungspflichten<br />
vorgesehen. Sie hat sich in der Diskussion als untauglich<br />
bzw. unpraktikabel und unverhältnismäßig<br />
erwiesen. Mit dem endgültig beschlossen Verzicht auf alle<br />
Details und nur dem Verweis auf den Absatz 2 ist jedoch<br />
nichts gewonnen. Das Schweigen der Satzung erinnert an<br />
den Schlußsatz des mittlerweile „gestorbenen“ Literarischen<br />
Quartetts: „Man sieht betroffen, den Vorhang zu und alle<br />
Fragen offen.“<br />
Eine in mehrfacher Hinsicht nicht ganz unproblematische<br />
Wiederholung findet sich im 2. Satzteil des Absatz 1.<br />
Hier wird Bezug genommen auf die Berufspflichten der<br />
§§ 45, 46 BRAO. Dieser Verweis ist nicht nur ebenfalls entbehrlich.<br />
Unklar ist vielmehr, ob mit der Satzungsregelung<br />
auch Modifikationen der gesetzlichen Regelung verbunden<br />
sein sollen. Wenn nämlich z. B. bestimmt ist, dass der<br />
Rechtsanwalt auch nicht tätig werden darf, wenn er mit einer<br />
Rechtssache nach § 45 BRAO befasst war, so wird damit<br />
ein uneingeschränktes Tätigkeitsverbot normiert. Die mehr<br />
als problematische Bestimmung des § 45 I Nr. 4 BRAO erlaubt<br />
jedoch ein Tätigwerden des Rechtsanwalts, wenn die<br />
bisherige nichtanwaltliche Tätigkeit beendet ist. Diese Einschränkung<br />
ist auf Druck des Rechtsausschusses des Deutschen<br />
Bundestages aufgenommen worden und auch verfassungsrechtlich<br />
zwingend, da ein uneingeschränktes<br />
Tätigkeitsverbot am Maßstab des Art. 12 I GG nicht vertretbar<br />
war. 16 Diese unter dem Aspekt des Vorrangs des Gesetzes<br />
wie auch materiell verfassungsrechtlich zwingende Restriktion<br />
des Verbots findet sich nicht in Absatz 1 der<br />
Neuregelung, was bereits Bedenken im Hinblick auf die<br />
Verfassungsmäßigkeit aufwirft. Ihnen kann man nur dadurch<br />
begegnen, indem man den Absatz. 1 als – wenn auch<br />
verunglückten – Verweis auf die §§ 45, 46 BRAO auffasst,<br />
dem keine darüber hinausgehende oder davon abweichende<br />
inhaltliche Neuregelungsfunktion zukommt.<br />
Die Zitierung der §§ 45 und 46 BRAO ist auch deshalb<br />
fragwürdig, weil diese gesetzlichen Bestimmungen bereits<br />
Sozietätserstreckungsregelungen in den Absätzen drei enthalten<br />
im Gegensatz zu § 43 a IV BRAO. Das Verhältnis der<br />
11 OLG Düsseldorf NJW 2002, 3267: „ § 146 StPO verbietet es nicht, dass sich<br />
die Verteidiger mehrerer derselben Tat Beschuldigter untereinander besprechen<br />
und ihr Vorgehen miteinander abstimmen. Zur Entwicklung einer solchen<br />
– in den Grenzen der §§ 258 und 356 StGB zulässigen – gemeinsamen<br />
Verteidigungsstrategie kann der eine Verteidiger auch an Gesprächen teilnehmen,<br />
die der andere Verteidiger mit seinem Mandanten führt. Eine derartige<br />
Zusammenarbeit allein vermag die konkrete Vermutung für eine Tätigkeit zu<br />
Gunsten des weiteren Beschuldigten, die den Interessen des eigene Mandanten<br />
zuwiderläuft, nicht zu begründen.“<br />
12 NJW 1999, 1414.<br />
13 Vgl. a. OLG Stuttgart StV 2000,656, 5. Strafsenat; vgl. aber OLG Stuttgart,<br />
OLG StPO § 142 Nr. 5.<br />
14 Vgl. Kleine-Cosack, BRAO, 4. Aufl. 2003, § 43 a Rn 80.<br />
15 BVerfG AnwBl. 2003, 521.<br />
16 Vgl. Kleine-Cosack, BRAO (aaO. Fn. 14) § 45 Rn 22 ff.