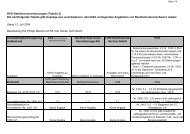Januar - Anwaltsblatt
Januar - Anwaltsblatt
Januar - Anwaltsblatt
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
MN Aufsätze<br />
fungsleistungen mit elf (§ 62 Abs. 3 JAPO) im Bundesvergleich<br />
am höchsten ist.<br />
Dieser Überblick zeigt, dass die Zahl der in den Bundesländern<br />
geforderten Klausuren um regelmäßig eine Klausur<br />
pro Fach variiert. Im zweiten Staatexamen ist eine Abweichung<br />
von bis zu zwei Klausuren üblich; der eben beschriebene<br />
Unterschied zwischen Sachsen-Anhalt und Bayern<br />
von drei Klausuren ist bereits eine Ausnahme und beruht<br />
zudem auf Besonderheiten des jeweiligen Prüfungsrechts.<br />
Es ist also heute schon möglich, in den staatlichen Prüfungen<br />
wenigstens eine Klausur rechtgebietsübergreifend<br />
zu konzipieren. Eine stärkere Abweichung wäre vor dem<br />
Hintergrund der geltenden Praxis aber mit dem Risiko behaftet,<br />
die „Einheitlichkeit“ zu verletzen.<br />
V. Begrenzte Möglichkeit zur Einführung rechtsgebietsübergreifender<br />
Prüfungen<br />
Es kann festgehalten werden, dass die Länder in begrenztem<br />
Umfang berechtigt sind, rechtsgebietsübergreifende<br />
Aufgaben in den juristischen Prüfungen in den<br />
Pflichtfächern einzuführen. Eine stärkere Betonung dieser<br />
Art der Prüfung muss das (auch) auf § 5 d Abs. 1<br />
S. 1 DRiG bezogene Einheitlichkeitserfordernis berücksichtigen.<br />
C. Vorschläge zur Beseitigung der „strukturellen<br />
Richterperspektive“<br />
Rechtsgebietsübergreifende Prüfungen sind also nur<br />
möglich, wenn sie landesrechtlich erlaubt werden. Eine solche<br />
landesrechtliche Regelung ist ihrerseits aber nur zulässig,<br />
wenn dadurch die „Einheitlichkeit der Prüfungsanforderungen“<br />
nicht verletzt wird.<br />
Wenn eine rechtsgebietsübergreifende Ausbildung und<br />
Prüfung gewollt ist – wovon man nach der Zielsetzung der<br />
Reform der Juristenausbildung ausgehen kann – dann muss<br />
nach Wegen gesucht werden, dieses Ziel zu erreichen. Diejenigen,<br />
die der Rechtsberatung und -gestaltung mehr Raum<br />
in der Ausbildung gewähren wollen, sind hier also selbst<br />
zur Rechtsgestaltung aufgerufen. Zwei Möglichkeiten stehen<br />
zur Auswahl:<br />
I. Konzertierte Aktion der Länder<br />
Da das Bundesrecht bis auf das „Einheitlichkeitserfordernis“<br />
den Ländern für rechtsgebietsübergreifende Prüfungsinhalte<br />
keine Vorgaben macht, könnten sich die Länder zu<br />
einer „konzertierten Aktion“ verständigen und rechtsgebietsübergreifende<br />
Aspekte in ihre Juristenausbildungsgesetze<br />
aufnehmen. Auch können einzelne Länder, solange<br />
die Einheitlichkeit gewahrt bleibt, schrittweise vorangehen<br />
und warten, bis die anderen folgen.<br />
Es bleibt aber zu bedenken, was geschieht, wenn sich die<br />
Länder nicht auf ein einheitliches Vorgehen einigen können<br />
oder sich die Prüfungsanforderungen so weit auseinanderentwickeln,<br />
dass keine Einheitlichkeit mehr besteht. Das<br />
Gebot der Einheitlichkeit lässt es nicht zu, dass auch nur ein<br />
Bundesland einen grundsätzlich anderen Weg wählt. Dies<br />
gilt sowohl für den Fall, dass ein oder nur wenige Länder<br />
von der bisherigen Praxis abweichen wollen, als auch für<br />
den, dass nur ein Land bei der „strukturellen Richterper-<br />
21 Greßmann, Die Reform der Juristenausbildung (2002), S. 40.<br />
12 AnwBl 1 / 2006<br />
spektive“ bleibt. Das Gebot der „Einheitlichkeit“ kennt kein<br />
Quorum.<br />
II. Ergänzung des DRiG<br />
Zur Beseitigung der „strukturellen Richterperspektive“<br />
kann der Bund auch das DRiG ändern, insb. das Einheitlichkeitserfordernis<br />
in § 5 d Abs. 1 S. 2 DRiG streichen. Dies<br />
könnte aber zu einer Auseinanderentwicklung der juristischen<br />
Ausbildungen führen, die letztlich den „Einheitsjuristen“<br />
– in dem Sinne, dass er in ganz Deutschland einheitlich<br />
ausgebildet wird – in Frage stellt 21 .<br />
Dem Ziel rechtsgebietsübergreifender Klausuren wäre<br />
am besten gedient, wenn das DRiG um eine Bestimmung ergänzt<br />
würde, die es den Ländern freistellt, rechtsgebietsübergreifende<br />
Prüfungen abzunehmen. Bei der bestehenden<br />
Regelung des § 5 d DRiG mag sich empfehlen, dem Satz 2<br />
in § 5 d Abs. 1 DRiG folgenden, durch ein Semikolon abgetrennten<br />
Halbsatz anzufügen: „die Einheitlichkeit bezieht<br />
sich nicht auf Trennung und Kombination der Pflichtfächer<br />
in der Prüfung“.<br />
Eine spezielle Bestimmung zur Wahrung der Richteroder<br />
Entscheiderperspektive in der Prüfung ist dagegen<br />
nicht erforderlich. Sie besteht bereits in Form des § 5 d<br />
Abs. 1 S. 1 DRiG, wonach die rechtsprechende und rechtsberatende<br />
Praxis zu berücksichtigen ist. Dies verbietet eine<br />
unverhältnismäßige Betonung des einen Aspekts gegenüber<br />
dem anderen. So wird man aus dieser Norm folgern können,<br />
dass rechtsgebietsübergreifende (Berater-)Klausuren allgemein<br />
nicht mehr als die Hälfte der Prüfung ausmachen<br />
dürften, da rechtsprechende und verwaltende Praxis auch<br />
berücksichtigt werden müssen.<br />
D. Keine gleichberechtigte Anwaltsausbildung bei<br />
struktureller Richterperspektive<br />
Während bereits heute rechtsbereichsübergreifend gelehrt<br />
und in den universitären Schwerpunktbereichen auch<br />
geprüft werden kann, ist die staatliche Prüfung durch das<br />
Prüfungsrecht der Länder der „strukturellen Richterperspektive“<br />
verhaftet. Gleichberechtigt wird die rechtsgebietsübergreifende<br />
Anwaltsperspektive in die juristische Ausbildung<br />
und Prüfung erst dann sein, wenn sich entweder die Bundesländer<br />
einheitlich hierauf verständigen oder der Bundesgesetzgeber<br />
eine entsprechende Vorschrift in das DRiG einfügt.<br />
Erste Schritte fort von der „strukturellen<br />
Richterperspektive“ und damit hin zu einer Gleichberechtigung<br />
der Anwaltsorientierung können die Länder schon<br />
heute jeweils alleine machen, etwa durch einzelne rechtsbereichsübergreifende<br />
Klausuren im ersten Examen.<br />
Dr. Kai von Lewinski, Berlin<br />
Der Autor ist wissenschaftlicher Assistent an der<br />
Humboldt-Universität zu Berlin. Er war Rechtsanwalt<br />
und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Anwaltsrecht<br />
an der Humboldt-Universität zu Berlin.