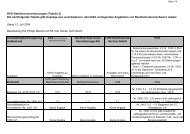Januar - Anwaltsblatt
Januar - Anwaltsblatt
Januar - Anwaltsblatt
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
MN Aufsätze<br />
wort, nämlich dasjenige vom „existenzvernichtenden Eingriff“<br />
zugewiesen. Statt eigenen wortschöpferischen Bemühens<br />
will ich mich zu seiner Erläuterung der Ausführungen<br />
des damaligen Vorsitzenden im II. BGH-Zivilsenat, Volker<br />
Röhricht8 bedienen:<br />
„Das Haftungskonzept des Bremer Vulkan-Urteils und<br />
seiner Nachfolgeentscheidungen beruht auf dem grundlegenden<br />
funktionellen Zusammenhang zwischen der Beschränkung<br />
der Haftung auf ein bestimmtes Gesellschaftsvermögen<br />
und der Separierung eines der Gesellschaft als<br />
eigenes zustehendes, von dem übrigen Vermögen der Gesellschafter<br />
getrennt zu haltendes Gesellschaftsvermögen<br />
und der strikten Bindung des ersteren zur vorrangigen Befriedigung<br />
der Gesellschaftsgläubiger. Die Wahrung dieses<br />
Trennungsprinzips ist unverzichtbare Bedingung der Haftungsbeschränkung.<br />
Die Haftungsbeschränkung hat also<br />
einen Preis: er besteht darin, dass der Gesellschafter das<br />
primär als Haftungssubstrat dienende Vermögen der Gesellschaft<br />
einschließlich der in ihr erarbeiteten Marktstellung<br />
nur insoweit unter Aufhebung der Trennung in sein<br />
privates oder anderweitiges wirtschaftliches Vermögen<br />
überführen darf, wie es nicht zur Bedienung der Verbindlichkeiten<br />
der Gesellschafter benötigt wird. Die ansonsten<br />
sehr weit gehende Dispositionsbefugnis der Gesellschafter<br />
über Existenz, Vermögen und Geschäftschancen der Gesellschaft<br />
endet dort, wo der Gläubigerschutz beginnt. Der Gesellschafter<br />
hat daher bei Entnahmen von Vermögenswerten<br />
der Gesellschaft im Hinblick auf deren primäre<br />
Zweckbestimmung zur Deckung ihrer Verbindlichkeiten<br />
stets in angemessener Weise Rücksicht auf den Erhalt der<br />
Fähigkeit der Gesellschaft zur Befriedigung ihrer Gläubiger<br />
zu nehmen. Nur die nicht erkennbar für diesen Zweck<br />
erforderlichen und deshalb in der Gesellschaft gebundenen<br />
Mittel darf er sich aneignen, um sie der Verwendung zu anderen<br />
privaten oder wirtschaftlichen Zwecken zuzuführen.<br />
Dieses Regelungskonzept reicht weit über das Recht der<br />
GmbH und den deutschen Rechtsraum hinaus. Es handelt<br />
sich bei ihm um das fundamentale Prinzip der Kapitalgesellschaften,<br />
die zwar den unter dieser Rechtsform tätigen<br />
Wirtschaftssubjekten die mit der Teilnahme am Wirtschaftsleben<br />
verbundenen Risiken einschließlich der Folgen etwaiger<br />
unternehmerischer Fehlentscheidungen (partiell) abnehmen<br />
sollen, aber nicht dazu bestimmt sind, ihnen die<br />
Möglichkeit zu geben, sich die unter dem schützenden Mantel<br />
der Kapitalgesellschaft erwirtschafteten Erträge anzueignen,<br />
die zu deren Erzielung eingegangenen Verbindlichkeiten<br />
dagegen zu Lasten der Gläubiger der Gesellschaft<br />
unbedient zu lassen.<br />
Das Haftungskonzept des Senats gründet damit unmittelbar<br />
im Kern des Funktionsprinzips der Kapitalgesellschaften<br />
selber. Die Kapitalgesellschaft ist eine juristische<br />
Kunstfigur, die ihren Betreibern die mit ihrer Teilnahme am<br />
Wirtschaftsleben verbundenen Risiken einschließlich der<br />
Gefahren unternehmerischer Fehlentscheidungen abnehmen<br />
soll und der das Recht zu diesem Zweck ein eigenes<br />
Vermögen zuordnet, das anstelle des übrigen Vermögens ihrer<br />
Betreiber für die unter Inanspruchnahme dieser Kunstfigur<br />
begründeten Schulden haften soll. Unverzichtbare,<br />
geradezu elementare Funktionsbedingung dieses den rechtlichen<br />
Grundsatz der persönlichen Einstandspflicht eines<br />
jeden Rechtssubjekts für die von ihm begründeten Verbindlichkeiten<br />
vermittels eines juristischen Kunstgriffs durch-<br />
20 AnwBl 1 / 2006<br />
brechenden Systems ist es, dass das Vermögen der Gesellschaft,<br />
mit dem sie den Gesellschaftern ihre persönliche<br />
Haftung abnehmen soll, strikt von dem sonstigen Vermögen<br />
der Gesellschafter abgesondert wird (Trennungsprinzip),<br />
während der gesamten Lebensdauer der Gesellschaft für<br />
die Erfüllung dieser Aufgabe reserviert bleibt und ihr nicht<br />
von ihren eigenen Gesellschaftern wieder entzogen wird.<br />
Die Gesellschafter dürfen sich deshalb nur die für die Erfüllung<br />
dieser Funktion nicht benötigten, in der Gesellschaft<br />
erwirtschafteten Überschüsse aneignen.“<br />
3. Von der „Kopfgeburt“ zum Eigeninteresse der GmbH<br />
Bremer Vulkan bedeutet einen Schritt von elementarer<br />
dogmatischer Bedeutung im Recht der Kapitalgesellschaften.<br />
Erstmals bekannte sich der BGH eindeutig zu dem, was<br />
man früher etwas vulgär als „Eigeninteresse“ 9 der GmbH<br />
bezeichnete. Während der BGH früher nichts davon wissen<br />
wollte10 , hat dieses „Eigeninteresse“ seit Bremer Vulkan<br />
eine Synonym-Funktion für das Interesse der Gesellschafts-<br />
Gläubiger, kurz: für das Gläubigerinteresse bekommen. Die<br />
GmbH-Gesellschafter stehen in der Pflicht, das Eigeninteresse<br />
ihrer GmbH um derer Gläubiger willen zu schützen.<br />
Wenn sie das nicht tun, müßte das haftungsrechtliche Folgen<br />
haben, weil sie damit den haftungsbeschränkenden<br />
Schutz verscherzten, den ihnen das Trennungsprinzip bietet.<br />
Vielleicht etwas zu ungenau wurde dies als neues Modell<br />
einer „Durchgriffshaftung“ 11 bezeichnet. Genau genommen<br />
handelt es sich um eine „Direkthaftung“ der Gesellschafter<br />
wegen der Beseitigung des sie zunächst haftungsrechtlich<br />
privilegierenden Trennungsprinzips. 12 Wir sind bei der<br />
GmbH in einem Haftungssystem angekommen, welches<br />
weitgehend dem der Kommanditistenhaftung entspricht.<br />
Schlimmer noch: Während es bei der Kommanditgesellschaft<br />
immer nur bei demjenigen Kommanditisten zum<br />
Wiederaufleben der persönlichen Haftung kommt, der etwas<br />
aus dem Vermögen der Kommanditgesellschaft zurückerhält,<br />
sollen bei der GmbH alle Gesellschafter, die an der<br />
Schmälerung des Eigenkapitals der GmbH mit existenzgefährdender<br />
Wirkung „mitwirken“, unmittelbar den Gläubigern<br />
gegenüber in die persönliche Haftung geraten, soweit<br />
letztere keine Befriedigung aus dem Gesellschaftsvermögen<br />
erlangen können.<br />
Außerdem: Die persönliche Haftung der Kommanditisten<br />
ist – jedenfalls in aller Regel – durch die in das Handelsregister<br />
eingetragene Haftsumme begrenzt. Verwirkt ein<br />
GmbH-Gesellschafter aus den oben erwähnten Gründen das<br />
Recht, sich auf das Trennungsprinzip zu berufen, dann ist<br />
seine persönliche Außenhaftung im Nachrang nach derjenigen<br />
der Gesellschaft unbeschränkt und unbeschränkbar.<br />
Was heißt das im einzelnen? Das grundsätzlich Neue an<br />
der Vulkan-Entscheidung ist die Weiterentwicklung des in<br />
den §§ 30, 31 GmbHG normierten Stammkapital-Schutzes<br />
zu einem allgemeinen Eigenkapital-Bestandsschutz, den die<br />
8 Gesellschaftsrecht in der Diskussion 2002, S. 24 f. (Bd. 6 der Schriftenreihe<br />
der Gesellschaftsrechtlichen Vereinigung).<br />
9 Priester, ZGR 1993, 512/517 m. w. N.<br />
10 BGHZ 56, 97/101; BGHZ 95, 345 f. (Autokran – vgl. Fn 1, BGH DB 1993,<br />
34).<br />
11 So zuletzt Goette ZIP 2005, 1481/1487.<br />
12 BGHZ 151, 181 – KBV.