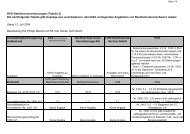Januar - Anwaltsblatt
Januar - Anwaltsblatt
Januar - Anwaltsblatt
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
MN Aufsätze<br />
ihr „center of main interest“, hat. Ist dies nicht der Fall,<br />
dann wird nicht etwa das entsprechende Gesellschaftsrecht<br />
des Sitzstaates angewendet, sondern die Existenz der Gesellschaft<br />
wird überhaupt geleugnet 16 . Nach herkömmlichem<br />
Verständnis ist die Wirkung der Sitztheorie also im wesentlichen<br />
negativ; positiv allenfalls insoweit, als auf eine nicht<br />
als rechtsfähig anerkennungsfähige ausländische Kapitalgesellschaft<br />
im Inland die für Personengesellschaften geltenden<br />
Regeln anzuwenden sind, was zur Folge hätte, dass wir<br />
nie zur Anwendung des haftungsrechtlichen Trennungsprinzips<br />
kommen würden.<br />
2. Die „Übersee-Entscheidung“ des EuGH – Kapitalgarantie<br />
und Kapitalschutz, einerseits, sowie Niederlassungsfreiheit,<br />
andererseits<br />
Die im deutschen internationalen Gesellschaftsrecht entwickelte<br />
Sitztheorie sollte also die Grundlage für die Entwicklung<br />
einer Kapitalgesellschaftskonzeption sichern, die<br />
wir, genauer: unser Gesetzgeber und unsere Gerichte, für<br />
die richtige oder jedenfalls vertretbare halten. Dieses nationale<br />
Anliegen wurde durch das Urteil des Europäischen Gerichtshofs<br />
vom 5.11.2002 17 gründlich durcheinandergewirbelt.<br />
Dieser Entscheidung („Überseering“) lag folgender<br />
Sachverhalt zugrunde: Im Jahre 1990 wurde eine niederländische<br />
Kapitalgesellschaft unter der Firma „Überseering<br />
B.V.“ ordnungsmäßig nach niederländischem Recht gegründet<br />
und in das für sie zuständige Handelsregister eingetragen.<br />
Die geschuldeten Einlagen wurden richtig und vollständig<br />
erbracht. Später veräußerten die niederländischen<br />
Gründungsgesellschafter ihre Gesellschaftsanteile wirksam<br />
an zwei deutsche Kaufleute. Diese kauften im Namen der<br />
Überseering B.V. in Düsseldorf ein Geschäftsgrundstück,<br />
von wo aus sie künftig die Geschäfte der Überseering B.V.<br />
betrieben. Nach Errichtung des dafür benötigten Geschäftsgebäudes<br />
kam es zu baumängelbedingten Auseinandersetzungen<br />
mit dem für die Gebäudeerrichtung herangezogenen<br />
Bauunternehmer.<br />
Die Auseinandersetzung mündete in einen Prozeß zwischen<br />
der Überseering B.V. als Klägerin und diesem Bauunternehmer.<br />
Die Instanzgerichte wiesen die Klage als unzulässig<br />
ab, weil sie – in Entsprechung der einleitend<br />
erläuterten Sitztheorie – die Rechts– und Parteifähigkeit der<br />
niederländischen Überseering B.V. in Deutschland verneinten.<br />
Sie wollten in dem Zusammenschluß der beiden Gesellschafter<br />
von Überseering B.V. allenfalls eine Gesellschaft<br />
bürgerlichen Rechts sehen, konnten aber nicht ahnen, dass<br />
der Bundesgerichtshof am 29.1.2001 18 die Rechtsfähigkeit<br />
der BGB-Außengesellschaft und damit ihre Parteifähigkeit<br />
anerkennen würde und damit die Zulässigkeit der von Überseering<br />
B.V. erhobenen Klage hätte bejahen müssen. Er, der<br />
BGH selbst, sah diese gesellschaftsrechtliche Entwicklung<br />
im März 2000 ebensowenig voraus, denn er fragte per Vorlagebeschluß<br />
den Europäischen Gerichtshof, was dieser davon<br />
halte, wenn deutsche Gerichte eine holländische Kapitalgesellschaft<br />
mit Geschäftssitz in Deutschland für ein<br />
rechtliches nullum erklären würden.<br />
Der EuGH war pflichtgemäß empört und schrieb den<br />
Deutschen auf, dass jede in einem Mitgliedsstaat der Europäischen<br />
Union ordnungsmäßig gegründete Kapitalgesellschaft<br />
ihren Geschäftssitz in jedem anderen Mitgliedsstaat<br />
der Europäischen Union nehmen dürfe und von diesem je-<br />
22 AnwBl 1 / 2006<br />
denfalls als rechts– und parteifähig anzuerkennen sei. Alles<br />
andere sei ein Verstoß gegen die im EG-Vertrag verbriefte<br />
Niederlassungsfreiheit 19 .<br />
Die Überseering-Entscheidung des EuGH verwarf die<br />
deutsche Sitztheorie, um zur Anerkennung der Rechts– und<br />
Parteifähigkeit der Überseering B.V. zu kommen. Die von<br />
der deutschen Regierung vorgebrachten Sorgen dahingehend,<br />
dass mit der Anerkennung solcher ausländischer<br />
Kapitalgesellschaften die deutschen Regeln über den Schutz<br />
des Gesellschaftskapitals und den Schutz von Minderheitsgesellschaftern<br />
unterlaufen werden könne und dass es dann<br />
auch möglich sei, die deutschen Regeln über die Mitbestimmung<br />
der Arbeitnehmer auszuhebeln, sah der EuGH als<br />
nicht entscheidungsrelevant für die Frage der Anerkennung<br />
von Rechts– und Parteifähigkeit an. Im Gegenteil: Er orakelte<br />
in Ziff. 92 der Entscheidungsgründe, „es lasse sich<br />
nicht ausschließen, dass zwingende Gründe des Gemeinwohls,<br />
wie der Schutz der Interessen der Gläubiger, der<br />
Minderheitsgesellschafter, der Arbeitnehmer oder auch des<br />
Fiskus, unter bestimmten Umständen und unter Beachtung<br />
bestimmter Voraussetzungen Beschränkungen der Niederlassungsfreiheit<br />
rechtfertigen können.“<br />
3. Von der „festen Burg“ zum Wettbewerb der Systeme<br />
Der damit verbundene Hoffnungsschimmer entschwand<br />
jedoch endgültig durch die Entscheidung zum Stichwort<br />
„Inspire Art“ des EuGH vom 30.9.2003 20 . Mit diesem Urteil<br />
verbot der EuGH den Niederländern eine gesetzliche Regelung,<br />
deren Zweck darauf gerichtet war, in England gegründete<br />
Briefkasten-Kapitalgesellschaften zu veranlassen, den<br />
in Holland geltenden Vorschriften über die Mindestkapitalausstattung<br />
zu genügen. Danach breitete sich hierzulande<br />
Ratlosigkeit aus. Die Deutschen sahen sich in einem Wettbewerb<br />
der Systeme, denn nun sollten die Kapitalgesellschafts-Konzepte<br />
von immerhin 25 EU-Mitgliedsstaaten in<br />
Deutschland zur Anwendung kommen dürfen.<br />
Zunächst einmal kam jedenfalls die englische Ltd. ohne<br />
gesetzlich festgelegte Mindestkapitalausstattung in Mode.<br />
Die Frage, wie wir darauf reagieren können und sollten, ist<br />
unverändert offen. Priester fragte unlängst öffentlich, ob<br />
wir nach „Inspire Art“ eine „neue“ GmbH brauchen 21 ,was<br />
er verneinte, offensichtlich in der Hoffnung, dass unsere<br />
Gerichte sich wohl Sanktionen gegen den allzu sorglosen<br />
Umgang mit unseriösen ausländischen Kapitalgesellschaften<br />
einfallen lassen würden. Nach seiner Prognose kann<br />
diese Sanktion nur in der Etablierung einer Unterkapitalisierungshaftung<br />
liegen, aber woran gemessen, am Geschäftsumfang<br />
und dem sich daraus ergebenden Eigenkapitalbedarf<br />
oder am Umfang des Ausfalls, den die Gläubiger erleiden<br />
oder an der Mindestkapitalausstattung, die das GmbH-Gesetz<br />
verlangt? – Lauter Ideen, die entweder unser Konzept<br />
für Gesellschafts– und Gesellschafterhaftung im Recht der<br />
Kapitalgesellschaften verwüsten oder nach den Grundsätzen<br />
der EuGH-Entscheidung zu Inspire Art verboten wären.<br />
16 Staudinger/Großfeld, IntGesR, 53 ff.; Behrens, Die Gesellschaft mit beschränkter<br />
Haftung im internationalen und europäischen Recht, RdNr. 4.<br />
17 EuGH-Rs C-208/00 – ZIP 2002, 2037.<br />
18 BGHZ 146, 341.<br />
19 EGV (Nizza-Fassung v. 26.2.2001), Art. 43, 48.<br />
20 EuGH-RsC-167/01 – DB 2003, 2217 ff.<br />
21 DB 2005, 1315.