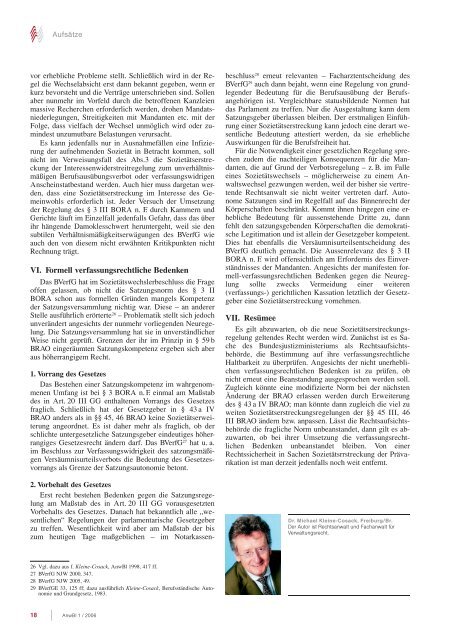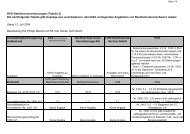Januar - Anwaltsblatt
Januar - Anwaltsblatt
Januar - Anwaltsblatt
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
MN Aufsätze<br />
vor erhebliche Probleme stellt. Schließlich wird in der Regel<br />
die Wechselabsicht erst dann bekannt gegeben, wenn er<br />
kurz bevorsteht und die Verträge unterschrieben sind. Sollen<br />
aber nunmehr im Vorfeld durch die betroffenen Kanzleien<br />
massive Recherchen erforderlich werden, drohen Mandatsniederlegungen,<br />
Streitigkeiten mit Mandanten etc. mit der<br />
Folge, dass vielfach der Wechsel unmöglich wird oder zumindest<br />
unzumutbare Belastungen verursacht.<br />
Es kann jedenfalls nur in Ausnahmefällen eine Infizierung<br />
der aufnehmenden Sozietät in Betracht kommen, soll<br />
nicht im Verweisungsfall des Abs.3 die Sozietätserstreckung<br />
der Interessenwiderstreitregelung zum unverhältnismäßigen<br />
Berufsausübungsverbot oder verfassungswidrigen<br />
Anscheinstatbestand werden. Auch hier muss dargetan werden,<br />
dass eine Sozietätserstreckung im Interesse des Gemeinwohls<br />
erforderlich ist. Jeder Versuch der Umsetzung<br />
der Regelung des § 3 III BORA n. F. durch Kammern und<br />
Gerichte läuft im Einzelfall jedenfalls Gefahr, dass das über<br />
ihr hängende Damoklesschwert heruntergeht, weil sie den<br />
subtilen Verhältnismäßigkeitserwägungen des BVerfG wie<br />
auch den von diesem nicht erwähnten Kritikpunkten nicht<br />
Rechnung trägt.<br />
VI. Formell verfassungsrechtliche Bedenken<br />
Das BVerfG hat im Sozietätswechslerbeschluss die Frage<br />
offen gelassen, ob nicht die Satzungsnorm des § 3 II<br />
BORA schon aus formellen Gründen mangels Kompetenz<br />
der Satzungsversammlung nichtig war. Diese – an anderer<br />
Stelle ausführlich erörterte26 – Problematik stellt sich jedoch<br />
unverändert angesichts der nunmehr vorliegenden Neuregelung.<br />
Die Satzungsversammlung hat sie in unverständlicher<br />
Weise nicht geprüft. Grenzen der ihr im Prinzip in § 59 b<br />
BRAO eingeräumten Satzungskompetenz ergeben sich aber<br />
aus höherrangigem Recht.<br />
1. Vorrang des Gesetzes<br />
Das Bestehen einer Satzungskompetenz im wahrgenommenen<br />
Umfang ist bei § 3 BORA n. F. einmal am Maßstab<br />
des in Art. 20 III GG enthaltenen Vorrangs des Gesetzes<br />
fraglich. Schließlich hat der Gesetzgeber in § 43 a IV<br />
BRAO anders als in §§ 45, 46 BRAO keine Sozietätserweiterung<br />
angeordnet. Es ist daher mehr als fraglich, ob der<br />
schlichte untergesetzliche Satzungsgeber eindeutiges höherrangiges<br />
Gesetzesrecht ändern darf. Das BVerfG 27 hat u. a.<br />
im Beschluss zur Verfassungswidrigkeit des satzungsmäßigen<br />
Versäumnisurteilsverbots die Bedeutung des Gesetzesvorrangs<br />
als Grenze der Satzungsautonomie betont.<br />
2. Vorbehalt des Gesetzes<br />
Erst recht bestehen Bedenken gegen die Satzungsregelung<br />
am Maßstab des in Art. 20 III GG vorausgesetzten<br />
Vorbehalts des Gesetzes. Danach hat bekanntlich alle „wesentlichen“<br />
Regelungen der parlamentarische Gesetzgeber<br />
zu treffen. Wesentlichkeit wird aber am Maßstab der bis<br />
zum heutigen Tage maßgeblichen – im Notarkassen-<br />
26 Vgl. dazu aus f. Kleine-Cosack, AnwBl 1998, 417 ff.<br />
27 BVerfG NJW 2000, 347.<br />
28 BVerfG NJW 2005, 49.<br />
29 BVerfGE 33, 125 ff; dazu ausführlich Kleine-Cosack, Berufsständische Autonomie<br />
und Grundgesetz, 1983.<br />
18 AnwBl 1 / 2006<br />
beschluss 28 erneut relevanten – Facharztentscheidung des<br />
BVerfG 29 auch dann bejaht, wenn eine Regelung von grundlegender<br />
Bedeutung für die Berufsausübung der Berufsangehörigen<br />
ist. Vergleichbare statusbildende Normen hat<br />
das Parlament zu treffen. Nur die Ausgestaltung kann dem<br />
Satzungsgeber überlassen bleiben. Der erstmaligen Einführung<br />
einer Sozietätserstreckung kann jedoch eine derart wesentliche<br />
Bedeutung attestiert werden, da sie erhebliche<br />
Auswirkungen für die Berufsfreiheit hat.<br />
Für die Notwendigkeit einer gesetzlichen Regelung sprechen<br />
zudem die nachteiligen Konsequenzen für die Mandanten,<br />
die auf Grund der Verbotsregelung – z. B. im Falle<br />
eines Sozietätswechsels – möglicherweise zu einem Anwaltswechsel<br />
gezwungen werden, weil der bisher sie vertretende<br />
Rechtsanwalt sie nicht weiter vertreten darf. Autonome<br />
Satzungen sind im Regelfall auf das Binnenrecht der<br />
Körperschaften beschränkt. Kommt ihnen hingegen eine erhebliche<br />
Bedeutung für aussenstehende Dritte zu, dann<br />
fehlt den satzungsgebenden Körperschaften die demokratische<br />
Legitimation und ist allein der Gesetzgeber kompetent.<br />
Dies hat ebenfalls die Versäumnisurteilsentscheidung des<br />
BVerfG deutlich gemacht. Die Aussenrelevanz des § 3 II<br />
BORA n. F. wird offensichtlich am Erfordernis des Einverständnisses<br />
der Mandanten. Angesichts der manifesten formell-verfassungsrechtlichen<br />
Bedenken gegen die Neureglung<br />
sollte zwecks Vermeidung einer weiteren<br />
(verfassungs-) gerichtlichen Kassation letztlich der Gesetzgeber<br />
eine Sozietätserstreckung vornehmen.<br />
VII. Resümee<br />
Es gilt abzuwarten, ob die neue Sozietätserstreckungsregelung<br />
geltendes Recht werden wird. Zunächst ist es Sache<br />
des Bundesjustizministeriums als Rechtsaufsichtsbehörde,<br />
die Bestimmung auf ihre verfassungsrechtliche<br />
Haltbarkeit zu überprüfen. Angesichts der nicht unerheblichen<br />
verfassungsrechtlichen Bedenken ist zu prüfen, ob<br />
nicht erneut eine Beanstandung ausgesprochen werden soll.<br />
Zugleich könnte eine modifizierte Norm bei der nächsten<br />
Änderung der BRAO erlassen werden durch Erweiterung<br />
des § 43 a IV BRAO; man könnte dann zugleich die viel zu<br />
weiten Sozietätserstreckungsregelungen der §§ 45 III, 46<br />
III BRAO ändern bzw. anpassen. Lässt die Rechtsaufsichtsbehörde<br />
die fragliche Norm unbeanstandet, dann gilt es abzuwarten,<br />
ob bei ihrer Umsetzung die verfassungsrechtlichen<br />
Bedenken unbeanstandet bleiben. Von einer<br />
Rechtssicherheit in Sachen Sozietätsrrstreckung der Prävarikation<br />
ist man derzeit jedenfalls noch weit entfernt.<br />
Dr. Michael Kleine-Cosack, Freiburg/Br.<br />
Der Autor ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für<br />
Verwaltungsrecht.