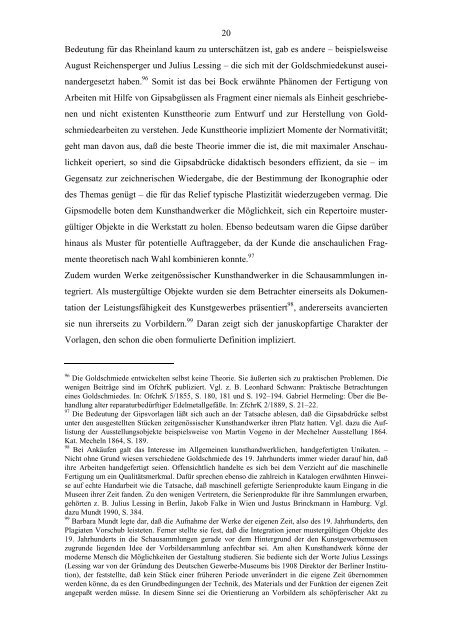Thesis - RWTH Aachen University
Thesis - RWTH Aachen University
Thesis - RWTH Aachen University
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
20<br />
Bedeutung für das Rheinland kaum zu unterschätzen ist, gab es andere – beispielsweise<br />
August Reichensperger und Julius Lessing – die sich mit der Goldschmiedekunst ausei-<br />
nandergesetzt haben. 96 Somit ist das bei Bock erwähnte Phänomen der Fertigung von<br />
Arbeiten mit Hilfe von Gipsabgüssen als Fragment einer niemals als Einheit geschriebe-<br />
nen und nicht existenten Kunsttheorie zum Entwurf und zur Herstellung von Gold-<br />
schmiedearbeiten zu verstehen. Jede Kunsttheorie impliziert Momente der Normativität;<br />
geht man davon aus, daß die beste Theorie immer die ist, die mit maximaler Anschau-<br />
lichkeit operiert, so sind die Gipsabdrücke didaktisch besonders effizient, da sie – im<br />
Gegensatz zur zeichnerischen Wiedergabe, die der Bestimmung der Ikonographie oder<br />
des Themas genügt – die für das Relief typische Plastizität wiederzugeben vermag. Die<br />
Gipsmodelle boten dem Kunsthandwerker die Möglichkeit, sich ein Repertoire muster-<br />
gültiger Objekte in die Werkstatt zu holen. Ebenso bedeutsam waren die Gipse darüber<br />
hinaus als Muster für potentielle Auftraggeber, da der Kunde die anschaulichen Fragmente<br />
theoretisch nach Wahl kombinieren konnte. 97<br />
Zudem wurden Werke zeitgenössischer Kunsthandwerker in die Schausammlungen in-<br />
tegriert. Als mustergültige Objekte wurden sie dem Betrachter einerseits als Dokumen-<br />
tation der Leistungsfähigkeit des Kunstgewerbes präsentiert 98 , andererseits avancierten<br />
sie nun ihrerseits zu Vorbildern. 99 Daran zeigt sich der januskopfartige Charakter der<br />
Vorlagen, den schon die oben formulierte Definition impliziert.<br />
96 Die Goldschmiede entwickelten selbst keine Theorie. Sie äußerten sich zu praktischen Problemen. Die<br />
wenigen Beiträge sind im OfchrK publiziert. Vgl. z. B. Leonhard Schwann: Praktische Betrachtungen<br />
eines Goldschmiedes. In: OfchrK 5/1855, S. 180, 181 und S. 192–194. Gabriel Hermeling: Über die Behandlung<br />
alter reparaturbedürftiger Edelmetallgefäße. In: ZfchrK 2/1889, S. 21–22.<br />
97 Die Bedeutung der Gipsvorlagen läßt sich auch an der Tatsache ablesen, daß die Gipsabdrücke selbst<br />
unter den ausgestellten Stücken zeitgenössischer Kunsthandwerker ihren Platz hatten. Vgl. dazu die Auflistung<br />
der Ausstellungsobjekte beispielsweise von Martin Vogeno in der Mechelner Ausstellung 1864.<br />
Kat. Mecheln 1864, S. 189.<br />
98 Bei Ankäufen galt das Interesse im Allgemeinen kunsthandwerklichen, handgefertigten Unikaten. –<br />
Nicht ohne Grund wiesen verschiedene Goldschmiede des 19. Jahrhunderts immer wieder darauf hin, daß<br />
ihre Arbeiten handgefertigt seien. Offensichtlich handelte es sich bei dem Verzicht auf die maschinelle<br />
Fertigung um ein Qualitätsmerkmal. Dafür sprechen ebenso die zahlreich in Katalogen erwähnten Hinweise<br />
auf echte Handarbeit wie die Tatsache, daß maschinell gefertigte Serienprodukte kaum Eingang in die<br />
Museen ihrer Zeit fanden. Zu den wenigen Vertretern, die Serienprodukte für ihre Sammlungen erwarben,<br />
gehörten z. B. Julius Lessing in Berlin, Jakob Falke in Wien und Justus Brinckmann in Hamburg. Vgl.<br />
dazu Mundt 1990, S. 384.<br />
99 Barbara Mundt legte dar, daß die Aufnahme der Werke der eigenen Zeit, also des 19. Jahrhunderts, den<br />
Plagiaten Vorschub leisteten. Ferner stellte sie fest, daß die Integration jener mustergültigen Objekte des<br />
19. Jahrhunderts in die Schausammlungen gerade vor dem Hintergrund der den Kunstgewerbemuseen<br />
zugrunde liegenden Idee der Vorbildersammlung anfechtbar sei. Am alten Kunsthandwerk könne der<br />
moderne Mensch die Möglichkeiten der Gestaltung studieren. Sie bediente sich der Worte Julius Lessings<br />
(Lessing war von der Gründung des Deutschen Gewerbe-Museums bis 1908 Direktor der Berliner Institution),<br />
der feststellte, daß kein Stück einer früheren Periode unverändert in die eigene Zeit übernommen<br />
werden könne, da es den Grundbedingungen der Technik, des Materials und der Funktion der eigenen Zeit<br />
angepaßt werden müsse. In diesem Sinne sei die Orientierung an Vorbildern als schöpferischer Akt zu