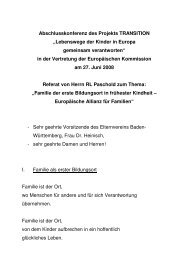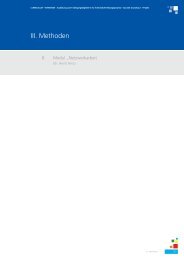Dokumentation Grundtvig 2
Dokumentation Grundtvig 2
Dokumentation Grundtvig 2
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
05-08-2008-II._Themen-3_Modul:<strong>Dokumentation</strong> <strong>Grundtvig</strong> 2 25.08.2008 16:41 Seite 69<br />
CURRICULUM - TRANSITION - Ausbildung zum/r Übergangsbegleiter/in für frühkindliche Bildungsprozesse - Socrates <strong>Grundtvig</strong> 1.1 Projekt<br />
II. Themen<br />
3. Modul „Entwicklungspsychologische Ansätze<br />
nimmt er nun auch den empathischen Prozess als<br />
solchen wahr. Wie einfühlsam, bzw. uneinfühlsam<br />
seine Umwelt auf ihn reagiert, entscheidet<br />
über seine psychische Einbindung in die zwischenmenschliche<br />
Gemeinschaft, bzw. über<br />
seine psychische Einsamkeit. Spätestens zu diesem<br />
Zeitpunkt der Entwicklung wird die zukünftige<br />
existentielle Befindlichkeit eines Säuglings<br />
geprägt.<br />
Zwischenmenschliche Bezogenheit wird besonders<br />
durch drei innere Erlebnisweisen hergestellt:<br />
Durch die gemeinsame Aufmerksamkeit, die gemeinsame<br />
Absicht und die Gemeinsamkeit affektiver<br />
Zustände. Das auffälligste Merkmal der<br />
intersubjektiven Bezogenheit ist das geteilte Erleben<br />
von Gefühlen. Der Charakter ist überwiegend<br />
transmodal. Der Rhythmus wird für den<br />
Säugling zu einem Charakteristikum seiner Umwelt.<br />
In dieser Zeit lebt das Kind, obwohl bei diesen<br />
Ab- und Einstimmungsvorgängen<br />
organismische, motorische, affektive und kognitive<br />
Wahrnehmung zusammenspielen, auch in<br />
der Einheit der Sinne. Eine Wahrnehmung der<br />
Welt bleibt eine ganzheitliche. Die amodalen Abund<br />
Einstimmungsprozesse, die Genauigkeit<br />
ihres Zusammenspiels, ihre Richtigkeit für das<br />
Kind sind das Ziel, das in sich selbst entwicklungsfördernd<br />
sein soll.<br />
Gemeinsam geteilte Gefühle vermitteln die<br />
grundlegende Erfahrung, dass innere Zustände,<br />
soziale Prozesse und Beziehungsangelegenheit<br />
von tiefem sozialem Wesen sind. Der Wunsch<br />
nach vertrauter Nähe zum Objektiv ist ein angeboren<br />
und zutiefst menschlicher Impuls. Das<br />
Wesen der Intersubjektivität besteht darin, affektive<br />
Zustände mit anderen zu teilen und sich mitzuteilen,<br />
somit primäres Bedürfnis nach Kontakt<br />
und Berührung. Die Nähe ist psychischer, konkret<br />
körperlicher Natur. Die Entwicklung vom Körpergefühl<br />
und Beziehungsfähigkeit ist nicht so entscheidend<br />
wie die stimmige Interaktion im<br />
Rahmen eines engen Körperkontaktes. Die Qualität<br />
der Berührung ist entscheidend. Harmonierende<br />
Stimmigkeit und Erfahrung des<br />
Kleinkindes, das es selbst willentlich Berührung<br />
und körperlichen Austausch herstellen und regulieren<br />
kann.<br />
Orientiert sich der Körperkontakt nur an den Bedürfnissen<br />
des anderen, verliert das Kind das<br />
Empfinden, für seine körperliche Urheberschaft<br />
und eigenes Wirkungsvermögen in der Gestaltung<br />
von Beziehungen. Misslingt die Begegnung,<br />
bleibt die Sehnsucht nach stimmiger Berührung<br />
lebenslang in den Zellen gespeichert und der Körper<br />
ruft nach einer korrigierenden Erfahrung. Obwohl<br />
hier schon Laute und Vokalisierung eine<br />
erhebliche Rolle spielen, bewegt sich das Kind<br />
immer noch im vorsprachlichen Stadium seines<br />
Selbsterlebens. Mit dem Eintritt in die Welt der<br />
Symbole und Sprache findet eine einschneidende<br />
Veränderung im Selbsterleben statt.<br />
Etwa in der Mitte des 2. Lebensjahres beginnen<br />
Kinder, sich die Welt um sie herum auch mit Hilfe<br />
von Symbolen, Zeichen und Bildern vorzustellen,<br />
oder wie man sagt, psychisch zu repräsentieren.<br />
Dies verändert ihre Weltsicht fundamental. Sie<br />
können sich selbst zunehmend zum Objekt der<br />
eigenen Reflexionen machen, über Personen und<br />
Dinge kommunizieren, die nicht mehr direkt anwesend<br />
sind, im Spiel symbolisch handeln, oder<br />
Gefühle und empathisches Verhalten in Worte<br />
fassen. Sie beginnen von sich selbst als Person zu<br />
sprechen und konsolidieren ihre Geschlechtsidentität.<br />
Neue Formen der Kommunikation als<br />
Gemeinsamkeit über die Sprache werden möglich.<br />
Dabei führt der Spracherwerb aber zu einem<br />
Selbst- wie zu einem interpersonalen Problem,<br />
der Einordnung von Bedeutung dessen, was<br />
wahrgenommen wird. Bedeutung im Sinne eines<br />
Bindegliedes zwischen erfahrener oder gedachter<br />
Welt und Wörtern ist nun keine naturgegebene,<br />
unmittelbar einleuchtende Tatsache mehr.<br />
Sie muss vielmehr zwischen dem Kind und den<br />
Eltern wechselseitig ausgehandelt werden. Bedeutungen<br />
ergeben sich fortan als Verhandlungen<br />
zwischen Kind und Bezugspersonen, die<br />
vereinbaren, was sie als gemeinsam verstehen. In<br />
dem individuellen Erleben von Wirklichkeit muss<br />
über gemeinsame Ich-, Du- und Wir-Bedeutungen<br />
auch eine gemeinsame Konstruktion von<br />
Wirklichkeit hergestellt werden. Das Kind wird<br />
mit zusätzlichen Anforderungen konfrontiert, die<br />
sein bisheriges Welterleben und sein Gefühl von<br />
Eigenmächtigkeit zutiefst verändern.<br />
Die Phase im Leben, in der es selbstständig zu<br />
gehen und zu sprechen beginnt, ist eine hochkritische<br />
Phase. Es wird jetzt auf eine fremde soziale<br />
Ordnung hin umorientiert. Es wird vom Kind<br />
II. Themen 69