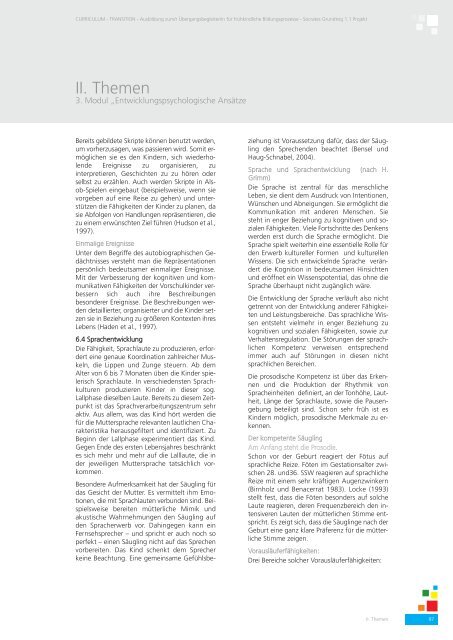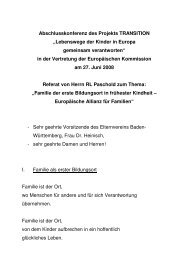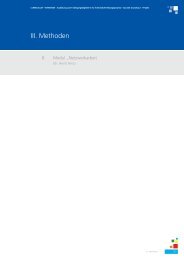Dokumentation Grundtvig 2
Dokumentation Grundtvig 2
Dokumentation Grundtvig 2
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
05-08-2008-II._Themen-3_Modul:<strong>Dokumentation</strong> <strong>Grundtvig</strong> 2 25.08.2008 16:42 Seite 97<br />
CURRICULUM - TRANSITION - Ausbildung zum/r Übergangsbegleiter/in für frühkindliche Bildungsprozesse - Socrates <strong>Grundtvig</strong> 1.1 Projekt<br />
II. Themen<br />
3. Modul „Entwicklungspsychologische Ansätze<br />
Bereits gebildete Skripte können benutzt werden,<br />
um vorherzusagen, was passieren wird. Somit ermöglichen<br />
sie es den Kindern, sich wiederholende<br />
Ereignisse zu organisieren, zu<br />
interpretieren, Geschichten zu zu hören oder<br />
selbst zu erzählen. Auch werden Skripte in Alsob-Spielen<br />
eingebaut (beispielsweise, wenn sie<br />
vorgeben auf eine Reise zu gehen) und unterstützen<br />
die Fähigkeiten der Kinder zu planen, da<br />
sie Abfolgen von Handlungen repräsentieren, die<br />
zu einem erwünschten Ziel führen (Hudson et al.,<br />
1997).<br />
Unter dem Begriffe des autobiographischen Gedächtnisses<br />
versteht man die Repräsentationen<br />
persönlich bedeutsamer einmaliger Ereignisse.<br />
Mit der Verbesserung der kognitiven und kommunikativen<br />
Fähigkeiten der Vorschulkinder verbessern<br />
sich auch ihre Beschreibungen<br />
besonderer Ereignisse. Die Beschreibungen werden<br />
detaillierter, organisierter und die Kinder setzen<br />
sie in Beziehung zu größeren Kontexten ihres<br />
Lebens (Haden et al., 1997).<br />
6.4 Sprachentwicklung<br />
Die Fähigkeit, Sprachlaute zu produzieren, erfordert<br />
eine genaue Koordination zahlreicher Muskeln,<br />
die Lippen und Zunge steuern. Ab dem<br />
Alter von 6 bis 7 Monaten üben die Kinder spielerisch<br />
Sprachlaute. In verschiedensten Sprachkulturen<br />
produzieren Kinder in dieser sog.<br />
Lallphase dieselben Laute. Bereits zu diesem Zeitpunkt<br />
ist das Sprachverarbeitungszentrum sehr<br />
aktiv. Aus allem, was das Kind hört werden die<br />
für die Muttersprache relevanten lautlichen Charakteristika<br />
herausgefiltert und identifiziert. Zu<br />
Beginn der Lallphase experimentiert das Kind.<br />
Gegen Ende des ersten Lebensjahres beschränkt<br />
es sich mehr und mehr auf die Lalllaute, die in<br />
der jeweiligen Muttersprache tatsächlich vorkommen.<br />
Besondere Aufmerksamkeit hat der Säugling für<br />
das Gesicht der Mutter. Es vermittelt ihm Emotionen,<br />
die mit Sprachlauten verbunden sind. Beispielsweise<br />
bereiten mütterliche Mimik und<br />
akustische Wahrnehmungen den Säugling auf<br />
den Spracherwerb vor. Dahingegen kann ein<br />
Fernsehsprecher – und spricht er auch noch so<br />
perfekt – einen Säugling nicht auf das Sprechen<br />
vorbereiten. Das Kind schenkt dem Sprecher<br />
keine Beachtung. Eine gemeinsame Gefühlsbe-<br />
ziehung ist Voraussetzung dafür, dass der Säugling<br />
den Sprechenden beachtet (Bensel und<br />
Haug-Schnabel, 2004).<br />
Die Sprache ist zentral für das menschliche<br />
Leben, sie dient dem Ausdruck von Intentionen,<br />
Wünschen und Abneigungen. Sie ermöglicht die<br />
Kommunikation mit anderen Menschen. Sie<br />
steht in enger Beziehung zu kognitiven und sozialen<br />
Fähigkeiten. Viele Fortschritte des Denkens<br />
werden erst durch die Sprache ermöglicht. Die<br />
Sprache spielt weiterhin eine essentielle Rolle für<br />
den Erwerb kultureller Formen und kulturellen<br />
Wissens. Die sich entwickelnde Sprache verändert<br />
die Kognition in bedeutsamen Hinsichten<br />
und eröffnet ein Wissenspotential, das ohne die<br />
Sprache überhaupt nicht zugänglich wäre.<br />
Die Entwicklung der Sprache verläuft also nicht<br />
getrennt von der Entwicklung anderer Fähigkeiten<br />
und Leistungsbereiche. Das sprachliche Wissen<br />
entsteht vielmehr in enger Beziehung zu<br />
kognitiven und sozialen Fähigkeiten, sowie zur<br />
Verhaltensregulation. Die Störungen der sprachlichen<br />
Kompetenz verweisen entsprechend<br />
immer auch auf Störungen in diesen nicht<br />
sprachlichen Bereichen.<br />
Die prosodische Kompetenz ist über das Erkennen<br />
und die Produktion der Rhythmik von<br />
Spracheinheiten definiert, an der Tonhöhe, Lautheit,<br />
Länge der Sprachlaute, sowie die Pausengebung<br />
beteiligt sind. Schon sehr früh ist es<br />
Kindern möglich, prosodische Merkmale zu erkennen.<br />
Schon vor der Geburt reagiert der Fötus auf<br />
sprachliche Reize. Föten im Gestationsalter zwischen<br />
28. und36. SSW reagieren auf sprachliche<br />
Reize mit einem sehr kräftigen Augenzwinkern<br />
(Birnholz und Benacerrat 1983). Locke (1993)<br />
stellt fest, dass die Föten besonders auf solche<br />
Laute reagieren, deren Frequenzbereich den intensiveren<br />
Lauten der mütterlichen Stimme entspricht.<br />
Es zeigt sich, dass die Säuglinge nach der<br />
Geburt eine ganz klare Präferenz für die mütterliche<br />
Stimme zeigen.<br />
Drei Bereiche solcher Vorausläuferfähigkeiten:<br />
II. Themen 97