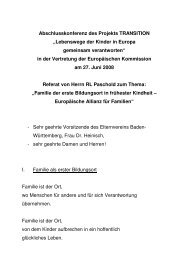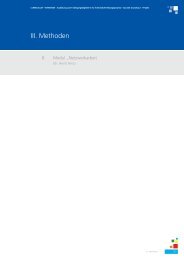Dokumentation Grundtvig 2
Dokumentation Grundtvig 2
Dokumentation Grundtvig 2
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
05-08-2008-II._Themen-3_Modul:<strong>Dokumentation</strong> <strong>Grundtvig</strong> 2 25.08.2008 16:41 Seite 79<br />
CURRICULUM - TRANSITION - Ausbildung zum/r Übergangsbegleiter/in für frühkindliche Bildungsprozesse - Socrates <strong>Grundtvig</strong> 1.1 Projekt<br />
II. Themen<br />
3. Modul „Entwicklungspsychologische Ansätze<br />
befreundete Kinder die heftigsten Auseinandersetzungen<br />
führen. Dies wird jedoch verständlich,<br />
wenn man Auseinandersetzungen nicht als Gegensatz<br />
zu Kooperation, sondern als Teil von ihr<br />
versteht (Dittrich et al., 2001). Konflikte allgemein<br />
dienen dazu, Kräfte zu messen, Rechte auszuhandeln,<br />
Kontakt aufzunehmen oder die<br />
bestehende Situation zu ändern. Stoßen bei befreundeten<br />
Spielpartnern verschiedene Spielideen,<br />
Meinungen und Interessen aufeinander,<br />
so ist das Konfliktrisiko besonders hoch. Gerade<br />
diese Konflikte fördern jedoch die Sozial- und<br />
Denkentwicklung (Schneider und Wüstenberg,<br />
2001). Bereits Einjährige verfügen über Konfliktlösestrategien.<br />
Zweijährige sind in der Lage nach<br />
sozialen Regeln wie beispielsweise der „Priorität<br />
früherer Besitzrechte“ zu handeln. Das bedeutet,<br />
dass sie meist auch ohne die Intervention Erwachsener<br />
weggenommene und vom Erstbesitzer<br />
wieder eingeforderte Objekte zurückgeben.<br />
Besitzstreitigkeiten (die Hauptursache für Konflikte<br />
in den ersten Jahren) haben eindeutig soziale<br />
Gründe und drehen sich weniger um das<br />
Spielzeug an sich. Besitzansprüche („meins“)<br />
werden selbst dann geltend gemacht, wenn beiden<br />
streitenden Kindern ein identisches Spielzeug<br />
zur Verfügung steht.<br />
î Ahnert, L. (2003): Die Bedeutung von Peers<br />
für die frühe Sozialentwicklung des Kindes.<br />
In: Keller, H. Handbuch der Kleinkindforschung<br />
(S. 489-524). Bern: Hans Huber<br />
î Bensel, J. (1999): Vertrauen schaffen von<br />
Anfang an. Wie eine gute Eingewöhnung<br />
gelingen kann. ZeT (1), S.8-10.<br />
î Bensel, J. (2000): Aller Abschied ist schwerdie<br />
Entwöhnung. Warum die letzten Wochen<br />
in der Tagespflege von großer Bedeutung<br />
sind. ZeT (3), S.8-11.<br />
î Dittrich, G., Dörfler, M., Schneider, K.<br />
(2001): Wenn Kinder in Konflikt geraten.<br />
Eine Beobachtungsstudie in Kindertagesstätten.<br />
Neuwied: Luchterhand.<br />
î Durkin, K. (1997): Entwicklungssozialpsychologie.<br />
In: Stroebe, W., Hewstone, G.,<br />
Stephenson, M., Sozialpsychologie. Eine<br />
Einführung (S. 49-78). Berlin: Springer.<br />
î Haug-Schnabel, G. (2004): Verhaltensbiologische<br />
ERkenntnisse aus der Mutter-Kind-<br />
Bindungsforschung. Die Hebamme 17 (3),<br />
S. 144-151.<br />
î Haug-Schnabel, G., Bensel, J. (2004): Vom<br />
Säugling zum Schulkind- Entwicklungspsychologische<br />
Grundlagen. kindergarten heute<br />
spezial. Freiburg: Herder.<br />
î Haug-Schnabel, G. Bensel, J. (2005): Grundlagen<br />
der Entwicklungspsycologie. Die ersten<br />
10 Lebensjahre. Freiburg: Herder.<br />
î Keller, H. (1998): Entwicklung im Kontext.<br />
Entwicklungspsychologische Konsequenzen<br />
für eine außerfamiliäre Betreuung des Kleinkindes.<br />
In: Ahnert, L., Tagesbetreuung für<br />
Kinder unter 3 Jahren (S.164-172). Bern:<br />
Hans Huber.<br />
î Schneider, K., Wüstenberg, W. (1993): Kinderfreundschaften<br />
im Krabbelalter. In: Deutsches<br />
Jugendinstitut, Was für Kinder. Aufwachsen<br />
in Deutschland (S.127-134). München,<br />
Kösel.<br />
î Schneider, K., Wüstenberg, W. (2001): Entwicklungspsychologische<br />
Forschungen und<br />
ihre Bedeutung für Peer-Kontakte im Kleinkindalter.<br />
In: von Schlippe, A., Lösche, G.,<br />
Hawellek, C., Frühkindliche Lebenswelten<br />
und Erziehungsberatung. Die Chancen des<br />
Anfangs (S. 67-78). Weinheim: juventa.<br />
î Suess, G.J. (2005): Sicherer Halt für den<br />
Aufbruch ins Leben. Neueste Erkenntnnisse<br />
der Bindungsforschung. kindergarten heute<br />
(11-12), S.6-12.<br />
î von Salisch, M. (1993): Kind-Kind-Beziehungen.<br />
Symmetrie und Asymmetrie unter<br />
Peers, Freunden und Geschwistern. In: Auhagen,<br />
A.E. von Salisch, M., Zwischenmenschliche<br />
Beziehungen (S.59-78). Göttingen:<br />
Hogrefe.<br />
Im Alter zwischen 3 und 5 Jahren werden die<br />
gleichaltrigen Spielkameraden immer wichtiger.<br />
Während bislang Erwachsene als Spielpartner bevorzugt<br />
wurden, sind es nun die gleichaltrigen<br />
Spielkameraden. Dank der nun vorhandenen<br />
Sprachfähigkeit ist eine echte Verständigung<br />
möglich. Die Kinder beginnen gemeinsam zu planen,<br />
zu organisieren, zu besprechen und zu entscheiden.<br />
Sie kommentieren Abläufe und<br />
beratschlagen und beratschlagen sich bei Misserfolgen.<br />
Die Kinder bilden Teams und lernen sich<br />
einzugliedern. Bald zeigen sich Spezialisten, die<br />
irgendetwas besonders gut können und deshalb<br />
II. Themen 79