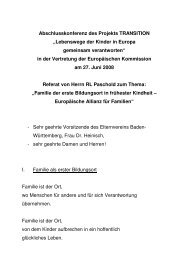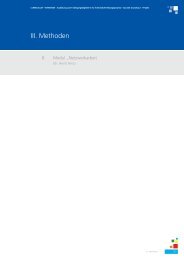Dokumentation Grundtvig 2
Dokumentation Grundtvig 2
Dokumentation Grundtvig 2
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
05-08-2008-II._Themen-3_Modul:<strong>Dokumentation</strong> <strong>Grundtvig</strong> 2 25.08.2008 16:41 Seite 75<br />
CURRICULUM - TRANSITION - Ausbildung zum/r Übergangsbegleiter/in für frühkindliche Bildungsprozesse - Socrates <strong>Grundtvig</strong> 1.1 Projekt<br />
II. Themen<br />
3. Modul „Entwicklungspsychologische Ansätze<br />
2.6 Das Emotionsverständnis von Kindern<br />
Im Alter von 8-12 Monaten beginnen Kinder zu<br />
zeigen, das sie emotionalen Gesichtsaudrücken<br />
und emotionalen Stimmungen Ereignisse in der<br />
Umwelt zuordnen können. Diese Fähigkeiten<br />
sind offenkundig beim so genannten sozialen Referenzieren<br />
der Kinder. Es ist die Verwendung mimischer,<br />
gestischer oder stimmlicher Hinweise<br />
der Eltern um zu entscheiden, wie mit neuen,<br />
mehrdeutigen oder potentiell bedrohlichen Situationen<br />
umzugehen ist. ( Rosicky and Didball<br />
2001 u.a.).<br />
Das Verständnis von Emotionen spielt bei Kindern<br />
eine wichtige Rolle in ihrem Leben. Obwohl<br />
Kleinkinder Unterschiede bei verschiedenen Emotionsausdrücken<br />
wie Freude oder Überraschung<br />
schon im Alter von 4-7 Monaten entdecken können,<br />
beginnen sie erst mit etwa 7 Monaten mit<br />
den Emotionen. Im Alter von 8-12 Monaten beginnen<br />
Kinder den emotionalen Gesichtsausdruck<br />
oder den emotionalen Ton der Stimme mit<br />
Aktionen in Verbindung zu bringen, was in ihrem<br />
Gebrauch des sozialen Referenzieren sichtbar<br />
wird. Im Alter von 3 Jahren zeigen Kinder elementare<br />
Fähigkeiten, Gesichtsausdrücke zu benennen<br />
und einfache Situationen zu verstehen,<br />
die Freude auslösen sollten.<br />
Wenn Kinder die Vor- und Grundschule durchlaufen<br />
wächst ihr Verständnis von Emotionen<br />
und Situationen, die Emotionen hervorrufen,<br />
hinsichtlich Ausmaß und Komplexität. Sie werden<br />
sich zunehmend darüber bewusst, dass die<br />
Emotionen, die Menschen zeigen , nicht ihre<br />
wahren Gefühle widerspiegeln müssen. Außerdem<br />
verstehen die Kinder mit zunehmendem<br />
Alter besser, dass sie und andere mehr als eine<br />
Emotion zur selben Zeit empfinden könne und<br />
dass verschiedene Emotionen miteinander interagieren<br />
und einander beeinflussen.<br />
3. Beziehung zu Gleichaltrigen und Sozialentwicklung<br />
3.1 Kindliche Sozialpartner<br />
Soziale Kompetenz ist gekennzeichnet durch die<br />
Fähigkeit mit anderen Kindern zurechtzukommen,<br />
sich mit ihnen zu verständigen, zu kooperieren,<br />
Konflikte zu bewältigen, von ihnen zu<br />
lernen und eigenes Wissen weiterzugeben. Mit<br />
dem Erwerb sozialer Kompetenz wird häufig begründet,<br />
warum Kinder in den Kindergarten<br />
gehen sollten. Soziale Kompetenz wird als eine<br />
für den Schulstart unerlässliche Grundvoraussetzung<br />
gesehen. Welche Bedeutung haben Peer-<br />
Kontakte in den ersten drei Lebensjahren für den<br />
Erwerb sozialer Kompetenz aber wirklich? Diesbezüglich<br />
differieren die Meinungen der Wissenschaftler:<br />
Schneider und Wüstenberg<br />
(1993,2001) beschreiben, dass Kinder schon in<br />
den ersten Lebensjahren andere Kinder brauchen.<br />
Sie sehen die Gleichaltrigengruppe als<br />
wichtiges Setting, das förderlich auf die Sozialentwicklung<br />
wirkt. Erwachsenen-Kind-<br />
Beziehungen wirken durch ihr asymmetrisches<br />
Kräfteverhältnis, bei dem immer der eine dominiert<br />
und kontrolliert eher erfahrungshemmend<br />
auf die kindliche Sozialentwicklung. Umso wichtiger<br />
erscheinen daher die symmetrisch-reziproken<br />
Beziehungen (d.h. Wechselseitig und auf<br />
gleichem Niveau) unter Gleichaltrigen. Nach Ahnert<br />
(2003) gibt es jedoch bislang noch keine<br />
Studie, die Entwicklungsdefizite oder -abweichungen<br />
aufgezeigt hätte, wenn diese Entwicklung<br />
erst im Vorschulalter einsetzt. Daher gilt die<br />
Frage, inwieweit die frühen Anfänge der Peer-Interaktion<br />
auf die Phänomene späterer Peer-Beziehungen<br />
hinführen, als noch weitgehend<br />
unbeantwortet.<br />
Anhand zahlreicher Beobachtungen läßt sich eindeutig<br />
feststellen, dass Kleinstkinder und auch<br />
Säuglinge bereits ein soziales Interesse an anderen<br />
Kindern zeigen und auf diese anders reagieren<br />
als auf Erwachsene. Von Anfang an sind sie<br />
aktiv an der Kommunikation beteiligt und benutzen<br />
dafür vorsprachliche Verständigungsformen<br />
wie Mimik, Gestik, Laute und Lächeln.<br />
Bereits mit einem halben Jahr sind sie in der Lage,<br />
ihre Kontaktversuche in Abstimmung mit der Reaktion<br />
des anderen Kindes zu steuern. Wollen<br />
Kinder beispielsweise ein anderes Kind berühren,<br />
so versuchen sie zunächst dessen Interesse zu<br />
wecken. In der Regel kommt es nur dann tatsächlich<br />
zu Berührung, wenn das Gegenüber auf<br />
diese Kontaktinitiative, auch mit Interesse reagiert<br />
(Schneider und Wüstenberg, 1993). Gegenstände<br />
werden bereits ab der zweiten Hälfte<br />
des ersten Lebensjahres benutzt, um in Kontakt<br />
zu treten. Die wichtigste Fähigkeit, um Kontakt<br />
herzustellen, ist die Imitationsfähigkeit. Im Alter<br />
von ein bis zwei Jahren dient sie als Mehrzweckstrategie,<br />
da sie sowohl die entscheidende Methode<br />
zur Initiierung und Aufrechterhaltung von<br />
II. Themen 75