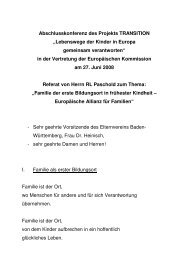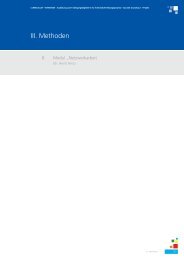Dokumentation Grundtvig 2
Dokumentation Grundtvig 2
Dokumentation Grundtvig 2
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
05-08-2008-II._Themen-3_Modul:<strong>Dokumentation</strong> <strong>Grundtvig</strong> 2 25.08.2008 16:41 Seite 63<br />
CURRICULUM - TRANSITION - Ausbildung zum/r Übergangsbegleiter/in für frühkindliche Bildungsprozesse - Socrates <strong>Grundtvig</strong> 1.1 Projekt<br />
II. Themen<br />
3. Modul „Entwicklungspsychologische Ansätze<br />
wicklungsbereichen zu erkennen, um entsprechende<br />
Unterstützungsmöglichkeiten zu erarbeiten.<br />
1. Bindung und Entwicklung des Selbst<br />
1.1 Bindung zwischen Kindern und ihren Bezugspersonen<br />
Der Begriff der Bindungsentwicklung ist verknüpft<br />
mit den Namen Bowlby, Rene Spitz, Ainsworth<br />
und anderen.<br />
Aus Untersuchungen in Waisenhäusern schloss<br />
man, dass Babys in Einrichtungen wie Waisenhäusern<br />
unabhängig von Hygiene und Güte der<br />
Leitung einem hohen Entwicklungsrisiko ausgesetzt<br />
sind. Es wurde festgestellt, dass frühe emotionale<br />
Bindungen zwischen Eltern und Kind die<br />
soziale und emotionale Entwicklung von Kindern<br />
beeinflussen kann.<br />
Frühe Beziehung der Kinder zu ihren Eltern beeinflusst<br />
die Art ihrer Interaktionen mit anderen<br />
Menschen vom Kleinkind bis zum Erwachsenenalter.<br />
Diese frühe Bindung beeinflusst das Selbstwertgefühl.<br />
Es ist somit Ausdruck dieser früh einsetzenden<br />
interaktionellen, aktiv gesteuerten<br />
Beziehung zwischen dem Kind der Bezugsperson,<br />
der entsprechenden Ausbildung des Bindungsverhaltens<br />
und Selbst.<br />
Es soll hier noch mal betont werden, dass wir diesen<br />
Prozess einen hochaktiven Prozess von beiden<br />
Seiten betrachten, sowohl von der<br />
Bezugsperson als auch von dem Kind in schon<br />
sehr frühem Alter.<br />
Bindungsprozess scheint eine biologische Grundlage<br />
zu haben, entwickelt sich aber in Abhängigkeit<br />
vom familiären und kulturellen Kontext<br />
unterschiedlich.<br />
Also bewegt sich der Bindungsprozess im Spannungsfeld<br />
„Anlage und Umwelt“ sowie im soziokulturellen<br />
Kontext.<br />
So ist die Bindung zu den Eltern von unterschiedlicher<br />
Qualität und zeigt hohe individuelle<br />
Unterschiede in der sozialen und emotionalen<br />
Entwicklung des einzelnen Kindes.<br />
Harlow und Mitarbeiter (1965) zeigen bei isoliert<br />
aufgewachsenen Rhesusaffen mit 6 Monaten<br />
schwere soziale Störungen (zwanghaftes Beißen,<br />
hin und her werfen, unfähig zu sein mit anderen<br />
zu kommunizieren u. a.).<br />
Die Ergebnisse der Beobachtung von Kindern<br />
und Affen erwiesen sich so eindrücklich, dass<br />
Psychologen und Psychiater sich gezwungen<br />
sahen, ihre Vorstellung von der frühen Entwicklung<br />
zu überdenken.<br />
So entwickelte Bowlby die so genannten Bindungstheorien<br />
(Bowlby 1969)<br />
Nach Bowlby ist Bindung ein biologisch basierter<br />
Prozess, dessen Wurzeln in der Evolution liegen<br />
und die die Überlebenschancen des hilflosen kleinen<br />
Kindes erhöht. Die engste Bezugsperson ist<br />
„die sichere Basis“ von der aus das sicher gebundene<br />
Kind seine Umwelt erforschen kann<br />
und sich Wissen und Kompetenzen erwirbt.<br />
Bowlby unterscheidet hier in der anfänglichen<br />
Entwicklung von Bindung 4 Phasen:<br />
î 1. Vorphase der Bindung<br />
(Geburt bis 6 Wochen)<br />
î 2. Entstehende Bindung<br />
(6 Wochen bis 8 Monate)<br />
î 3. Ausgeprägte Bindung<br />
(6 Monate bis 2 Jahre)<br />
î 4. Reziproke Beziehungen<br />
von 1 ½ - 2 Jahren an.<br />
Das Kind entwickelt so ein so genanntes inneres<br />
Arbeitsmodell der Bindung, nämlich die kindliche<br />
mentale Repräsentation des Selbst, der Bindungsperson<br />
und der Beziehungen im<br />
Allgemeinen, die als Ergebnis der Erfahrungen<br />
mit den Betreuungspersonen entstehen.<br />
Das Arbeitsmodell leitet die Interaktionen der<br />
Kinder mit den Versorgern und anderen Personen<br />
in der Kindheit und im späteren Alter.<br />
Mary Ainsworth, die mit Bowlby seit 1950 zusammengearbeitet<br />
hat, lieferte die empirische<br />
Evidenz für die Bowlby’sche Theorie und erweiterte<br />
sie in entscheidender Hinsicht.<br />
(Ainsworth 1967).<br />
Um die Qualität der kindlichen Bindung an ihre<br />
primäre Bezugsperson zu prüfen, wurde die so<br />
genannte „fremde Situation“ von Ainsworth experimentell<br />
angegeben. Die Kinder werden typischerweise<br />
nach.<br />
II. Themen 63