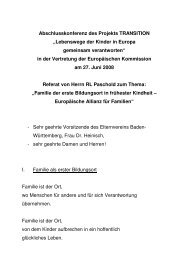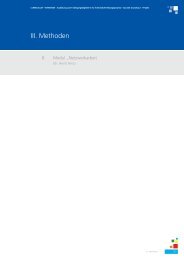Dokumentation Grundtvig 2
Dokumentation Grundtvig 2
Dokumentation Grundtvig 2
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
05-08-2008-II._Themen-3_Modul:<strong>Dokumentation</strong> <strong>Grundtvig</strong> 2 25.08.2008 16:41 Seite 77<br />
CURRICULUM - TRANSITION - Ausbildung zum/r Übergangsbegleiter/in für frühkindliche Bildungsprozesse - Socrates <strong>Grundtvig</strong> 1.1 Projekt<br />
II. Themen<br />
3. Modul „Entwicklungspsychologische Ansätze<br />
3.3 Status in der Peergruppe<br />
Ältere Kinder und Jugendliche machen sich häufig<br />
sehr viele Gedanken über ihren Status bei den<br />
Gleichaltrigen: Beliebt zu sein ist von größter<br />
Wichtigkeit, und die Zurückweisung durch die<br />
Peers kann drastische Folgen haben, die sich vor<br />
allem auf Entwicklungsebene zeigen. Beispielsweise<br />
anhand eines Schulabbruchs oder problematischen<br />
Verhaltens (Gest, Graham – Bermann<br />
& Hartup, 2001).<br />
Für die Beliebtheit spielt offensichtlich die körperliche<br />
Attraktivität eine große Rolle. Attraktive<br />
Kinder sind mit größerer Wahrscheinlichkeit beliebt<br />
als unattraktive Kinder (Langlois et al.2000).<br />
Dieses Muster entsteht bereits in der frühen<br />
Kindheit und wird in der Adoleszenz besonders<br />
offensichtlich. Nach Hanna (1989) kann körperliche<br />
Attraktivität im Jugendalter wichtiger sein<br />
als Geselligkeit, wenn es darum geht bei den<br />
Peers Anerkennung zu finden und positive<br />
Freundschaften zu entwickeln. Darüber hinaus<br />
tragen sportliche Fähigkeiten, besonders bei Jungen,<br />
zum Peer-Status bei. Sportler werden von<br />
den Peers meist als beliebt eingeschätzt (Rodkin<br />
et al., 2000). Weiterhin hängt der Peer-Status mit<br />
dem Status der eigenen Freunde zusammen: beliebte<br />
Freunde zu haben wirkt sich positiv auf die<br />
eigene Beliebtheit aus (Eder, 1985). Das Sozialverhalten<br />
des Kindes, seine Persönlichkeit, die<br />
Kognitionen über sich und anderer sowie die<br />
Ziele bei Interaktion in Peers sind weitere Faktoren,<br />
die den soziometrischen Status beeinflussen.<br />
Beliebte Kinder besitzen zahlreiche soziale Fähigkeiten,<br />
die dazu beitragen, dass sie gemocht werden.<br />
Beispielsweise sind sie in der Lage<br />
Interaktionen mit Peers zu beginnen und positive<br />
Beziehungen zu anderen aufrecht zu erhalten<br />
(Rubin et al., 1989). Stoßen beliebte Kinder zu<br />
einer Gruppe von Kindern hinzu, versuchen sie<br />
zuerst abzuschätzen, was in der Gruppe gerade<br />
los ist, um sich dann der Gruppe anzuschließen.<br />
Sie sprechen über das selbe Thema oder beteiligen<br />
sich an der selben Aktivität wie die Gruppe<br />
und werden somit selten unangebrachte Aufmerksamkeit<br />
auf sich ziehen, wenn sie einer<br />
Gruppe beitreten (Putallaz, 1983; Dodge et al.<br />
1983). Beliebte Kinder sind meistens kooperativ,<br />
freundlich und verständnisvoll gegenüber anderen<br />
und werden so auch von Lehrern und Peers<br />
wahrgenommen (Dodge et al. 1997; Rubin et al.<br />
1998). Darüber hinaus neigen sie nicht zu starken<br />
negativen Gefühlen und können sich gut<br />
selbst regulieren (Eisenberg et al. 1993).<br />
Mit Blick auf Aggressivität, die der Durchsetzungsfähigkeit<br />
dient (hierzu zählt auch Schubsen<br />
und Kämpfen) unterscheiden sich beliebte Kinder<br />
meist nicht von durchschnittlichen Kindern<br />
(Newcomb et al., 1993).<br />
Abgelehnte Kinder können in zwei Kategorien<br />
eingeteilt werden: den übermäßig aggressiven<br />
oder den verschlossenen Kindern.<br />
Aggressiv abgelehnte Kinder: 40-50% der abgelehnten<br />
Kinder sind häufig aggressiv. Hierbei<br />
überwiegt feindliches, drohendes, störendes und<br />
kriminelles Verhalten sowie körperliche Aggression<br />
(Hinshaw et al., 1997; Newcomb et al.,<br />
1993). Viele abgelehnte Kinder betreiben Beziehungsaggression<br />
wenn sie wütend sind oder<br />
ihren Willen durchsetzten wollen. Das bedeutet,<br />
dass sie Gerüchte über Peers verbreiten, Freundschaft<br />
vorenthalten, um Verletzungen zuzufügen<br />
oder andere Kinder ignorieren und ausschließen<br />
( Crick et al., 1997). Es kann nicht mit Sicherheit<br />
angegeben werden, ob Aggression die Ablehnung<br />
der Peers verursacht oder von ihr verursacht<br />
wird. Einige Forschungsergebnisse sprechen jedoch<br />
dafür, dass der Zurückweisung durch die<br />
Peers häufig aggressives Verhalten zugrunde<br />
liegt. Bei der Beobachtung von Peers, die sich gerade<br />
kennen lernen, zeigte sich, dass die aggressiven<br />
Kinder mit der Zeit abgelehnt werden (Coie<br />
& Kupersmidt, 1983). In Langzeitstudien konnte<br />
gezeigt werden, dass aggressive, negative und<br />
störende Kinder von ihren Peers im Verlauf eines<br />
Schuljahres zunehmend abgelehnt werden ( Little<br />
& Garber, 1995; Maszk et al., 1999).<br />
Verschlossen-abgelehnte Kinder<br />
10 bis 20 % der abgelehnten Kinder gehören in<br />
die Gruppe der verschlossen-abgelehnten Kinder.<br />
Kennzeichen dieser Gruppe sind soziale Zurückgezogenheit,<br />
Argwohn, Schüchternheit und<br />
Ängstlichkeit (Cillessen et al., 1992; Rubin et al.,<br />
1998). Viele dieser Kinder fühlen sich isoliert und<br />
einsam. Dennoch zeigen Forschungsergebnisse,<br />
dass nicht alle sozial verschlossenen Kinder abgelehnt<br />
werden. Vielmehr ist es die Kombination<br />
aus verschlossenem Verhalten mit negativen<br />
II. Themen 77