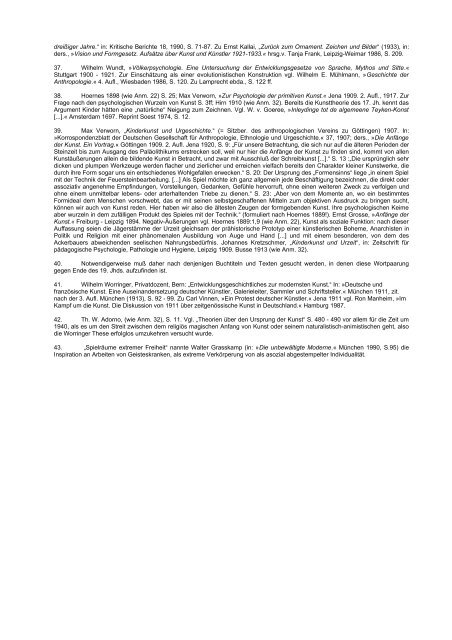Ursprung und Ursprünglichkeit - Walter Peter Gerlach ...
Ursprung und Ursprünglichkeit - Walter Peter Gerlach ...
Ursprung und Ursprünglichkeit - Walter Peter Gerlach ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
dreißiger Jahre.“ in: Kritische Berichte 18, 1990, S. 71-87. Zu Ernst Kallai, „Zurück zum Ornament. Zeichen <strong>und</strong> Bilder“ (1933), in:<br />
ders., »Vision <strong>und</strong> Formgesetz. Aufsätze über Kunst <strong>und</strong> Künstler 1921-1933.« hrsg.v. Tanja Frank, Leipzig-Weimar 1986, S. 209.<br />
37. Wilhelm W<strong>und</strong>t, »Völkerpsychologie. Eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze von Sprache, Mythos <strong>und</strong> Sitte.«<br />
Stuttgart 1900 - 1921. Zur Einschätzung als einer evolutionistischen Konstruktion vgl. Wilhelm E. Mühlmann, »Geschichte der<br />
Anthropologie.« 4. Aufl., Wiesbaden 1986, S. 120. Zu Lamprecht ebda., S. 122 ff.<br />
38. Hoernes 1898 (wie Anm. 22) S. 25; Max Verworn, »Zur Psychologie der primitiven Kunst.« Jena 1909. 2. Aufl., 1917. Zur<br />
Frage nach den psychologischen Wurzeln von Kunst S. 3ff; Hirn 1910 (wie Anm. 32). Bereits die Kunsttheorie des 17. Jh. kennt das<br />
Argument Kinder hätten eine „natürliche“ Neigung zum Zeichnen. Vgl. W. v. Goeree, »Inleydinge tot de algemeene Teyken-Konst<br />
[...].« Amsterdam 1697. Reprint Soest 1974, S. 12.<br />
39. Max Verworn, „Kinderkunst <strong>und</strong> Urgeschichte.“ (= Sitzber. des anthropologischen Vereins zu Göttingen) 1907. In:<br />
»Korrospondenzblatt der Deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie <strong>und</strong> Urgeschichte.« 37, 1907; ders., »Die Anfänge<br />
der Kunst. Ein Vortrag.« Göttingen 1909. 2. Aufl. Jena 1920, S. 9: „Für unsere Betrachtung, die sich nur auf die älteren Perioden der<br />
Steinzeit bis zum Ausgang des Paläolithikums erstrecken soll, weil nur hier die Anfänge der Kunst zu finden sind, kommt von allen<br />
Kunstäußerungen allein die bildende Kunst in Betracht, <strong>und</strong> zwar mit Ausschluß der Schreibkunst [...].“ S. 13 :„Die ursprünglich sehr<br />
dicken <strong>und</strong> plumpen Werkzeuge werden flacher <strong>und</strong> zierlicher <strong>und</strong> erreichen vielfach bereits den Charakter kleiner Kunstwerke, die<br />
durch ihre Form sogar uns ein entschiedenes Wohlgefallen erwecken.“ S. 20: Der <strong>Ursprung</strong> des „Formensinns“ liege „in einem Spiel<br />
mit der Technik der Feuersteinbearbeitung. [...] Als Spiel möchte ich ganz allgemein jede Beschäftigung bezeichnen, die direkt oder<br />
assoziativ angenehme Empfindungen, Vorstellungen, Gedanken, Gefühle hervorruft, ohne einen weiteren Zweck zu verfolgen <strong>und</strong><br />
ohne einem unmittelbar lebens- oder arterhaltenden Triebe zu dienen.“ S. 23: „Aber von dem Momente an, wo ein bestimmtes<br />
Formideal dem Menschen vorschwebt, das er mit seinen selbstgeschaffenen Mitteln zum objektiven Ausdruck zu bringen sucht,<br />
können wir auch von Kunst reden. Hier haben wir also die ältesten Zeugen der formgebenden Kunst. Ihre psychologischen Keime<br />
aber wurzeln in dem zufälligen Produkt des Spieles mit der Technik.“ (formuliert nach Hoernes 1889!). Ernst Grosse, »Anfänge der<br />
Kunst.« Freiburg - Leipzig 1894. Negativ-Äußerungen vgl. Hoernes 1889:1,9 (wie Anm. 22), Kunst als soziale Funktion: nach dieser<br />
Auffassung seien die Jägerstämme der Urzeit gleichsam der prähistorische Prototyp einer künstlerischen Boheme, Anarchisten in<br />
Politik <strong>und</strong> Religion mit einer phänomenalen Ausbildung von Auge <strong>und</strong> Hand [...] <strong>und</strong> mit einem besonderen, von dem des<br />
Ackerbauers abweichenden seelischen Nahrungsbedürfnis. Johannes Kretzschmer, „Kinderkunst <strong>und</strong> Urzeit“, in: Zeitschrift für<br />
pädagogische Psychologie, Pathologie <strong>und</strong> Hygiene, Leipzig 1909. Busse 1913 (wie Anm. 32).<br />
40. Notwendigerweise muß daher nach denjenigen Buchtiteln <strong>und</strong> Texten gesucht werden, in denen diese Wortpaarung<br />
gegen Ende des 19. Jhds. aufzufinden ist.<br />
41. Wilhelm Worringer, Privatdozent, Bern: „Entwicklungsgeschichtliches zur modernsten Kunst.“ In: »Deutsche <strong>und</strong><br />
französische Kunst. Eine Auseinandersetzung deutscher Künstler, Galerieleiter, Sammler <strong>und</strong> Schriftsteller.« München 1911, zit.<br />
nach der 3. Aufl. München (1913), S. 92 - 99. Zu Carl Vinnen, »Ein Protest deutscher Künstler.« Jena 1911 vgl. Ron Manheim, »Im<br />
Kampf um die Kunst. Die Diskussion von 1911 über zeitgenössische Kunst in Deutschland.« Hamburg 1987.<br />
42. Th. W. Adorno, (wie Anm. 32), S. 11. Vgl. „Theorien über den <strong>Ursprung</strong> der Kunst“ S. 480 - 490 vor allem für die Zeit um<br />
1940, als es um den Streit zwischen dem religiös magischen Anfang von Kunst oder seinem naturalistisch-animistischen geht, also<br />
die Worringer These erfolglos umzukehren versucht wurde.<br />
43. „Spielräume extremer Freiheit“ nannte <strong>Walter</strong> Grasskamp (in: »Die unbewältigte Moderne.« München 1990, S.95) die<br />
Inspiration an Arbeiten von Geisteskranken, als extreme Verkörperung von als asozial abgestempelter Individualität.