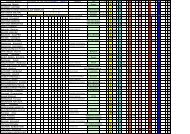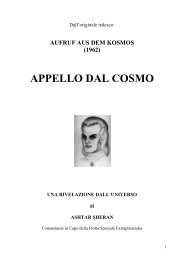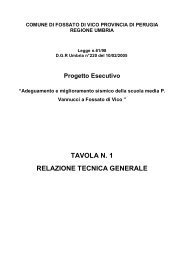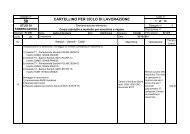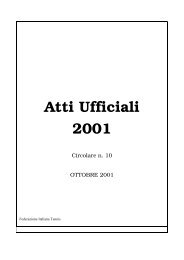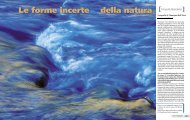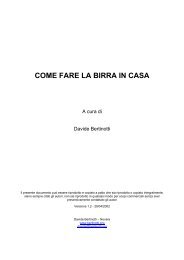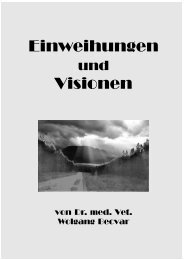Le Monastere Beselich bei Schupbach
Le Monastere Beselich bei Schupbach
Le Monastere Beselich bei Schupbach
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
mit Ausnahme der Junffrawen gewainheit - nur auf <strong>Le</strong>benszeit gehören. Das Kloster <strong>Beselich</strong> soll die<br />
Schuld der verstorbenen Magisterin, 24 florin und 5 engl., bezahlen. Was man jener noch schuldig ist, soll<br />
es einfordern und allein behalten. Der Convent soll jenen Nonnen <strong>bei</strong> ihrer Gülte, falls nötig, behülflich<br />
sein. Siegel der vier Schiedsmänner.<br />
- ad 1403, ipso die beati gereonis et sociorum eius.<br />
14. November 1404<br />
Lyse von Alpenroth, Magisterin, Priorin und der Convent zu <strong>Beselich</strong> verschreiben dem Abt Johann von<br />
Arnstein und dessen Convent für die Gülte, die sie ihnen jährlich zwischen dem 15. August und dem 08.<br />
September laut der Urkunde, die diese von ihnen besitzen, zu geben haben, alle ihre Güter in der<br />
Oberlahnsteiner und Niederlahnsteiner Gemarkung zu Unterpfand. Bei <strong>Le</strong>istungsversäumnis können diese<br />
sich daran halten, als ob sie es 3 Tage und 6 Wochen ausgeklagt hätten.. Geben sie dann die Gülte<br />
binnen Jahresfrist, so sollen sie jedoch die Unterpfänder zurückerhalten. Es siegeln die Aussteller mit<br />
ihren Conventssiegel und die Schultheißen und Schöffen von Obern- und Unternloinstein mit ihren<br />
Schöffensiegelungen. ad ipso die beati Clementissimi martiris 1404.<br />
Während der sogenannten Hussitenkriege bzw. Steinhauskriege wurde die alte Holzkirche "Zum Heiligen Kreuz" zwischen 1429 und<br />
1433 zerstört, jedoch durch den ersten <strong>Le</strong>hensherrn, einen Laminger von Alpenroth bzw. Almenroth - ab 1454 - in seiner<br />
Eigenschaft als Patronatsherr durch die fron- und robotpflichtigen Bauern neu und größer aus Bruchsteinen mit Schindeldach<br />
aufgebaut, desgleichen der Pfarrhof.<br />
Die Kirche erlebte unter den ersten fünf Lamingern, zwischen den Jahren 1454 und 1600, verschiedene Erneuerungen und war von<br />
1570 bis 1629 evangelische Pfarrkirche. Vom letzten Pastor, Jacob Saumars, ist noch eine Traumatrikel erhalten. Seine Tochter<br />
Christine heiratete 1647 den Johann Mirz aus Hasselbach.<br />
Die Kirche wurde im Dreißigjährigen Krieg erneut hart mitgenommen, jedoch 1630 wieder aufgebaut, mit Zwiebelturm und Laterne<br />
versehen und stieg unter Wolf Wilhelm Laminger zu einer Wallfahrtskirche und wundertätigen Stätte des heiligen Kreuzes auf. Die<br />
Wallfahrt wurde 1791 verboten.<br />
Am 10. Oktober 1859 wurde die Kirche abgebaut. Es wurden mitgenommen: das Dach samt Zwiebelturm, das große Altarbild, fünf<br />
Kreuzwegstationen u. a. Bilder, die Kanzel, die zwei Seitenaltäre, deren Bilder der zwei Seitenaltäre, weiter die Bänke, der Chor<br />
samt Orgel und die drei Glocken im Gewicht von 14 Zentnern. Ab dem Jahr 1860 erfolgten am neuen und umgesiedelten Ort, der<br />
nun Albenreuth genannt wird, die Wiederaufbauar<strong>bei</strong>ten.<br />
Am 4. April 1878 wurden die <strong>bei</strong>den Kastanienbäume links und rechts von der Vorhauspforte gepflanzt. Unter Pfarrer Adolf Rudy<br />
wurde um 1930 die Kirche innen ganz renoviert und eine neue Orgel angeschafft.<br />
Wie schon erwähnt, ist die Geschichte der Kirche eng verbunden mit den Adelsgeschlechtern der Herrschaft, die als<br />
Patronatsherren stets sehr viel für die Kirche getan haben. Ihre Familienangehörigen wurden durch Jahrhunderte in der Gruft unter<br />
dem Kirchenschiff <strong>bei</strong>gesetzt.<br />
Bis zum Jahre 1318 standen nach Pöhnl die 13 Praumenberger Gotenaltdörfer unter königlichen Burggraven ungeschmälert in ihren<br />
Rechten. In diesem Jahr aber wurden sie samt dem Krongut Praumenberg von König Johann von Luremburg verpfändet, und sie<br />
gelangten bis 1454, also 136 Jahre lang, die mit Unruhen, Räuberunwesen und Bedrückung erfüllt waren, von einer Hand in die<br />
andere.<br />
So erschien im Jahr 1454 auch in Heiligenkreuz ein erster <strong>Le</strong>hensherr, ein Laminger oder Malinger von Alpenroth, der wertvollen<br />
Gutsbesitz schuf und dadurch große Verdienste erwarb. Er setzte sich am westlichen Ende der kleinen Seite des Dorfes fest und<br />
errichtete ein befestigtes Herrenhaus. Sein Geschlecht zahlte an die Cyganberger Geld- und Getreidezins und besaß über die<br />
nunmehr untergebenen Bauern die niedrige Gerichtsbarkeit und Strafgewalt.<br />
Die Stammveste der nochmaligen Freiherrn und Graven zwischen ad 1600 und 1678 Laminger von Alpenroth lag östlich des<br />
Klosters Waldhausen. Die ältesten leserlichen Grabsteine der Laminger in die sich heute in der Pfarrkirche Albenreuth befinden,<br />
beginnen ad 1530, doch sind noch abgetretene ältere vorhanden. Durch 224 Jahre, also zwischen 1454 und 1678 verwalteten acht<br />
Generationen der Laminger Heiligenkreuz. Sie errichteten den Dorfteich und die Mühle darunter und konnten 1596 aus des Königs<br />
Hand das inzwischen erstandene stolze Schlößchen käuflich erwerben.<br />
Am 30. Juli 1596 wurde das alte königliche Kammergut Praumenberg aufgelöst, und die Laminger wurden unter Wolf Joachim<br />
durch käuflichen Erwerb des gesamten <strong>Le</strong>bens Heiligenkreuz, für 1062 Thaler erbliche Eigentümer.<br />
Bald aber wurde Wolf Joachim Laminger aus dem Lande verjagt und sein Besitz beschlagnahmt, da schon unter seinen<br />
Vorgängern die Untertanen zum evangelischen Glauben gezwungen wurden.<br />
In der schon vorgenannten Pfarrchronik von Mengerskirchen Band 1 aus dem Jahr 1630, steht geschrieben: "1413, Auf Michaeli<br />
versetzte Johann von Beilstein an Philipp von Nassau-Weilburg die Stadt Mengerskirchen, die Calenberger Cente, mit den Dörfern<br />
Alborn, Enterod, Odersperch, Fryssendorf, Coedingen, Oberolshausen, Helmenrode, Alpenrode oder Almenode, die zwey<br />
Braychbache, Winkelsesche und Dillhuzen". Da<strong>bei</strong> hat Alborn bzw. Alte Born scheinbar recht wenig mit dem heutigen Arborn zu<br />
tun, das damals noch Arbude oder Mont Tabur genannt wurde.<br />
Almenrod bzw. Alpenroth ist heute ebenso eine Wüstung in der Calenberger Cente und ein Flurname in der Löhnerberger Feldflur,<br />
wie auch Eppstein <strong>bei</strong> Obershausen. In meinen Annalen fand ich eine Familie die noch in <strong>bei</strong>den Orten geboren wurde und<br />
geheiratet hat. Es waren Follenius, Heinrich Wilhelm, geboren im Jahr 1636 in Almenrod, er starb am 06. Oktober 1680 in Echzell.<br />
Sein Geheimcode war: UID: 24AD0B9B8126D81186460050BAA3673B2217. Er heiratete am 05. September 1659 in Eppstein die<br />
Elisabeth Helffmann. Ihre gemeinsamen Kinder waren: Follenius, Anna Maria Sybille und ein Johann Justus; Johann Nikolaus;<br />
Volpert Wilhelm; Susanna Christina; Elisabeth Philippina; Johanetta Sophia; Anna Juliana und Dorothea Magdalena.<br />
1.) Anna Maria Sybille Follenius, geboren am 24. September 1662 in Eppstein zwischen Dillhausen und Obershausen und<br />
gestorben am 10. Januar 1715 in Darmstadt. Ihre Code-Nr. war : UID: 8353C0401528D81186460050BAA3673B170E. Sie wurde<br />
unioniert bzw. zwangsverheiratet mit Philipp Bindewald, außer seiner Code-Nr.: UID:<br />
9153C0401528D81186460050BAA3673B25EE gibt es keine weiteren Angaben.<br />
Manfred Fay – Kloster <strong>Beselich</strong> - © 0611 – Dillenburg<br />
36<br />
3