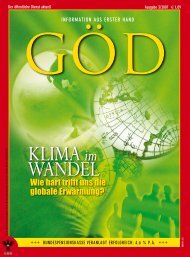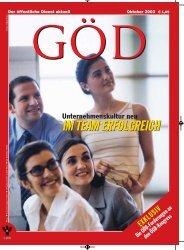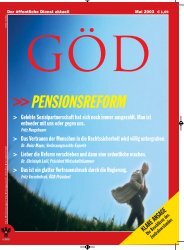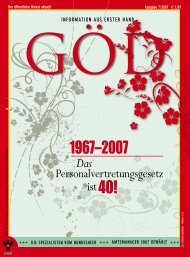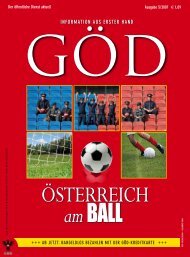Ausgabe 1/2012 - Gewerkschaft Öffentlicher Dienst
Ausgabe 1/2012 - Gewerkschaft Öffentlicher Dienst
Ausgabe 1/2012 - Gewerkschaft Öffentlicher Dienst
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
gesundheit<br />
22<br />
Soll heißen: In der Praxis könnte es künftig tatsächlich häufiger<br />
Komplikationen geben. Immer weniger Geld, immer<br />
weniger Personal stehen immer mehr überarbeiteten Ärzten<br />
gegenüber. Das höhere Risiko eines Behandlungsfehlers<br />
gibt’s dann gratis dazu. Fehldiagnosen, übermüdete Ärzte,<br />
mysteriöse Todesfälle – Gesundheitsrisiko Krankenhaus?<br />
Und die Patienten als große Verlierer? Vor so einem Szenario<br />
warnt Richard Kdolsky nachdrücklich. Als erfahrener Unfallmediziner<br />
arbeitet er seit mehr als 20 Jahren an vorderster<br />
Front. Er weiß, was sich in den Notaufnahmen Tag und Nacht<br />
abspielt. Durchgehende Schichten von bis zu 49 Stunden<br />
und Wochenarbeitszeiten von bis zu 72 Stunden sind auch<br />
heute keine Seltenheit. „Wir befinden uns in etwa dort, wo<br />
wir Ende des 19. Jahrhunderts bei den gewerkschaftlichen<br />
Forderungen gestanden sind. Wir sind also weit entfernt von<br />
einer 50-, 45- oder 40-Stunden-Woche.“<br />
WIE GEHABT<br />
Dabei ist das Problem historisch gewachsen und eigentlich<br />
auch hausgemacht. Das Arbeitszeitmodell im AKH basiert<br />
auf Verhandlungen aus den 1970er Jahren. Damals ging man<br />
von einer Ruhezeit von sechs Stunden bei Nacht- bzw. Bereitschaftsdiensten<br />
aus. Dementsprechend schlecht wird diese<br />
Zeit bezahlt. Bloß, dass sich die Situation in den letzten 30<br />
Jahren erheblich verändert hat. Diese sechs Stunden sind in<br />
den meisten Fächern eine völlige Illusion. Eigentlich ist das<br />
schon lange kein Bereitschaftsdienst mehr. „Ich würde meinen,<br />
dass gerade mal 20 Prozent der <strong>Dienst</strong>räder hier im Haus<br />
noch diesen Kriterien entsprechen. Die restlichen 80 Prozent<br />
sind de facto längst Dauerdienst.“<br />
Obendrein hat eine Studie ergeben, dass ein Arzt nach 24<br />
Stunden im Schichtdienst in einer ähnlichen Verfassung sei,<br />
wie wenn er 1,0 Promille im Blut hätte. Kdolsky erinnert sich,<br />
dass er als junger Arzt selbst nicht selten eine 100-Stunden-<br />
Woche absolviert hat. Auch wenn solche Extreme heute nicht<br />
mehr der Fall sind, die immense Arbeitsbelastung zehrt dennoch<br />
an den Kräften der Akademiker. Und „sozialfreundlich“<br />
ist das freilich auch nicht. „Da gehen Beziehungen drauf,<br />
da kommt es zu sozialer Vereinsamung. Und irgendwann<br />
kommt dann der Rückzug mit dem Satz: Ich will nicht mehr“,<br />
a. o. Univ.-Prof. Dr. Richard Kdolsky,<br />
Vorsitzender der Bundesvertretung<br />
Universitätsgewerkschaft für wissenschaftliches<br />
und künstlerisches<br />
Personal in der GÖD.<br />
so Kdolsky. Er hat im Laufe seiner Karriere viele Kollegen<br />
gesehen, die „das Hangerl geschmissen“ und sich aus dieser<br />
Spirale ausgeklinkt haben. Und das ist nicht das Einzige, das<br />
dem Spitzenmediziner bitter aufstößt.<br />
AUSGEHUNGERT<br />
Auch der wissenschaftliche Betrieb wird zusehends ein<br />
Opfer der verworrenen österreichischen Gesundheitspolitik.<br />
„Generell zieht sich die Misere ja nicht erst seit einem Jahr. Im<br />
Grunde laufen die Dinge seit 20 Jahren nicht gut und seit zehn<br />
Jahren überhaupt aus dem Ruder“, bringt es Richard Kdolsky<br />
ohne Umschweife auf den Punkt. Seiner Einschätzung<br />
nach hungere der Bund die Universitäten kontinuierlich aus.<br />
Begonnen hätte es damit, dass die sogenannte Universitätsmilliarde<br />
eigentlich nichts anderes als die Inflationsabgeltung<br />
der letzten zehn Jahren gewesen sei. Kdolsky: „Damit sind wir<br />
de facto auf dem Status des Jahres 2002 gewesen.“ Ähnlich<br />
grotesk ist die Situation jetzt. Zwar wurde mittlerweile eine<br />
„Überbrückungshilfe“ in der Höhe von neun Millionen Euro<br />
in Aussicht gestellt, um die Finanzierung der Journaldienste<br />
bis zum Sommer 2013 sicherzustellen, die Sache hat dennoch<br />
einen Haken. Die Medizinische Universität Wien erhält<br />
die Finanzmittel nämlich als Vorgriff auf das Budget 2013,<br />
dessen Dimensionen man noch nicht kennt. Und sie ist neuerlich<br />
bloß die Abgeltung der Inflation, die ohnehin längst<br />
fällig gewesen wäre. Wurde das Problem damit lediglich vertagt?<br />
„Ja. Das kann man durchaus so sagen. Ich bin gespannt,<br />
wie das weitergeht“, sagt Kdolsky und meint das durchaus in<br />
einem weiteren Sinn. Denn wie schon angesprochen, liegt<br />
auch der wissenschaftliche Forschungsbereich zusehends im<br />
Argen. Den Ärzten geht es längst nicht mehr um die prekäre<br />
Versorgungssituation alleine. Auch die Forschungstätigkeit<br />
geht aufgrund der dauerhaften Finanzlage langsam, aber<br />
sicher den Bach runter. „Je mehr Leute im Haus überlastet<br />
sind, umso mehr wird die Forschung in die Freizeit verlegt,<br />
was ohnehin schon gang und gäbe ist. Aber, wenn die Leute<br />
so müde aus dem Spital gehen, dass sie wirklich nur noch<br />
schlafen gehen, dann ist selbst das nicht mehr möglich. Und<br />
dann wird es wirklich heikel“, sagt Kdolsky – auch mit Blick<br />
auf die nächsten Generationen an guten Ärzten, die – und