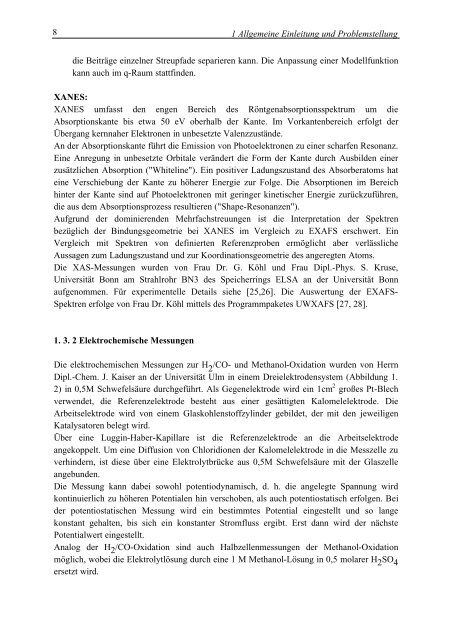Thesis - RWTH Aachen University
Thesis - RWTH Aachen University
Thesis - RWTH Aachen University
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
8<br />
1 Allgemeine Einleitung und Problemstellung<br />
die Beiträge einzelner Streupfade separieren kann. Die Anpassung einer Modellfunktion<br />
kann auch im q-Raum stattfinden.<br />
XANES:<br />
XANES umfasst den engen Bereich des Röntgenabsorptionsspektrum um die<br />
Absorptionskante bis etwa 50 eV oberhalb der Kante. Im Vorkantenbereich erfolgt der<br />
Übergang kernnaher Elektronen in unbesetzte Valenzzustände.<br />
An der Absorptionskante führt die Emission von Photoelektronen zu einer scharfen Resonanz.<br />
Eine Anregung in unbesetzte Orbitale verändert die Form der Kante durch Ausbilden einer<br />
zusätzlichen Absorption ("Whiteline"). Ein positiver Ladungszustand des Absorberatoms hat<br />
eine Verschiebung der Kante zu höherer Energie zur Folge. Die Absorptionen im Bereich<br />
hinter der Kante sind auf Photoelektronen mit geringer kinetischer Energie zurückzuführen,<br />
die aus dem Absorptionsprozess resultieren ("Shape-Resonanzen").<br />
Aufgrund der dominierenden Mehrfachstreuungen ist die Interpretation der Spektren<br />
bezüglich der Bindungsgeometrie bei XANES im Vergleich zu EXAFS erschwert. Ein<br />
Vergleich mit Spektren von definierten Referenzproben ermöglicht aber verlässliche<br />
Aussagen zum Ladungszustand und zur Koordinationsgeometrie des angeregten Atoms.<br />
Die XAS-Messungen wurden von Frau Dr. G. Köhl und Frau Dipl.-Phys. S. Kruse,<br />
Universität Bonn am Strahlrohr BN3 des Speicherrings ELSA an der Universität Bonn<br />
aufgenommen. Für experimentelle Details siehe [25,26]. Die Auswertung der EXAFS-<br />
Spektren erfolge von Frau Dr. Köhl mittels des Programmpaketes UWXAFS [27, 28].<br />
1. 3. 2 Elektrochemische Messungen<br />
Die elektrochemischen Messungen zur H 2 /CO- und Methanol-Oxidation wurden von Herrn<br />
Dipl.-Chem. J. Kaiser an der Universität Ulm in einem Dreielektrodensystem (Abbildung 1.<br />
2) in 0,5M Schwefelsäure durchgeführt. Als Gegenelektrode wird ein 1cm 2 großes Pt-Blech<br />
verwendet, die Referenzelektrode besteht aus einer gesättigten Kalomelelektrode. Die<br />
Arbeitselektrode wird von einem Glaskohlenstoffzylinder gebildet, der mit den jeweiligen<br />
Katalysatoren belegt wird.<br />
Über eine Luggin-Haber-Kapillare ist die Referenzelektrode an die Arbeitselektrode<br />
angekoppelt. Um eine Diffusion von Chloridionen der Kalomelelektrode in die Messzelle zu<br />
verhindern, ist diese über eine Elektrolytbrücke aus 0,5M Schwefelsäure mit der Glaszelle<br />
angebunden.<br />
Die Messung kann dabei sowohl potentiodynamisch, d. h. die angelegte Spannung wird<br />
kontinuierlich zu höheren Potentialen hin verschoben, als auch potentiostatisch erfolgen. Bei<br />
der potentiostatischen Messung wird ein bestimmtes Potential eingestellt und so lange<br />
konstant gehalten, bis sich ein konstanter Stromfluss ergibt. Erst dann wird der nächste<br />
Potentialwert eingestellt.<br />
Analog der H 2 /CO-Oxidation sind auch Halbzellenmessungen der Methanol-Oxidation<br />
möglich, wobei die Elektrolytlösung durch eine 1 M Methanol-Lösung in 0,5 molarer H 2 SO 4<br />
ersetzt wird.