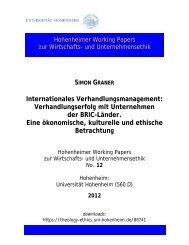Hohenheimer Working Papers Wirtscha s- & Unternehmensethik
Hohenheimer Working Papers Wirtscha s- & Unternehmensethik
Hohenheimer Working Papers Wirtscha s- & Unternehmensethik
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
ergibt sich aus Benthams moralischer Aussage „the greatest happiness of the<br />
greatest number that is the measure of right and wrong“ 66 .<br />
Die ethische Rechtfertigung für diesen Ansatz ergibt sich wie folgt: In einer fairen<br />
Lotterie mit je einem Los pro Teilnehmer über die Lebensumstände, in die er hinein-<br />
geboren wird, kennen die Teilnehmer lediglich den Wert der Lotterie, also den ag-<br />
gregierten Gesamtnutzen, sowie den daraus und aus der Anzahl der Teilnehmer ab-<br />
geleiteten erwarteten Durchschnittsnutzen. Folglich ist die Steigerung des erwarte-<br />
ten Nutzens nur über eine Steigerung des aggregierten Gesamtnutzens möglich. 67<br />
Gemäß dem „purely moral principle that, in making basic moral judgements, we<br />
must give the same priori weight to the interest of all members of the society“ 68 , ist<br />
„in complete ignorance of what his own relative position (and the position of those<br />
near to this heart)“ 69 die Steigerung des Gesamtnutzen die einzige Möglichkeit, dass<br />
eine gerechte Verteilung der Güter erzielt wird. 70<br />
Kritisch gesehen wird das Miteinbeziehen von Verteilungswirkungen und der damit<br />
verbundene emotionale Nutzen in die Präferenzfunktion 71 sowie das Aufsummieren<br />
eines auf subjektiven, nicht messbaren Präferenzen basierenden und somit nicht<br />
objektiv zu bewertenden Nutzens. 72 Ein weiterer Kritikpunkt am Utilitarismus ist,<br />
dass der Nutzen eines Individuums mit den Nutzeneinbußen anderer Individuen ver-<br />
rechnet wird und diesen in der Summe letztlich aufwiegt. Dies hat zur Folge, dass<br />
sich der Nutzen durch die Lust am Leid des anderen und somit das Unmoralische<br />
als moralisch rechtfertigen lässt. 73 Dieser Umstand spiegelt sich insbesondere in der<br />
Kritik wider, dass im Utilitarismus alles miteinander verrechnet werden kann, was<br />
mit der Menschenwürde unvereinbar ist. 74 Ebenfalls kritisiert wird, dass Menschen<br />
mit einer geringen Lebensqualität ihre Präferenzen anpassen und folglich ein identi-<br />
sches Nutzenniveau als besser gestellte Menschen erreichen, obwohl es ihnen ob-<br />
jektiv schlechter geht. 75<br />
Allen Kritikpunkten und insbesondere dem letzten Kritikpunkt ist jedoch entgegen zu<br />
halten, dass der Utilitarismus eine ökonomische Grundlage für soziale Umverteilun-<br />
gen von Starken zu Schwachen liefert, wenn dies den Gesamtnutzen steigert. 76 Mo-<br />
66 Bentham (1992), S. 229.<br />
67 Vgl. Harsanyi (1978), S. 223-228.<br />
68 Harsanyi (1976), S. 10.<br />
69 Harsanyi (1953), S. 434f.<br />
70 Vgl. Ebenda, S. 435.<br />
71 Ausführliche Diskussion in Kapitel 2.3.3.<br />
72 Vgl. Heinrichs (2006), S. 33f, 38.<br />
73 Vgl. Suchanek (2007), S. 18.<br />
74 Vgl. Ebenda, S. 171.<br />
75 Vgl. Heinrichs (2006), S. 36.<br />
76 Vgl. Noll (2002), S .19.<br />
10



![Kirchenmitgliedschaft In Europa bestand bereits 1991 »[d]ie ...](https://img.yumpu.com/21959791/1/190x156/kirchenmitgliedschaft-in-europa-bestand-bereits-1991-die-.jpg?quality=85)