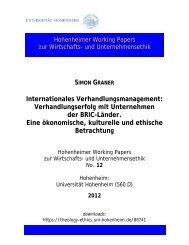Hohenheimer Working Papers Wirtscha s- & Unternehmensethik
Hohenheimer Working Papers Wirtscha s- & Unternehmensethik
Hohenheimer Working Papers Wirtscha s- & Unternehmensethik
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
pliance and investing “more” into human capital, the environment and the relations<br />
with stakeholders.“ 98<br />
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich Vertreter der Menschheit in ei-<br />
nem praktischen Diskurs auf die allgemein verbindliche Maxime geeinigt haben,<br />
dass wirtschaftliche Abläufe dem Gemeinwohl und nicht nur dem Eigeninteresse der<br />
handelnden Akteure dienen sollen. Gemäß dieser Definition ist von der „Ansicht,<br />
dass ethische Wertvorstellungen eine Frage subjektiver Entscheidungen sind […]<br />
Ethik ist letztlich eine Frage des Geschmacks“ 99 abzusehen. Denn es muss „ein Un-<br />
terschied zwischen jenen Bereichen der Ethik gemacht werden [..], in denen Fragen<br />
des persönlichen Lebensstils behandelt werden, und jenen Bereichen, in denen<br />
Ethik grundlegende Normen des Miteinanderlebens aller Menschen benennt […]<br />
und in denen die These der Subjektivität von Ethik Grenzen findet. Hier [bei einer<br />
nachhaltigen Entwicklung] geht es um existenzielle Fragen wie das friedliche Zu-<br />
sammenleben der Menschen, die Verteilung von Lebenschancen und die Bewah-<br />
rung von Lebensgrundlagen. Solche Fragen können nicht dem persönlichen Ge-<br />
schmack überlassen werden.“ 100 Wenn bei einer nachhaltigen Entwicklung die Wirt-<br />
schaft dem Gemeinwohl dient, wird gemäß dem utilitaristischen Grundgedanken der<br />
Gesamtnutzen der Menschheit gefördert. Außerdem zielt die nachhaltige Entwick-<br />
lung darauf ab, „dass Menschen ohne existenzielle Not und in Würde leben kön-<br />
nen“ 101 , so dass auch der Rawls'schen Gerechtigkeitstheorie Rechnung getragen<br />
wird. Dabei stellt die Nachhaltigkeit ein moralisches Ziel dar, dessen Wert in seiner<br />
moralischen Bedeutung und ethischen Rechtfertigung liegt, und eben nicht in seiner<br />
materiellen Produktion für die Menschen. 102 Das am moralischen Ziel der Nachhal-<br />
tigkeit ausgerichtete Handeln eines Unternehmens nennt man CSR und ist in den<br />
10 Prinzipien des United Nations (UN) Global Compact wiederzufinden, welche die<br />
Unternehmen dazu anhält, die Menschenrechte, Rechte der Arbeitnehmer, den Ar-<br />
beitsschutz, den Umweltschutz sowie die Bekämpfung der Korruption zu achten, da-<br />
für einzutreten und zu fördern. 103<br />
98 Commission of the European Communities (2001), S. 6.<br />
99 Schneeweiß (2002), S. 73.<br />
100 Ebenda, S. 74.<br />
101 Gabriel/Schlagnitweit (2009), S. 55.<br />
102 Vgl. Bromley (2008).<br />
103 Vgl. United Nations Global Compact (2011).<br />
14



![Kirchenmitgliedschaft In Europa bestand bereits 1991 »[d]ie ...](https://img.yumpu.com/21959791/1/190x156/kirchenmitgliedschaft-in-europa-bestand-bereits-1991-die-.jpg?quality=85)