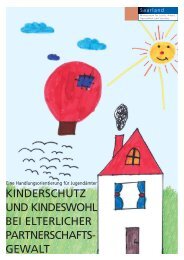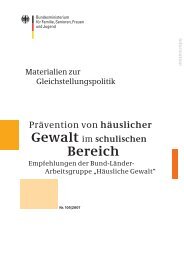Leitfaden - Gewalt gegen Kinder - Saarland
Leitfaden - Gewalt gegen Kinder - Saarland
Leitfaden - Gewalt gegen Kinder - Saarland
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Säuglinge,<br />
Kleinkinder<br />
Kleinkind bis<br />
Schulalter<br />
Traumatische Lebenserfahrungen in der Kindheit stören die gesamte Entwicklung<br />
besonders tiefgreifend und verändern in besonderem Maße die Einstellungen zu<br />
sich selbst und zur Umwelt. Im Unterschied zu Erwachsenen ist die kindliche Entwicklung<br />
beim Eintritt der potentiell traumatisierenden Situation noch nicht abgeschlossen.<br />
Die Bewältigung der für die jeweilige Alterstufe spezifischen Entwicklungsaufgaben<br />
kann durch das traumatische Erleben erschwert oder verhindert<br />
und bereits bestehende Entwicklungsschwierigkeiten vergrößert werden. Einen<br />
weiteren Unterschied zu den Erwachsenen bildet der Umstand, dass <strong>Kinder</strong> bei der<br />
Verarbeitung des Traumas aufgrund ihres Alters nicht in der Lage sind, auf einen<br />
längeren Zeitraum positiver Erfahrungen zurückzugreifen.<br />
Klinische Erfahrungen mit traumatisierten <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen zeigen, dass<br />
sie auf potentiell traumatogene Lebensereignisse mit (teils) anderen Symptommustern<br />
reagieren, als dies bei Erwachsenen zu erwarten wäre. Zwar finden sich auch<br />
psychobiologische Reaktionsmuster wie Übererregung und vegetative Symptome,<br />
Vermeidungsverhalten sowie wiederkehrende intrusive Erlebensweisen auch bei<br />
<strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen.<br />
Bei <strong>Kinder</strong>n im Alter 3-5 Jahren zeigten sich Symptome des traumatischen Wiedererlebens<br />
in ca. 80 %, erhöhten Erregungsniveaus in 90 % und Vermeidungsverhaltens<br />
in 3 % der Fälle (Levendosky et al. zitiert nach Kindler 2006).<br />
Ältere <strong>Kinder</strong> zwischen 7 und 12 Jahren weisen traumatisches Wiedererleben in<br />
ca. 50 %, erhöhte Erregungsniveaus in 40 % und Vermeidungsverhalten in 20 %<br />
der Fälle auf (Graham-Bermann & Levendosky, 1998 zitiert nach Kindler).<br />
Ähnlich starke Traumatisierungen wurden bei <strong>Kinder</strong>n nach Verkehrsunfällen oder<br />
Hundeattacken gefunden und höhere Werte nach dem Miterleben eines gewaltsamen<br />
Todesfalles in der Familie (Kindler Seminarunterlagen DRA, 2006).<br />
Daneben lassen sich aber häufig kindliche Reaktionsweisen finden, die sich je nach<br />
Entwicklungsstand unterschiedlich darstellen.<br />
4.5.2 Besonderheiten verschiedener Entwicklungsstufen<br />
"Schon Säuglinge können traumatisiert werden. Sie reagieren äußerlich sichtbar<br />
z.B. mit Futterstörungen und Schreien. Bereits erlernte Selbstberuhigungsmechanismen<br />
(Autostimulationen wie Selbstberührungen, Daumenlutschen etc.) oder<br />
Trost von emotional relevanten Bezugspersonen reichen nicht mehr aus, um die<br />
psychobiologischen Spannungszustände in der traumatischen Situation zu kompensieren.<br />
Die primäre Bezugsperson ist insbesondere für den Säugling ein "emotionales<br />
Sprachrohr" für äußere Bedrohung. Die zunächst von der Elternperson erlebte<br />
Angst überträgt sich auf das Baby. Es erlebt die Welt noch wie im Spiegel des elterlichen<br />
Antlitzes, die primäre Bezugsperson baut sozusagen eine Affektbrücke<br />
zum Säugling, sie ist Teil seines Affektregulationssystems. Entsprechend traumatisch-überflutend<br />
können bedrohliche emotionale wie physische Einschläge auf dieses<br />
labile dyadische System einwirken.<br />
Auch bei <strong>Kinder</strong>n vom Kleinkind bis zum Grundschulalter finden wir intrusive Erlebensweisen,<br />
die sich aber oftmals eher in einem so genannten "traumatischen<br />
Spiel" wieder finden. (…) Das Beziehungsverhalten des Kindes kann nach einer<br />
traumatischen Lebenserfahrung dramatisch verändert sein. Das Kind zeigt sich<br />
scheu, ängstlich und sozial zurückgezogen. Der Kontakt zu Gleichaltrigen ist im<br />
zeitlichen Zusammenhang mit einem traumatischen Ereignis verändert oder gestört.<br />
Sozialen Situationen wird ängstlich begegnet. Der natürliche Drang des Kindes<br />
zur Exploration seiner Umwelt erscheint aufgehoben zu sein. Gefühle sind<br />
durch das Kind weniger zu kontrollieren, es kommt zu Gefühlsausbrüchen von Wut,<br />
Trauer oder Verzweiflung. Andere <strong>Kinder</strong> reagieren mit einer "frozen watchfullness",<br />
wirken in Panik erstarrt, ängstlich und leer. Viele <strong>Kinder</strong> reagieren mit motorischer<br />
Unruhe, ziellosem Verhalten und Konzentrationsstörungen.<br />
34