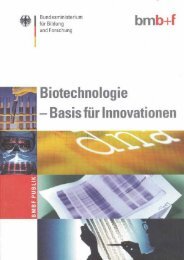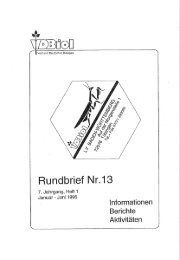Deutsche Biodiversitätsforschung im Ausland - Übersichtsstudie - VBio
Deutsche Biodiversitätsforschung im Ausland - Übersichtsstudie - VBio
Deutsche Biodiversitätsforschung im Ausland - Übersichtsstudie - VBio
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
estätigt die These, dass Biodiversitäts-forschung teilweise zu stark auf best<strong>im</strong>mte<br />
geographische Regionen fokussiert ist (Marquard, 2010). Um wirklich eine klare Aussage<br />
treffen zu können, müssten die Ergebnisse mit der Größe des Landes, bzw. der<br />
Einwohnerzahlen, verrechnet werden sowie die Intensität der Forschungsaktivitäten an Hand<br />
von Parametern wie z.B. Projektzahl, Anzahl der Doktoranden, finanzielle Mittel, etc.<br />
abgeschätzt werden. Vermutlich spielt die Präsenz bereits vorhandener deutscher<br />
Forschungsprojekte und ihrer Infrastrukturen eine wichtige Rolle für die weitere<br />
Projektanbahnung und erklärt die Häufung von Akteuren auf best<strong>im</strong>mte Länder. Sicherlich ist<br />
bei der geographischen Verteilung auch der Einfluss der deutschen Kolonialgeschichte und<br />
von großen Verbundprojekten zu spüren, was z.B. an Hand von Namibia und Südafrika<br />
deutlich wird, wo sich die hohe Anzahl verschiedener Akteure mit den geographischen<br />
Schwerpunkten des BIOTA Projektes erklären lässt. Der Vorschlag der Wissenschaftler (s.<br />
3.4.3.) verstärkt Vorstudien zu finanzieren, könnte evtl. den Aktionsradius der deutschen<br />
Forschung erhöhen und das Erschließen neuer Forschungsgebiete erleichtern.<br />
Vergleicht man die Übersicht der Länder in denen deutsche Akteure forschen (Abb.1), mit<br />
der globalen Verteilung der Biodiversität-Hotspots (Barthlott et al., 1997), so ergeben sich<br />
einige geographische Lücken. Im Folgenden sind die in Bezug auf die Gefäßpflanzen<br />
artenreichsten Länder aufgeführt (Arten pro 10,000 km 2 > 1000), für die keine deutschen<br />
Akteure identifiziert wurden. Afrika: Zaire, Z<strong>im</strong>babwe, Gabon, Äquatorial Guinea, Sierra<br />
Leone und Lybien. Europa: Kroatien, Bosnien. Asien: Afghanistan, Tajikistan, Laos, Taiwan.<br />
Australien: Salomon Inseln. Südamerika: Uruguay, Paraguay. Eine Lücke ergab sich<br />
ebenfalls auf den Karibischen Inseln, einschließlich Kuba, Haiti, Dominikanische Republik,<br />
etc.). In einigen Fällen, wie z.B. Sierra Leone und Afghanistan, ist die mangelnde<br />
wissenschaftliche Aktivität sicherlich auf die instabile politische Lage <strong>im</strong> Land<br />
zurückzuführen.<br />
Auch in den USA und in Australien fanden sich nur wenige Akteure, obwohl die USA laut<br />
BMBF Deutschlands wichtigster Partner in der wissenschaftlichen Zusammenarbeit vor allem<br />
in den Bereichen Umwelt- und Kl<strong>im</strong>aforschung ist (BMBF, online). Es wäre zu vermuten,<br />
dass hier andere Kooperationsformen wie z.B. Bildungsaustausch dominieren. Darauf<br />
deuten auch Zahlen einer Studie des BMBF, denen zu Folge Amerika bei deutschen<br />
Studenten an zweiter Stelle als Zielland für ein <strong>Ausland</strong>sstudium steht (BMBF, 2005).<br />
Außerdem belegt eine weitere Studie des BMBF, dass 14% aller promovierten deutschen<br />
Nachwuchswissenschaftler in die USA gehen und häufig dort in das Wissenschafts- und<br />
Forschungssystem eingegliedert werden (BMBF, 2001).<br />
21