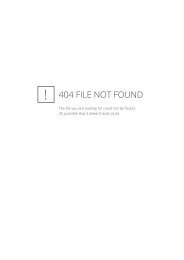Dossier #11: "ERINNERUNGSKULTUR UND GEDÄCHTNISPOLITIK"
Dossier #11: "ERINNERUNGSKULTUR UND GEDÄCHTNISPOLITIK"
Dossier #11: "ERINNERUNGSKULTUR UND GEDÄCHTNISPOLITIK"
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
dialogische Vorstellungen. Nicht mehr die Eingrenzung von Erinnerung sondern dessen Entortung - räumlich wie<br />
zeitlich - steht im Zentrum.<br />
Europäische Zivilität im Verhältnis zu Auschwitz<br />
Die europäische Suche nach einer gemeinsamen Identität treibt neben philosophischen (von Rousseau über Kant bis<br />
Marx und zurück), juristischen (vom Code Napoleon zu Maastricht bis zur EU-Verfassung) oder ökonomischen<br />
(von wirtschaftlicher corporate identity bis hin zu Einfuhrzöllen) eindringlichen Identitätsformeln auch euroerinnerungspolitische<br />
Blüten. Als mutmaßlicher Hintergrund gilt die funktionelle Verschwisterung von kollektivem<br />
Gedächtnis und ideologischer Verwertbarkeit. Der israelische Historiker Moshe Zuckermann stellte bereits vor<br />
Jahren eine ideologische Vereinnahmung der Shoah im öffentlichen Diskurs fest, indem er eine durch<br />
Universalisierung des Geschichtsereignisses begründete "Entjudung" des Holocausts ausmachte. 26 Erinnerung<br />
kommt dabei eine ähnlich hegemoniale und vereinheitlichende Wirkung wie Geschichte zu.<br />
Wurde einst das westliche Christentum, die lange Tradition des Abendlandes oder das Recht Roms angeführt, um<br />
eine gemeinsame Linie des Gleichen zu kreieren, beruft man sich heute zusätzlich - und häufig vorderrangig - auf<br />
einen erinnerungspolitischen Wertekatalog des antigenozidalen Einvernehmens, der der reinen "Wertegemeinschaft<br />
Europa" den Rang abläuft. Zwar sind klassische europäische Selbstzuschreibungen, wie die Wohlfahrtsstaatlichkeit,<br />
damit verbunden die Befriedung von Klassengegensätzen oder Bezugnahmen auf den lutherischen Protestantismus,<br />
weiterhin mitlaufende Kriterien um die Einigkeit zu umreißen, die gemeinsame Erinnerung steht dem aber, selbst<br />
wenn die gemeinsamen Erinnerungsrituale noch in den Kinderschuhen stecken, in nichts nach.<br />
Sebastian Körner ist Kulturwissenschaftler aus Leipzig, schrieb seine Magisterarbeit zu den Diskursen über die Entschädigungen für<br />
Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter und arbeitet gerade an einem Buch über Vergangenheitspolitik<br />
5. Wie erinnern?<br />
von Dr. Salomon Korn<br />
Eröffnungsvortrag der Reihe "Jüdische Lebenswelten" in der Synagoge Leipzig am 24. März 2004, aus<br />
Anlass der Leipziger Buchmesse 2004<br />
Wie erinnern? Zur Beantwortung dieser Frage habe ich Neues gelesen und früher Gelesenes wieder gelesen. Jetzt<br />
stelle ich fest: an das meiste davon erinnere ich mich nicht mehr. Ist das bedauerlich? Nur bedingt, denn wenn es für<br />
das vorliegende Thema wirklich von Bedeutung gewesen wäre, hätte ich es vermutlich nicht so schnell vergessen. In<br />
Erinnerung ist mir allerdings Michel de Montaignes Klage über sein schlechtes Gedächtnis geblieben. Nicht, dass er<br />
sich dessen rühmen würde, nein, aber allzu groß ist auch sein Bedauern nicht über diese von ihm umstandslos<br />
eingestandene Gedächtnisschwäche. Ihre Vorzüge sieht er vor allem in seinen notwendigerweise kurz gehaltenen<br />
Reden, im Umstand, sich viel Überflüssiges gar nicht erst merken zu müssen und erlittene Kränkungen schnell zu<br />
vergessen. Außerdem, so Montaigne, "lachen mich nun die mir entfallenen Orte und Bücher, wenn ich ihnen wieder<br />
begegne, stets mit der Frische des völlig Neuen an". Diese Gelassenheit kann der Autor der berühmten, im 16.<br />
Jahrhundert verfassten "Essais" an den Tag legen, weil er weiß, "daß ein ausgezeichnetes Gedächtnis oft mit<br />
schwachem Urteilsvermögen Hand in Hand geht". Und so legt er größeren Wert auf Verstand als auf Buchwissen,<br />
denn es ist nicht das Gedächtnis, sondern der Verstand, der aus allem Nutzen zieht.<br />
Ähnlich argumentiert 300 Jahre später Friedrich Nietzsche in seiner Abhandlung "Vom Nutzen und Nachteil der<br />
Historie für das Leben". Wie Montaigne verpönt auch er Faktenwissen und Gelehrsamkeit, wenn sie nicht im<br />
Dienste einer kritischen, dem Leben zugewandten Geschichtsbetrachtung stehen. Alles, was von diesem Ziel<br />
fortführt, darf dem Vergessen anheimfallen. Wie also erinnern?<br />
An Montaigne und Nietzsche geschult lautet eine erste Antwort darauf: kritisch gegenüber dem Gegenstand der<br />
Erinnerung. Dies gilt, in Anlehnung an Nietzsche, gleichermaßen gegenüber der Geschichtsschreibung, die zwar<br />
nicht identisch mit Erinnerung ist, sich aber in Teilbereichen mit ihr überschneidet. Historiografie versucht<br />
Ereignisse der Geschichte, die schriftlichen und mündlichen Erinnerungen an sie, möglichst objektiv zu ermitteln,<br />
aufzuzeichnen und weiterzugeben. Bei allem zugestandenen Bemühen um Objektivität: Geschichtsschreibung kann<br />
nicht gänzlich frei bleiben von der subjektiven Perspektive derer, die historische Fakten in ausgewählte Zusammen-<br />
26 (Moshe Zuckermann, Täter und Opfer, in: Zeitschrift für Kulturaustausch, 49 (1999), S. 32<br />
D-A-S-H <strong>Dossier</strong> <strong>#11</strong> – Erinnerungskultur und Gedächtnispolitik 13