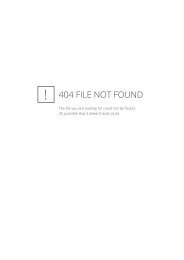Dossier #11: "ERINNERUNGSKULTUR UND GEDÄCHTNISPOLITIK"
Dossier #11: "ERINNERUNGSKULTUR UND GEDÄCHTNISPOLITIK"
Dossier #11: "ERINNERUNGSKULTUR UND GEDÄCHTNISPOLITIK"
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
wollte nur einem Angriff der Sowjetunion zuvorkommen, der Partisanenkrieg war erst der Auslöser deutscher<br />
Gräueltaten, in den Gulags starben auch viele..."); sprachliche Abschwächungen und Verstärkungen unterstrichen die<br />
Konstruktion (für deutsche/österreichische Aktivitäten subjektlose Passivkonstruktionen und neutrale Attribute - für<br />
alliierte Aktionen dagegen emotionale Beschreibungen wie "abschlachten"); es gab Tabuthemen (Vernichtung,<br />
Zusammenarbeit SS und Wehrmacht, Freiwilligkeit) und es wurde genau ausgewählt, wer reden durfte (jüdische und<br />
andere KZ-Überlebende kamen nicht zu Wort, dafür oft die "Heimkehrer").<br />
Die Motive hinter all diesen Strategien sind relativ klar: Deutsche bzw. Österreicher wollen sich und ihre Vorfahren<br />
von der Schuld der nationalsozialistischen Verbrechen befreien und / oder am besten gar nicht mehr an diese Vergangenheit<br />
erinnert werden.<br />
Macht, Medien, Erinnerung<br />
Der Zusammenhang zwischen Medien und Erinnerungsdiskurs ist weder eine Einbahnstraße noch überhaupt mit<br />
einer simplen Ursache-Wirkungs-Beschreibung zu erfassen. Auch ist er nicht auf diese beiden Pole beschränkt. Denn<br />
beide hängen gleichzeitig mit den Machtverhältnissen in der Gesellschaft zusammen. Gesellschaftliche Gruppen und<br />
Institutionen versuchen, ihre Existenz, ihre Identität und ihre Macht über eine jeweils passende Erinnerung zu<br />
legitimieren. Die Vergangenheit ist immer an den Interessen der Gegenwart ausgerichtet. Das heißt, die aktuellen<br />
Bedürfnisse gesellschaftlicher Gruppen und Institutionen bestimmen, wie Geschichte konstruiert und ausgelegt wird.<br />
Somit ist die historische Wahrheit immer abhängig von den an die Fakten gestellten Fragen. Und auch der<br />
Erinnerungsdiskurs ist abhängig von den aktuellen Interessen und Bedürfnissen gesellschaftlicher Gruppen und<br />
Institutionen.<br />
Die hier besprochenen Medien stehen dabei an einem Ort, der ihrem Namen gerecht wird: dazwischen. Sie bilden<br />
mit der Erinnerungskultur und den aktuellen gesellschaftlichen Interessen einen Zusammenhang der gegenseitigen<br />
Abhängigkeit. Wie sieht das konkret aus?<br />
Gesellschaftliche Gruppen und Institutionen haben bestimmte aktuelle Interessen. Aus diesen folgen bestimmte<br />
Ansprüche an ein Bild der Vergangenheit. Diese Ansprüche wiederum sorgen für eine bestimmte mediale Vermittlung<br />
dieses Vergangenheitsbilds und prägen dadurch die kollektive Erinnerung (oder einen Teil von ihr). Diese<br />
kollektive Erinnerung nun wird von einer bestimmten Gruppe von Menschen in der Gesellschaft geteilt, sie werden<br />
mit ihr sozialisiert, nehmen sie in ihre individuelle Erinnerung, also ihr Geschichtsbild auf. Und diese Menschen<br />
schließlich sind selber wieder aktiv in der Formulierung und Verfolgung von aktuellen Interessen - innerhalb<br />
bestimmter Gruppen oder Institutionen. Womit sich der Kreis schließt. Um den ganzen Zusammenhang noch<br />
komplexer zu machen, sei noch darauf hingewiesen, dass sowohl die AkteurInnen innerhalb der Medien-<br />
Institutionen noch ihre eigenen Interessen verfolgen, als auch die Medien die gesellschaftlichen Gruppen und<br />
Institutionen beeinflussen. Und nicht zuletzt sind auch die MedienakteurInnen von einer bestimmten Erinnerungskultur<br />
geprägt. Also: Die in der Gegenwart medial konstruierte Vergangenheit konstruiert die Gegenwart.<br />
Das alles ist ziemlich kompliziert, deshalb braucht es Beispiele: Der bayrische Rundfunk und die südwestdeutschen<br />
Sender wollten die Ausstrahlung von "Holocaust" verhindern. Bekanntermaßen sind die öffentlich-rechtlichen<br />
Sender keineswegs so politikfern, wie sie und die Politik gern behaupten. Es zeigt sich an diesem Verhalten also<br />
deutlich der Versuch der bayrischen und baden-württembergischen Landespolitik, diesen bedeutenden Umbruch in<br />
der deutschen Erinnerungskultur, nämlich eine weite Teile der Bevölkerung erreichende Personifizierung der<br />
deutschen Untaten durch eine verfilmte Geschichte, abzuwenden. Zu ihrer Motivation liegt keine empirische<br />
Analyse vor, ich darf jedoch mit hinreichender Wahrscheinlichkeit annehmen, dass es hier um die Fortsetzung der<br />
Verdrängung, des Schweigens über die TäterInnen und ihre Taten und vor allem um eine Vermeidung einer erneuten<br />
Diskussion um deutsche Schuld ging.<br />
Andererseits waren bei den Sendern, die die Ausstrahlung der Serie vorantrieben, vornehmlich dem WDR, ebenfalls<br />
politische Interessen im Spiel. In Kooperation mit der Bundeszentrale für politische Bildung sollte erreicht werden,<br />
der Öffentlichkeit ihre (vorhandenen) Wissenslücken zum Holocaust nachzuweisen und die Nachfrage nach Bildung<br />
und Information anzukurbeln. Außerdem sollte eine öffentliche Diskussion über die Verbrechen der Deutschen im<br />
"Dritten Reich" angestoßen werden, unter anderem, da es Bestrebungen gab, die anstehende Verjährungsfrist für<br />
Kriegsverbrechen aufzuheben. Nicht zufällig wurde in der vorher und nachher durchgeführten ZuschauerInnenbefragung<br />
auch die Frage gestellt, ob die Interviewten eine weitere Verfolgung von Kriegsverbrechen und<br />
Verbrechen des Nationalsozialismus bejahen würden. Die Zustimmung stieg durch die Sendung von 15 auf 39%<br />
bzw. von 33 auf 50%. 60<br />
60 Brandt, Susanne: Holocaust - redaktionell bearbeitet, S.90<br />
D-A-S-H <strong>Dossier</strong> <strong>#11</strong> – Erinnerungskultur und Gedächtnispolitik 35