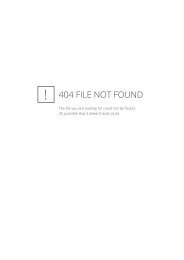Dossier #11: "ERINNERUNGSKULTUR UND GEDÄCHTNISPOLITIK"
Dossier #11: "ERINNERUNGSKULTUR UND GEDÄCHTNISPOLITIK"
Dossier #11: "ERINNERUNGSKULTUR UND GEDÄCHTNISPOLITIK"
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
8. Dreiecksbeziehung.<br />
Die Rolle der Medien im Erinnerungsdiskurs<br />
von Mathias Berek<br />
Der Versuch, die Rolle der "Medien" im "Erinnerungsdiskurs" zu untersuchen, gleicht ein wenig dem Ansinnen, bei<br />
Google den Begriff "Wasser" nachzuschlagen. Vom Wasserwerk über den Mineralwasserhersteller bis zu<br />
hydrogeologischen Forschungsergebnissen dürfte alles Mögliche angezeigt werden. Deshalb muss vorher geklärt<br />
werden: Welche Erinnerung? Welche Medien? Der Filmregisseur Claude Lanzmann ("Shoah") sagte 1998 auf einer<br />
Tagung in Marburg, indem er den bekannten Ausspruch eines Faschisten abwandelte: "wenn ich das Wort<br />
Erinnerung höre: Ich verspüre Lust, den Revolver zu ziehen. Mir scheint, dass man dieses Wort bei jeder besten<br />
Gelegenheit anwendet und überall beimischt." 47 Man kann seinen Ärger verstehen. Erinnerung ist zu einem hohlen<br />
Schlagwort geworden. Es wird immer öfter über sie geredet - und die wenigsten machen sich dabei die Mühe, näher<br />
zu bestimmen, was denn damit gemeint sei. Erinnerung, die uns hier beschäftigen soll, ist die kollektive Erinnerung<br />
einer Gesellschaft, das sind die Geschichten über die Geschichte, die in der Familie, in den Schulen, in Filmen und<br />
Büchern erzählt werden. Das sind die Bilder, die die Menschen über die Vergangenheit sehen und mit ihren eigenen<br />
Erinnerungen verschmelzen. Das ist das Bild, das die Menschen von ihrer eigenen Vergangenheit und der ihrer<br />
Gesellschaft haben.<br />
Und diese Erinnerung ist fast immer (die Menschen leben eben nur eine begrenzte Zeit und immer nur an einem Ort<br />
gleichzeitig) keine unmittelbare, sondern medial vermittelt. Eigentlich meint medial alle möglichen Kommunikationsmedien:<br />
Texte, Bilder, Orte, Rituale oder Traditionen. Was uns hier jedoch hauptsächlich interessiert, sind die<br />
modernen Massenmedien: Fernsehen, Filme, Zeitungen, - aber auch Bücher. Und um noch konkreter zu werden,<br />
geht es hier um die deutsche Erinnerungskultur und das Thema, das permanent erinnert oder vergessen werden<br />
sollte: Nationalsozialismus und Holocaust.<br />
Boom der Erinnerungskultur?<br />
Gerade für die letzten 20, 25 Jahre wird seit geraumer Zeit ein Boom der Erinnerung an NS-Zeit und Judenvernichtung<br />
diagnostiziert. Begründet wird die Einschätzung meist mit dem langsamen "Verschwinden der<br />
Augenzeugen" - die Erlebnisgeneration der Opfer und Täter stirbt aus - und mit neuen elektronischen Speichermedien.<br />
Im Ergebnis wurde vor allem außerhalb Deutschlands versucht, von überlebenden Opfern des Holocaust so<br />
viele Erlebnisberichte wie irgend möglich auf Video zu bringen, um sie der Nachwelt zu erhalten. Steven Spielbergs<br />
Shoah Foundation oder die Projekte in israelischen Gedenkstätten wie Massuah seien als Beispiele genannt. Dahinter<br />
steht die Befürchtung, mit dem Sterben der Zeitzeugen gehe auch deren authentische Erinnerung, die sie der Nachwelt<br />
im direkten Gespräch weitergeben können, für immer verloren.<br />
Doch wir müssen weiter zurück schauen. Die Alliierten versuchten nach ihrem Sieg über Deutschland im Mai 1945<br />
zunächst, der deutschen Bevölkerung Nachhilfe bei der Erinnerung an ihre Untaten zu geben. AnwohnerInnen von<br />
KZs wurden zwangsweise durch die Lager geführt, um ihnen die Leichenberge zu zeigen. Im Rahmen der<br />
Reeducation wurden den Deutschen unzählige Fotos und Filme von dem Grauen gezeigt, das die alliierten Einheiten<br />
bei der Befreiung der Lager vorgefunden hatten.<br />
In den Westzonen etablierte sich mit dem Abbruch der Entnazifizierung ein Konsens des Schweigens. Schweigend<br />
machte man sich an den Wiederaufbau, vergessend konzentrierte man sich auf Familie und Arbeit, verdrängend hielt<br />
man Abstand von politischer Auseinandersetzung. Die Verbrechen der Deutschen im "Dritten Reich" und der<br />
Holocaust spielten in der Öffentlichkeit der 50er Jahre keine Rolle. Erst gegen Ende des Jahrzehnts gab es einen<br />
Umschwung: Übergriffe von Nazis nahmen zu, rechtsradikale Organisationen wurden wieder stärker und es gab eine<br />
ganze Serie von Anschlägen auf jüdische Friedhöfe. Vor allem von der Angst vor einem schlechten Ansehen im<br />
Ausland getrieben, erkannte man nun Mängel in der politischen Bildung. In dem TV-Film "Die Tagebücher des<br />
Jürgen Wilms" wurden 1960 erstmals Massenerschießungen von Jüdinnen und Juden gezeigt, 1961 erschien Erwin<br />
Leisers Dokumentarfilm "Mein Kampf", der sich aufklärerisch mit der Entwicklung und den Verbrechen des<br />
nationalsozialistischen Deutschlands befasste. Ab diesem Zeitpunkt setzte man sich auch in Romanen und Fotobänden<br />
zunehmend mit der nahen Vergangenheit auseinander - wenn auch oft unter dem Dogma der Totalitarismusthese,<br />
die Faschismus und Kommunismus gleichsetzt. Parallel dazu führten Magnetaufzeichnung, die Möglichkeit<br />
einer synchronen Aufnahme von Ton und Bild und die Durchsetzung des Fernsehens als Leitmedium dazu, dass<br />
47 Eine Diskussion mit Claude Lanzmann. In: Kulturamt der Stadt Marburg (Hg.): Formen der Erinnerung. Ein anderer Blick auf Gedenken,<br />
Erinnern und Erleben; eine Tagung. Marburg: Jonas Verlag 1998., S.14.<br />
D-A-S-H <strong>Dossier</strong> <strong>#11</strong> – Erinnerungskultur und Gedächtnispolitik 31