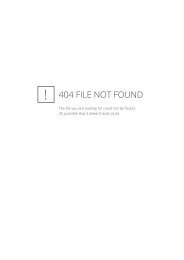Dossier #11: "ERINNERUNGSKULTUR UND GEDÄCHTNISPOLITIK"
Dossier #11: "ERINNERUNGSKULTUR UND GEDÄCHTNISPOLITIK"
Dossier #11: "ERINNERUNGSKULTUR UND GEDÄCHTNISPOLITIK"
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
gesetzt. Dies ist einerseits selbstverständlich notwendig, andererseits entlastet es aber auch von der Schuldfrage. Die<br />
Schuld, die die Deutschen allgemein und individuell an den Verbrechen während des Nationalsozialismus tragen,<br />
nimmt meist einen zu geringen Raum ein. Von dieser wird beispielsweise abgelenkt mit Formulierungen wie 'Hitler<br />
kam über Deutschland' oder 'die Taten einiger weniger' usw. Damit, wie auf allen Ebenen und in allen Bereichen das<br />
nationalsozialistische System mit getragen und weiter entwickelt wurde, befassen sich die öffentlichen Reden oder<br />
Debattenbeiträge nur selten. Genau dies versuchte Philipp Jenninger 1988 bei seiner Rede anlässlich des 50. Jahrestages<br />
der Novemberpogrome im Bundestag. Er erinnerte nicht bzw. nicht vordergründig an die Jüdinnen und Juden,<br />
die von der Gewalt der Pogrome (beschönigend oft "Reichskristallnacht" genannt) betroffen waren und die<br />
Konsequenzen, die diese öffentliche Machtbekundung, getragen durch die deutsche Bevölkerung, für jüdische<br />
Menschen mit sich brachte. Vielmehr sprach der Bundestagspräsident von den Deutschen und deren Beteiligung<br />
oder Billigung der antisemitischen Hetze. Er nannte nicht nur die faschistischen Eliten als Täter, sondern sagte:<br />
"Viele ermöglichten durch ihre Gleichgültigkeit die Verbrechen. Viele wurden selbst zu Verbrechern." Er<br />
thematisierte weiterhin den Vernichtungsantisemitismus und die lange Tradition des Antisemitismus in der<br />
deutschen Geschichte. Diese Aussagen, die Einnahme der Täterperspektive, waren eine neue Schwerpunktsetzung.<br />
Da Jenninger die rhetorischen Mittel der erlebten Rede und Zeitzeugenaussagen benutzte, diese Passagen während<br />
des Vortrags allerdings nicht kennzeichnete, wurde ihm mangelnde Distanzierung vom Nationalsozialismus vorgeworfen.<br />
Einige Abgeordnete verließen während des Vortrags den Saal, Jenninger geriet unter massive öffentliche<br />
(mediale) Kritik und trat zurück. Einige Inhalte der Rede sind durchaus zu kritisieren, z.B. die Überbetonung der<br />
'Erfolge' Hitlers, der theologische Bezug und die Ausführungen über die Zeit nach 1945, aber gerade die Einnahme<br />
der Täterperspektive und das Anliegen, die Schuldigen und nicht nur die Opfer zu benennen, gehören nicht dazu. 13<br />
Nur ein Jahr später, 1989, begann sich die deutsche Gesellschaft so umfassend zu ändern, dass die Betrachtung<br />
deutscher Geschichte im Inland und im Ausland unter ganz neuen Vorzeichen stand.<br />
Nach 1989/90, also nach dem Umbruch in der DDR und der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten,<br />
wurde Vergangenheit wieder vermehrt zum Thema. Im 'neuen' Deutschland entwickelte sich ein Nationalgefühl, wie<br />
es vorher in den getrennten deutschen Staaten nicht gekannt wurde. Diese offensichtliche und öffentliche positive<br />
Bezugnahme auf Deutschland und deutsche Symbole (z.B. die Nationalfarben) hatten auch Auswirkungen auf die<br />
Betrachtung deutscher Geschichte. Zusätzlich musste Deutsche Politik nach außen zeigen, dass die Warnungen vor<br />
einem neuen Großdeutschland, die zum Teil im Ausland geäußert wurden, unberechtigt sind. Erinnerungspolitik<br />
sollte nicht notwendig einen Schlussstrich ziehen, aber die Diskussion in und um Deutschland doch eingrenzen.<br />
Deutschland musste sich geläutert präsentieren und dabei doch Möglichkeiten finden sich auf die eigene Geschichte<br />
auch positiv beziehen zu können. Nach den Brandanschlägen auf Unterkünfte von Asylsuchenden und den<br />
rassistischen Angriffen Anfang der 90er Jahre war man bemüht, keine Bezüge zur deutschen Geschichte herzustellen<br />
und den Taten ihre politische Motiviertheit abzusprechen. Statt offenen Rassismus als solchen zu benennen und<br />
gegen ihn vorzugehen, wurden die Angriffe auf Probleme seit der Wiedervereinigung und durch die Sozialisation in<br />
der DDR zurückgeführt.<br />
Die Rede des Schriftstellers Martin Walser am 11. Oktober 1998 in der Frankfurter Paulskirche zur Verleihung des<br />
Friedenspreises des deutschen Buchhandels stellt eine Zäsur des offiziellen Erinnerns dar, weil das erste Mal seit<br />
Anfang der 80er Jahre die Schuldanerkennung verweigert wurde. Walser hielt die Freiheit des Gewissens gegen die<br />
Macht der "Moralkeule" Auschwitz. Er sprach von der "Instrumentalisierung unserer (gemeint ist die deutsche, K.H.)<br />
Schande". Damit gab er, wenn auch intellektueller formuliert, die Stimmung in der deutschen Bevölkerung wieder.<br />
Mit Sätzen wie: "Die, die mit solchen Sätzen (gemeint waren Warnungen vor dem deutschen Volkscharakter und negative<br />
Einschätzungen der Deutschen, K.H.) auftreten, wollen uns wehtun, weil sie finden, wir haben das verdient.<br />
Wahrscheinlich wollen sie auch sich selber verletzen. Aber uns auch. Alle. Eine Einschränkung: alle Deutschen."<br />
Sagte Walser das, was im Privaten viele denken: Warum müssen wir uns immer schuldig fühlen? Auch dass Ignatz<br />
Bubis als damaliger Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland in der folgenden Debatte in die<br />
Schranken verwiesen wurde, wurde z.B. in Leserbriefen positiv aufgenommen. 14<br />
Besonders markant für die Geschichtspolitik und Erinnerungskultur ab den 90er Jahren sind die Betonung der<br />
Leiden der Deutschen (Bombardierungserfahrungen, Flucht und Vertreibung) und die Wiederkehr der<br />
Totalitarismusthese, d.h. es wird von den 'beiden deutschen Diktaturen' gesprochen und Nationalsozialismus mit<br />
dem Staatssozialismus der DDR verglichen. Gerade die Einweihung der Neuen Wache 1993, zeigt dieses<br />
13 gibt es die Rede auch als Audiodatei. Eine<br />
Analyse, warum gerade die Jenninger Rede zu einem Skandal wurde findet sich hier <br />
14 Eine gute Analyse der so genannten Walser-Bubis-Debatte inklusive ausführlicher Literaturliste:<br />
; die komplette Rede findet sich unter:<br />
. Ein Interview mit Ignatz Bubis aus der Zeitung "Die Welt" vom 14. Oktober 1998 zur Kritik an<br />
Walsers Rede und "Ignatz Bubis antwortet Martin Walser" Auszüge aus der Rede zum 60. Jahrestag<br />
der Reichspogromnacht 1998 <br />
D-A-S-H <strong>Dossier</strong> <strong>#11</strong> – Erinnerungskultur und Gedächtnispolitik 7