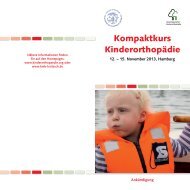editorial – jahresbericht 2012 - 2013 - Schweizerische Gesellschaft ...
editorial – jahresbericht 2012 - 2013 - Schweizerische Gesellschaft ...
editorial – jahresbericht 2012 - 2013 - Schweizerische Gesellschaft ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
› GUIDELINES: WARUM DIE SGOT-SSOT KEINE ERSTELLT<br />
POSITIONSPAPIER DER SGOT-SSOT<br />
Der SGOT-Vorstand hat entschieden, weder eigenen Guidelines<br />
zu erarbeiten noch bestehende zur Verfügung zu stellen.<br />
Warum?<br />
<strong>–</strong> Die Datenlage zu spezifischen Therapien ist in den meisten<br />
Fällen kontrovers. Damit fehlt die Evidenz, um klare<br />
Guidelines zu erstellen. Dieser Umstand macht unspezifische<br />
Formulierung notwendig, die möglichst alle<br />
Therapien und Varianten davon zulassen. Ohne klare<br />
Formulierungen verkommen Guidelines zur politischen<br />
Alibiübung.<br />
<strong>–</strong> Für Therapieformen, deren Evidenz gegeben ist, wird es<br />
beim Vorhandensein von Guidelines im Einzelfall schwierig,<br />
eventuell indizierte, alternative Behandlungswege<br />
einzuschlagen. Damit wird dem betroffenen Patienten<br />
die ev. notwendige Therapie vorenthalten. Die Behandlungsfreiheit<br />
zum Wohle des Patienten wird in diesem Fall<br />
eingeschränkt.<br />
<strong>–</strong> Guidelines im wörtlichen Sinne bedrohen die individuelle<br />
Therapie nicht, da sie theoretisch auch alternative<br />
Behandlungswege zulassen. Allerdings ist die mit den<br />
Guidelines verbundene juristische Angreifbarkeit so<br />
gross, dass eventuell optimalere alternative Behandlungswege<br />
in der Realität gar nicht mehr in Betracht<br />
gezogen werden.<br />
<strong>–</strong> Guidelines führen auch dazu, dass die Leistungsfinanzierer<br />
eventuell notwendige alternative Behandlungswege<br />
nicht mehr finanzieren. Dies führt zu einer Benachteiligung<br />
des betroffenen Patienten, der in diesem Fall nicht<br />
von der optimalen Therapie profitieren kann.<br />
Bei all den genannten Argumenten steht für die SGOT-SSOT<br />
der Patient im Mittelpunkt und die Mitglieder der SGOT-SSOT<br />
haben in jedem Fall die Verpflichtung, im besten Sinne für<br />
den Patienten Stellung zu nehmen.<br />
Dem Vorstand sind die positiven Aspekte von Guidelines<br />
bewusst. Zu erwähnen sind die positiven Auswirkungen auf<br />
die Sicherheit der Therapie und den Zweck den Behandlungserfolg<br />
(sofern Evidenz dafür gegeben ist) und die Transparenz<br />
zu verbessern. Zudem kann die Standardisierung<br />
einen positiven Einfluss auf die Weiterbildung haben.<br />
Wenn man, wie die SGOT-SSOT auf Guidelines verzichtet,<br />
sollen daher Bedingungen geschaffen werden, die die<br />
Sicherheit des Patienten erhöhen und die Wirksamkeit der<br />
Behandlung verbessern.<br />
Um dies zu ermöglichen, gibt die SGOT-SSOT Empfehlungen<br />
heraus, die genau diesen Aspekten Rechnung tragen und<br />
den Patienten ins Zentrum stellen.<br />
Welche Massnahmen sollen die drei Punkte betreffen:<br />
<strong>–</strong> Patientensicherheit: Empfehlungen zur Reduktion von<br />
Risiken<br />
<strong>–</strong> Behandlungserfolg und Transparenz optimieren:<br />
flächendeckende Outcome-Evaluation<br />
<strong>–</strong> Weiter- und Fortbildung optimieren: Label/Whitelist als<br />
Anreiz für die kontinuierliche Qualitätsanstrengungen<br />
Im Konkreten wurde folgendes festgehalten:<br />
<strong>–</strong> Patientensicherheit: Folgende Empfehlungen beziehen<br />
sich auf Themen mit hoher Sicherheitsrelevanz. Diese<br />
sind:<br />
- dokumentierte Aufklärung (Patient weiss, was auf ihn<br />
zu kommt)<br />
- Safe Surgery Prozess im Spital implementieren<br />
- zur Verfügungstellung von Empfehlungen für:<br />
- perioperative Antibiotikaprophylaxe<br />
- Antibiotikaprophylaxe bei Implantatträgern<br />
- Thromboembolieprophylaxe<br />
<strong>–</strong> Behandlungserfolg optimieren<br />
- CIRS (Critical incident Reporting System) im Spital<br />
- standardisierte Dokumentation (z.B. SIRIS, Minimal<br />
DataSet, Spine Tango etc.)<br />
<strong>–</strong> Weiter- und Fortbildung optimieren<br />
- aus Gutachten lernen: am SGOT-Kongress Aufarbeitung<br />
von einigen FMH-Gutachten<br />
- Wiederholung von Facharztprüfung<br />
- SGOT-Label oder White List<br />
Die Liste der Empfehlungen ist nicht abschliessend und wird<br />
weiterentwickeln.<br />
Urs Müller<br />
15 SGOT | BULLETIN | AKTUELL NR 6 | MAI <strong>2013</strong>